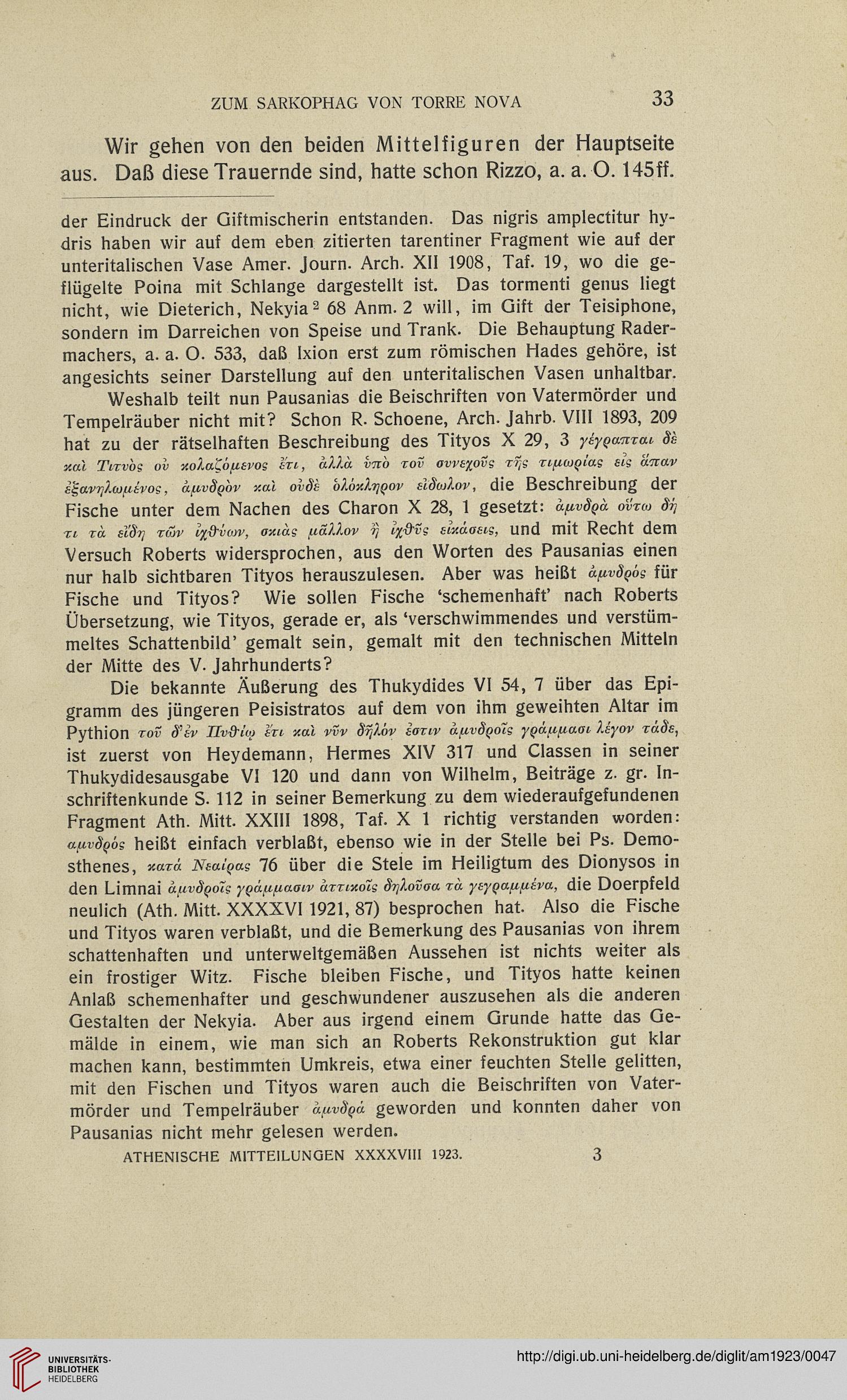ZUM SARKOPHAG VON TORRE NOVA
33
Wir gehen von den beiden Mittelfiguren der Hauptseite
aus. Daß diese Trauernde sind, hatte schon Rizzo, a. a. 0.145ff.
der Eindruck der Giftmischerin entstanden. Das nigris amplectitur hy-
dris haben vvir auf dem eben zitierten tarentiner Fragment wie auf der
unteritalischen Vase Amer. Journ. Arch. XII 1908, Taf. 19, wo die ge-
flügelte Poina mit Schlange dargestellt ist. Das tormenti genus liegt
nicht, wie Dieterich, Nekyia 2 68 Anm. 2 will, im Gift der Teisiphone,
sondern im Darreichen von Speise und Trank. Die Behauptung Rader-
machers, a. a. O. 533, daß Ixion erst zum römischen Hades gehöre, ist
angesichts seiner Darstellung auf den unteritalischen Vasen unhaltbar.
Weshalb teilt nun Pausanias die Beischriften von Vatermörder und
Tempelräuber nicht mit? Schon R. Schoene, Arch. Jahrb. VIII 1893, 209
hat zu der rätselhaften Beschreibung des Tityos X 29, 3 ytyqanxai Ss
y.al Tirv'os ov y.o/.aCoutvos txv, a/J.a vn'o zov ovvsyovs zrjs ziuoioias sis anav
s'iavzjlwfisvos, äuvS(/bv y.ai ovSs okby.lrjQov siSoAov, die Beschreibung der
Fische unter dem Nachen des Charon X 28, 1 gesetzt: afiv§Qa ovzw Srt
zi za slSz] zwv lyß'hon’, oy.tas ua/.Lov -fj iyßvs tiv.äosis, und mit Recht dem
Versuch Roberts widersprochen, aus den Worten des Pausanias einen
nur halb sichtbaren Tityos herauszulesen. Aber was heißt äfiv§QÖs für
Fische und Tityos? Wie sollen Fische ‘schemenhaft’ nach Roberts
Übersetzung, wie Tityos, gerade er, als ‘verschwimmendes und verstüm-
meltes Schattenbild’ gemalt sein, gemalt mit den technischen Mitteln
der Mitte des V. Jahrhunderts?
Die bekannte Äußerung des Thukydides VI 54, 7 über das Epi-
gramm des jiingeren Peisistratos auf dem von ihm geweihten Altar im
Pythion zov ä'iv 1Tv&io) szt y.ai vvv SzjXov soziv äfivSf/ois y()äuuaot Xsyov zäSs,
ist zuerst von Heydemann, Hermes XIV 317 und Classen in seiner
Thukydidesausgabe VI 120 und dann von Wilhelm, Beiträge z. gr. In-
schriftenkunde S. 112 in seiner Bemerkung zu dem wiederaufgefundenen
Fragment Ath. Mitt. XXIII 1898, Taf. X 1 richtig verstanden worden:
uuvSqos heißt einfach verblaßt, ebenso wie in der Stelle bei Ps. Demo-
sthenes, y.azä Nsaigas 76 iiber die Stele im Heiligtum des Dionysos in
den Limnai äuvSQols yQäfiftaoiv äzztxois Srf/.ovoa. zä ysyQafi/usva, die Doerpfeld
neulich (Ath. Mitt. XXXXVI 1921, 87) besprochen hat. AIso die Fische
und Tityos waren verblaßt, und die Bemerkung des Pausanias von ihrem
schattenhaften und unterweltgemäßen Aussehen ist nichts weiter als
ein frostiger Witz. Fische bleiben Fische, und Tityos hatte keinen
Anlaß schemenhafter und geschwundener auszusehen als die anderen
Gestalten der Nekyia. Aber aus irgend einem Grunde hatte das Ge-
mälde in einem, wie man sich an Roberts Rekonstruktion gut klar
machen kann, bestimmten Umkreis, etwa einer feuchten Stelle gelitten,
mit den Fischen und Tityos waren auch die Beischriften von Vater-
mörder und Tempelräuber äftvSQä geworden und konnten daher von
Pausanias nicht mehr gelesen werden.
ATHENISCHE MITTEILUNQEN XXXXVIII 1923. 3
33
Wir gehen von den beiden Mittelfiguren der Hauptseite
aus. Daß diese Trauernde sind, hatte schon Rizzo, a. a. 0.145ff.
der Eindruck der Giftmischerin entstanden. Das nigris amplectitur hy-
dris haben vvir auf dem eben zitierten tarentiner Fragment wie auf der
unteritalischen Vase Amer. Journ. Arch. XII 1908, Taf. 19, wo die ge-
flügelte Poina mit Schlange dargestellt ist. Das tormenti genus liegt
nicht, wie Dieterich, Nekyia 2 68 Anm. 2 will, im Gift der Teisiphone,
sondern im Darreichen von Speise und Trank. Die Behauptung Rader-
machers, a. a. O. 533, daß Ixion erst zum römischen Hades gehöre, ist
angesichts seiner Darstellung auf den unteritalischen Vasen unhaltbar.
Weshalb teilt nun Pausanias die Beischriften von Vatermörder und
Tempelräuber nicht mit? Schon R. Schoene, Arch. Jahrb. VIII 1893, 209
hat zu der rätselhaften Beschreibung des Tityos X 29, 3 ytyqanxai Ss
y.al Tirv'os ov y.o/.aCoutvos txv, a/J.a vn'o zov ovvsyovs zrjs ziuoioias sis anav
s'iavzjlwfisvos, äuvS(/bv y.ai ovSs okby.lrjQov siSoAov, die Beschreibung der
Fische unter dem Nachen des Charon X 28, 1 gesetzt: afiv§Qa ovzw Srt
zi za slSz] zwv lyß'hon’, oy.tas ua/.Lov -fj iyßvs tiv.äosis, und mit Recht dem
Versuch Roberts widersprochen, aus den Worten des Pausanias einen
nur halb sichtbaren Tityos herauszulesen. Aber was heißt äfiv§QÖs für
Fische und Tityos? Wie sollen Fische ‘schemenhaft’ nach Roberts
Übersetzung, wie Tityos, gerade er, als ‘verschwimmendes und verstüm-
meltes Schattenbild’ gemalt sein, gemalt mit den technischen Mitteln
der Mitte des V. Jahrhunderts?
Die bekannte Äußerung des Thukydides VI 54, 7 über das Epi-
gramm des jiingeren Peisistratos auf dem von ihm geweihten Altar im
Pythion zov ä'iv 1Tv&io) szt y.ai vvv SzjXov soziv äfivSf/ois y()äuuaot Xsyov zäSs,
ist zuerst von Heydemann, Hermes XIV 317 und Classen in seiner
Thukydidesausgabe VI 120 und dann von Wilhelm, Beiträge z. gr. In-
schriftenkunde S. 112 in seiner Bemerkung zu dem wiederaufgefundenen
Fragment Ath. Mitt. XXIII 1898, Taf. X 1 richtig verstanden worden:
uuvSqos heißt einfach verblaßt, ebenso wie in der Stelle bei Ps. Demo-
sthenes, y.azä Nsaigas 76 iiber die Stele im Heiligtum des Dionysos in
den Limnai äuvSQols yQäfiftaoiv äzztxois Srf/.ovoa. zä ysyQafi/usva, die Doerpfeld
neulich (Ath. Mitt. XXXXVI 1921, 87) besprochen hat. AIso die Fische
und Tityos waren verblaßt, und die Bemerkung des Pausanias von ihrem
schattenhaften und unterweltgemäßen Aussehen ist nichts weiter als
ein frostiger Witz. Fische bleiben Fische, und Tityos hatte keinen
Anlaß schemenhafter und geschwundener auszusehen als die anderen
Gestalten der Nekyia. Aber aus irgend einem Grunde hatte das Ge-
mälde in einem, wie man sich an Roberts Rekonstruktion gut klar
machen kann, bestimmten Umkreis, etwa einer feuchten Stelle gelitten,
mit den Fischen und Tityos waren auch die Beischriften von Vater-
mörder und Tempelräuber äftvSQä geworden und konnten daher von
Pausanias nicht mehr gelesen werden.
ATHENISCHE MITTEILUNQEN XXXXVIII 1923. 3