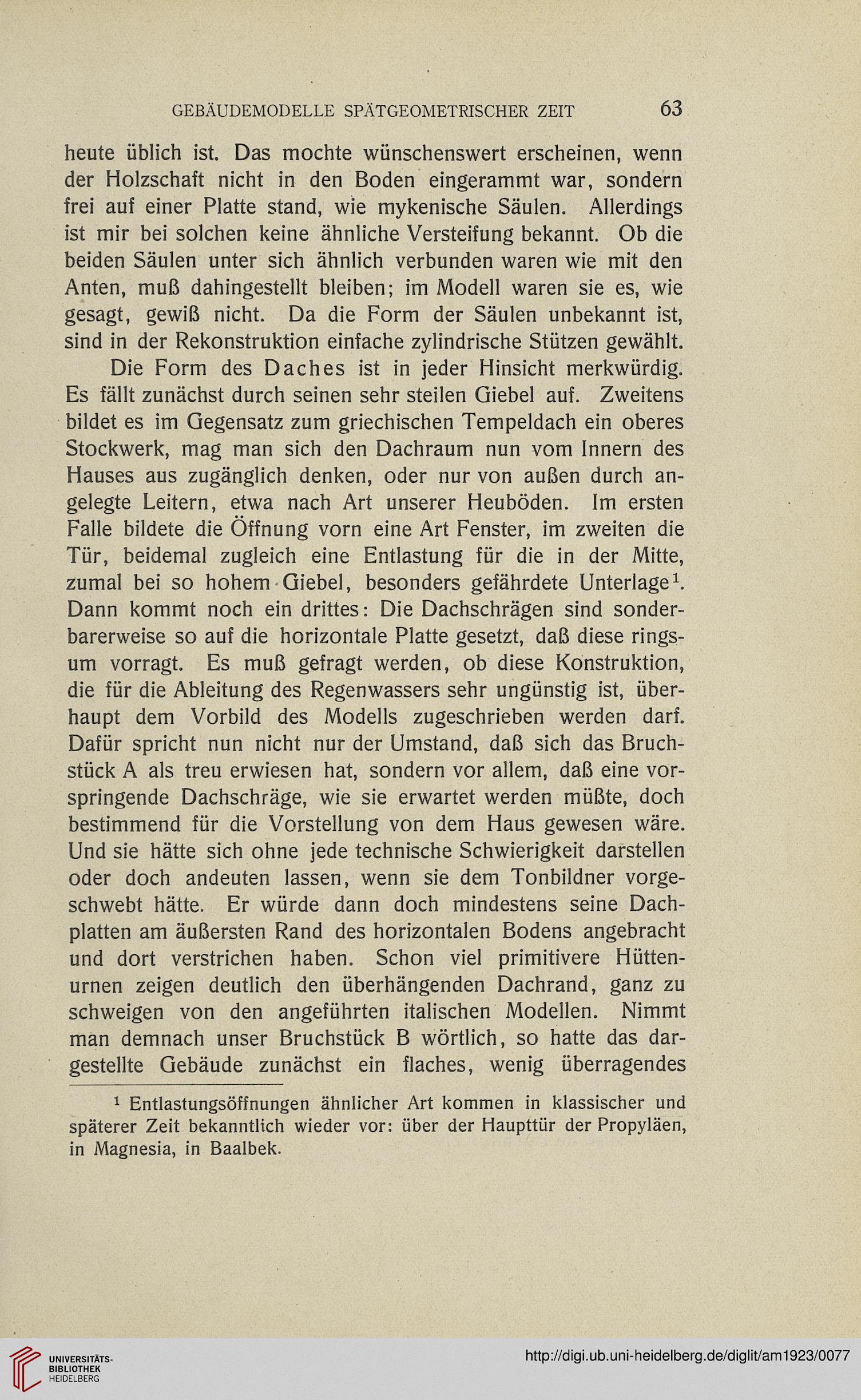GEBÄUDEMODELLE SPÄTGEOMETRISCHER ZEIT 63
heute üblich ist. Das mochte wünschenswert erscheinen, wenn
der Holzschaft nicht in den Boden eingerammt war, sondern
frei auf einer Platte stand, wie mykenische Säulen. Allerdings
ist mir bei solchen keine ähnliche Versteifung bekannt. Ob die
beiden Säulen unter sich ähnlich verbunden waren wie mit den
Anten, muß dahingestellt bleiben; im Modell waren sie es, wie
gesagt, gewiß nicht. Da die Form der Säulen unbekannt ist,
sind in der Rekonstruktion einfache zylindrische Stützen gewählt.
Die Form des Daches ist in jeder Hinsicht merkwürdig.
Es fällt zunächst durch seinen sehr steilen Giebel auf. Zweitens
bildet es im Gegensatz zum griechischen Tempeldach ein oberes
Stockwerk, mag man sich den Dachraum nun vom Innern des
Hauses aus zugänglich denken, oder nur von außen durch an-
gelegte Leitern, etwa nach Art unserer Heuböden. Im ersten
Falle bildete die Öffnung vorn eine Art Fenster, im zweiten die
Tür, beidemal zugleich eine Entlastung für die in der Mitte,
zumal bei so hohem Giebel, besonders gefährdete Unterlage 1.
Dann kommt noch ein drittes: Die Dachschrägen sind sonder-
barerweise so auf die horizontale Platte gesetzt, daß diese rings-
um vorragt. Es muß gefragt werden, ob diese Konstruktion,
die für die Ableitung des Regenwassers sehr ungünstig ist, über-
haupt dem Vorbild des Modells zugeschrieben werden darf.
Dafür spricht nun nicht nur der Umstand, daß sich das Bruch-
stück A als treu erwiesen hat, sondern vor allem, daß eine vor-
springende Dachschräge, wie sie erwartet werden müßte, doch
bestimmend für die Vorstellung von dem Haus gewesen wäre.
Und sie hätte sich ohne jede technische Schwierigkeit darstellen
oder doch andeuten lassen, wenn sie dem Tonbildner vorge-
schwebt hätte. Er würde dann doch mindestens seine Dach-
platten am äußersten Rand des horizontalen Bodens angebracht
und dort verstrichen haben. Schon viel primitivere Hütten-
urnen zeigen deutlich den überhängenden Dachrand, ganz zu
schweigen von den angeführten italischen Modellen. Nimmt
man demnach unser Bruchstück B wörtlich, so hatte das dar-
gestellte Gebäude zunächst ein flaches, wenig überragendes
1 Entlastungsöffnungen ähnlicher Art kommen in klassischer und
späterer Zeit bekanntlich wieder vor: über der Haupttür der Propyläen,
in Magnesia, in Baalbek.
heute üblich ist. Das mochte wünschenswert erscheinen, wenn
der Holzschaft nicht in den Boden eingerammt war, sondern
frei auf einer Platte stand, wie mykenische Säulen. Allerdings
ist mir bei solchen keine ähnliche Versteifung bekannt. Ob die
beiden Säulen unter sich ähnlich verbunden waren wie mit den
Anten, muß dahingestellt bleiben; im Modell waren sie es, wie
gesagt, gewiß nicht. Da die Form der Säulen unbekannt ist,
sind in der Rekonstruktion einfache zylindrische Stützen gewählt.
Die Form des Daches ist in jeder Hinsicht merkwürdig.
Es fällt zunächst durch seinen sehr steilen Giebel auf. Zweitens
bildet es im Gegensatz zum griechischen Tempeldach ein oberes
Stockwerk, mag man sich den Dachraum nun vom Innern des
Hauses aus zugänglich denken, oder nur von außen durch an-
gelegte Leitern, etwa nach Art unserer Heuböden. Im ersten
Falle bildete die Öffnung vorn eine Art Fenster, im zweiten die
Tür, beidemal zugleich eine Entlastung für die in der Mitte,
zumal bei so hohem Giebel, besonders gefährdete Unterlage 1.
Dann kommt noch ein drittes: Die Dachschrägen sind sonder-
barerweise so auf die horizontale Platte gesetzt, daß diese rings-
um vorragt. Es muß gefragt werden, ob diese Konstruktion,
die für die Ableitung des Regenwassers sehr ungünstig ist, über-
haupt dem Vorbild des Modells zugeschrieben werden darf.
Dafür spricht nun nicht nur der Umstand, daß sich das Bruch-
stück A als treu erwiesen hat, sondern vor allem, daß eine vor-
springende Dachschräge, wie sie erwartet werden müßte, doch
bestimmend für die Vorstellung von dem Haus gewesen wäre.
Und sie hätte sich ohne jede technische Schwierigkeit darstellen
oder doch andeuten lassen, wenn sie dem Tonbildner vorge-
schwebt hätte. Er würde dann doch mindestens seine Dach-
platten am äußersten Rand des horizontalen Bodens angebracht
und dort verstrichen haben. Schon viel primitivere Hütten-
urnen zeigen deutlich den überhängenden Dachrand, ganz zu
schweigen von den angeführten italischen Modellen. Nimmt
man demnach unser Bruchstück B wörtlich, so hatte das dar-
gestellte Gebäude zunächst ein flaches, wenig überragendes
1 Entlastungsöffnungen ähnlicher Art kommen in klassischer und
späterer Zeit bekanntlich wieder vor: über der Haupttür der Propyläen,
in Magnesia, in Baalbek.