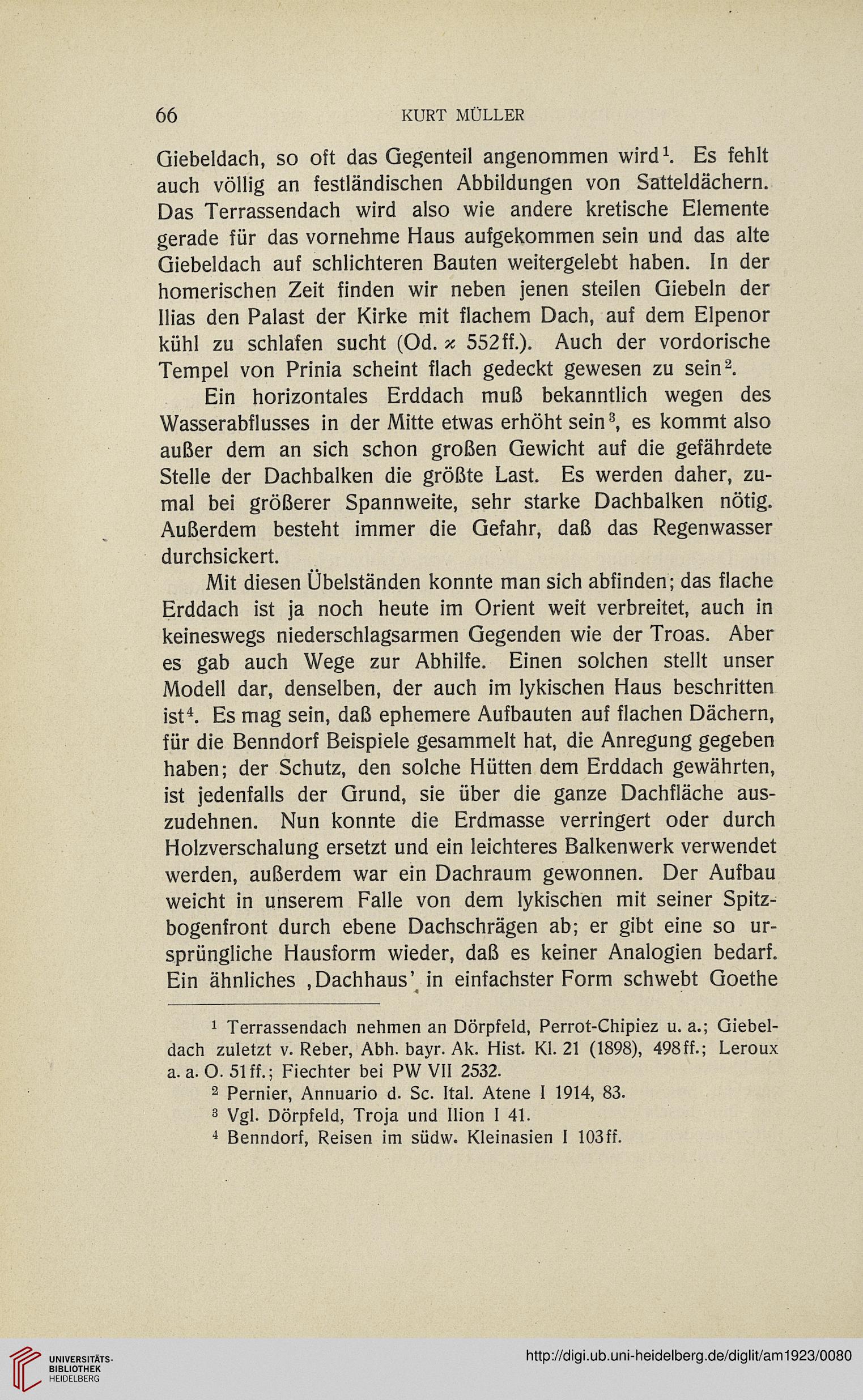66
KURT MÜLLER
Giebeldach, so oft das Gegenteil angenommen wird 1. Es fehlt
auch völlig an festländischen Abbildungen von Satteldächern.
Das Terrassendach wird also wie andere kretische Elemente
gerade für das vornehme Haus aufgekommen sein und das alte
Giebeldach auf schlichteren Bauten weitergelebt haben. In der
homerischen Zeit finden wir neben jenen steilen Giebeln der
Ilias den Palast der Kirke mit flachem Dach, auf dem Elpenor
kühl zu schlafen sucht (Od. x 552ff.). Auch der vordorische
Tempel von Prinia scheint flach gedeckt gewesen zu sein 2.
Ein horizontales Erddach muß bekanntlich wegen des
Wasserabflusses in der Mitte etwas erhöht sein 3, es kommt also
außer dem an sich schon großen Gewicht auf die gefährdete
Stelle der Dachbalken die größte Last. Es werden daher, zu-
mal bei größerer Spannweite, sehr starke Dachbalken nötig.
Außerdem besteht immer die Gefahr, daß das Regenwasser
durchsickert.
Mit diesen Übelständen konnte man sich abfinden; das flache
Erddach ist ja noch heute im Orient weit verbreitet, auch in
keineswegs niederschlagsarmen Gegenden wie der Troas. Aber
es gab auch Wege zur Abhilfe. Einen solchen stellt unser
Modell dar, denselben, der auch im lykischen Haus beschritten
ist 4. Es mag sein, daß ephemere Aufbauten auf flachen Dächern,
für die Benndorf Beispiele gesammelt hat, die Anregung gegeben
haben; der Schutz, den solche Hütten dem Erddach gewährten,
ist jedenfalls der Grund, sie iiber die ganze Dachfläche aus-
zudehnen. Nun konnte die Erdmasse verringert oder durch
Holzverschalung ersetzt und ein leichteres Balkenwerk verwendet
werden, außerdem war ein Dachraum gewonnen. Der Aufbau
weicht in unserem Falle von dem lykischen mit seiner Spitz-
bogenfront durch ebene Dachschrägen ab; er gibt eine so ur-
spriingliche Hausform wieder, daß es keiner Analogien bedarf.
Ein ähnliches »Dachhaus’ in einfachster Form schwebt Goethe
1 Terrassendach nehmen an Dörpfeld, Perrot-Chipiez u. a.; Giebel-
dach zuletzt v. Reber, Abh. bayr. Ak. Hist. KI. 21 (1898), 498 ff.; Leroux
a. a. O. 51 ff.; Fiechter bei PW VII 2532.
2 Pernier, Annuario d. Sc. Ital. Atene I 1914, 83.
3 Vgl. Dörpfeld, Troja und Ilion I 41.
4 Benndorf, Reisen im südw. Kleinasien I 103ff.
KURT MÜLLER
Giebeldach, so oft das Gegenteil angenommen wird 1. Es fehlt
auch völlig an festländischen Abbildungen von Satteldächern.
Das Terrassendach wird also wie andere kretische Elemente
gerade für das vornehme Haus aufgekommen sein und das alte
Giebeldach auf schlichteren Bauten weitergelebt haben. In der
homerischen Zeit finden wir neben jenen steilen Giebeln der
Ilias den Palast der Kirke mit flachem Dach, auf dem Elpenor
kühl zu schlafen sucht (Od. x 552ff.). Auch der vordorische
Tempel von Prinia scheint flach gedeckt gewesen zu sein 2.
Ein horizontales Erddach muß bekanntlich wegen des
Wasserabflusses in der Mitte etwas erhöht sein 3, es kommt also
außer dem an sich schon großen Gewicht auf die gefährdete
Stelle der Dachbalken die größte Last. Es werden daher, zu-
mal bei größerer Spannweite, sehr starke Dachbalken nötig.
Außerdem besteht immer die Gefahr, daß das Regenwasser
durchsickert.
Mit diesen Übelständen konnte man sich abfinden; das flache
Erddach ist ja noch heute im Orient weit verbreitet, auch in
keineswegs niederschlagsarmen Gegenden wie der Troas. Aber
es gab auch Wege zur Abhilfe. Einen solchen stellt unser
Modell dar, denselben, der auch im lykischen Haus beschritten
ist 4. Es mag sein, daß ephemere Aufbauten auf flachen Dächern,
für die Benndorf Beispiele gesammelt hat, die Anregung gegeben
haben; der Schutz, den solche Hütten dem Erddach gewährten,
ist jedenfalls der Grund, sie iiber die ganze Dachfläche aus-
zudehnen. Nun konnte die Erdmasse verringert oder durch
Holzverschalung ersetzt und ein leichteres Balkenwerk verwendet
werden, außerdem war ein Dachraum gewonnen. Der Aufbau
weicht in unserem Falle von dem lykischen mit seiner Spitz-
bogenfront durch ebene Dachschrägen ab; er gibt eine so ur-
spriingliche Hausform wieder, daß es keiner Analogien bedarf.
Ein ähnliches »Dachhaus’ in einfachster Form schwebt Goethe
1 Terrassendach nehmen an Dörpfeld, Perrot-Chipiez u. a.; Giebel-
dach zuletzt v. Reber, Abh. bayr. Ak. Hist. KI. 21 (1898), 498 ff.; Leroux
a. a. O. 51 ff.; Fiechter bei PW VII 2532.
2 Pernier, Annuario d. Sc. Ital. Atene I 1914, 83.
3 Vgl. Dörpfeld, Troja und Ilion I 41.
4 Benndorf, Reisen im südw. Kleinasien I 103ff.