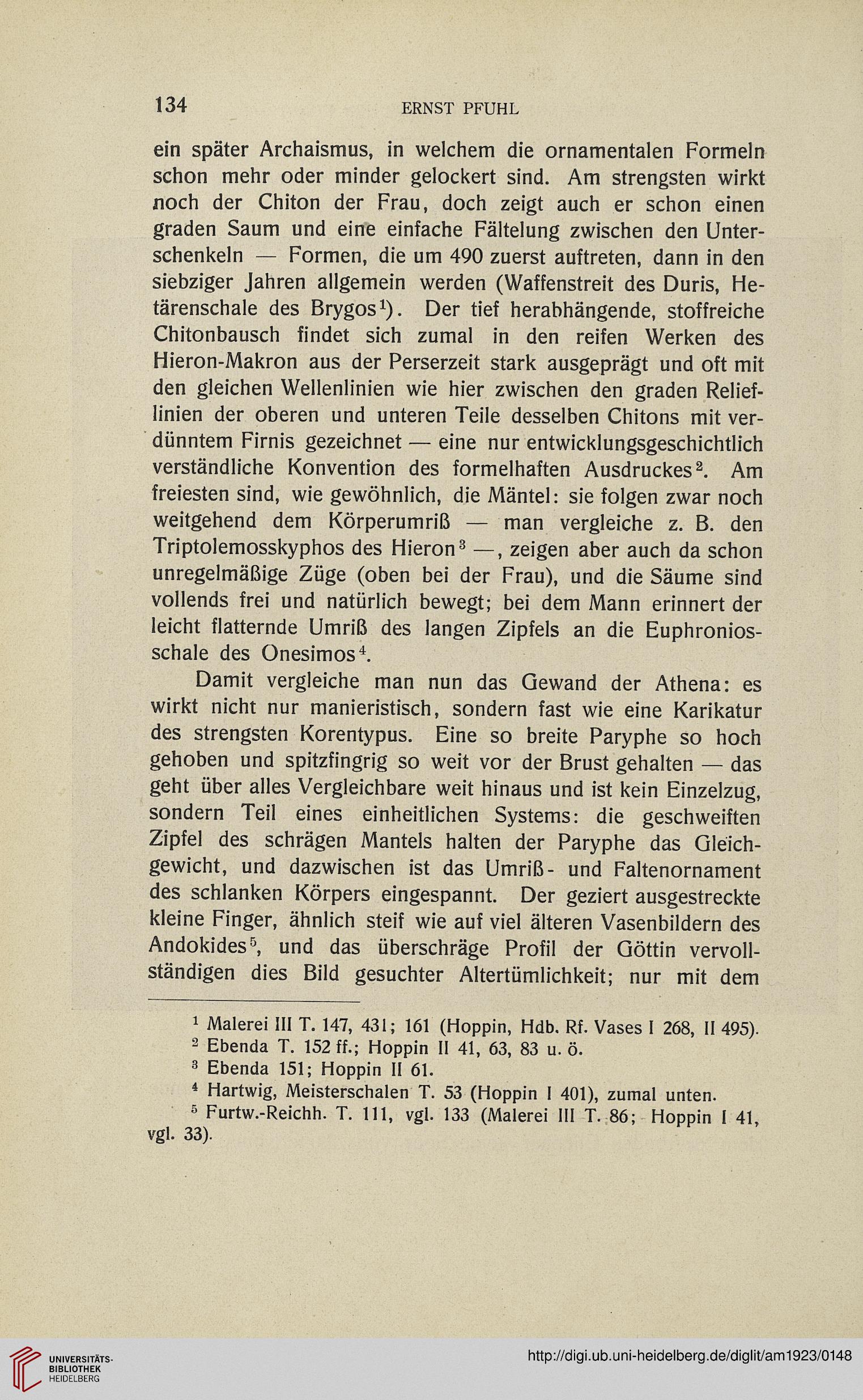134
ERNST PFUHL
ein später Archaismus, in welchem die ornamentalen Formeln
schon mehr oder minder gelockert sind. Am strengsten wirkt
noch der Chiton der Frau, doch zeigt auch er schon einen
graden Saum und eine einfache Fältelung zwischen den Unter-
schenkeln — Formen, die um 490 zuerst auftreten, dann in den
siebziger Jahren allgemein werden (Waffenstreit des Duris, He-
tärenschale des Brygos 1). Der tief herabhängende, stoffreiche
Chitonbausch findet sich zumal in den reifen Werken des
Hieron-Makron aus der Perserzeit stark ausgeprägt und oft mit
den gleichen Wellenlinien wie hier zwischen den graden Relief-
linien der oberen und unteren Teile desselben Chitons mit ver-
dünntem Firnis gezeichnet — eine nur entwicklungsgeschichtlich
verständliche Konvention des formelhaften Ausdruckes 2. Am
freiesten sind, wie gewöhnlich, die Mäntel: sie folgen zwar noch
weitgehend dem Körperumriß — man vergleiche z. B. den
Triptolemosskyphos des Hieron 3 —, zeigen aber auch da schon
unregelmäßige Züge (oben bei der Frau), und die Säume sind
vollends frei und natürlich bewegt; bei dem Mann erinnert der
leicht flatternde Umriß des langen Zipfels an die Euphronios-
schale des Onesimos 4.
Damit vergleiche man nun das Qewand der Athena: es
wirkt nicht nur manieristisch, sondern fast wie eine Karikatur
des strengsten Korentypus. Eine so breite Paryphe so hoch
gehoben und spitzfingrig so weit vor der Brust gehalten — das
geht über alles Vergleichbare weit hinaus und ist kein Einzelzug,
sondern Teil eines einheitlichen Systems: die geschweiften
Zipfel des schrägen Mantels halten der Paryphe das Gleich-
gewicht, und dazwischen ist das Umriß- und Faltenornament
des schlanken Körpers eingespannt. Der geziert ausgestreckte
kleine Finger, ähnlich steif wie auf viel älteren Vasenbildern des
Andokides 5, und das überschräge Profil der Göttin vervoll-
ständigen dies Bild gesuchter Altertümlichkeit; nur mit dem
1 Malerei III T. 147, 431; 161 (Hoppin, Hdb. Rf. Vases I 268, II 495).
2 Ebenda T. 152 ff.; Hoppin II 41, 63, 83 u. ö.
3 Ebenda 151; Hoppin II 61.
4 Hartwig, Meisterschalen T. 53 (Hoppin I 401), zumal unten.
5 Furtw.-Reichh. T. 111, vgl. 133 (Malerei III T. 86; Hoppin I 41,
vgl. 33).
ERNST PFUHL
ein später Archaismus, in welchem die ornamentalen Formeln
schon mehr oder minder gelockert sind. Am strengsten wirkt
noch der Chiton der Frau, doch zeigt auch er schon einen
graden Saum und eine einfache Fältelung zwischen den Unter-
schenkeln — Formen, die um 490 zuerst auftreten, dann in den
siebziger Jahren allgemein werden (Waffenstreit des Duris, He-
tärenschale des Brygos 1). Der tief herabhängende, stoffreiche
Chitonbausch findet sich zumal in den reifen Werken des
Hieron-Makron aus der Perserzeit stark ausgeprägt und oft mit
den gleichen Wellenlinien wie hier zwischen den graden Relief-
linien der oberen und unteren Teile desselben Chitons mit ver-
dünntem Firnis gezeichnet — eine nur entwicklungsgeschichtlich
verständliche Konvention des formelhaften Ausdruckes 2. Am
freiesten sind, wie gewöhnlich, die Mäntel: sie folgen zwar noch
weitgehend dem Körperumriß — man vergleiche z. B. den
Triptolemosskyphos des Hieron 3 —, zeigen aber auch da schon
unregelmäßige Züge (oben bei der Frau), und die Säume sind
vollends frei und natürlich bewegt; bei dem Mann erinnert der
leicht flatternde Umriß des langen Zipfels an die Euphronios-
schale des Onesimos 4.
Damit vergleiche man nun das Qewand der Athena: es
wirkt nicht nur manieristisch, sondern fast wie eine Karikatur
des strengsten Korentypus. Eine so breite Paryphe so hoch
gehoben und spitzfingrig so weit vor der Brust gehalten — das
geht über alles Vergleichbare weit hinaus und ist kein Einzelzug,
sondern Teil eines einheitlichen Systems: die geschweiften
Zipfel des schrägen Mantels halten der Paryphe das Gleich-
gewicht, und dazwischen ist das Umriß- und Faltenornament
des schlanken Körpers eingespannt. Der geziert ausgestreckte
kleine Finger, ähnlich steif wie auf viel älteren Vasenbildern des
Andokides 5, und das überschräge Profil der Göttin vervoll-
ständigen dies Bild gesuchter Altertümlichkeit; nur mit dem
1 Malerei III T. 147, 431; 161 (Hoppin, Hdb. Rf. Vases I 268, II 495).
2 Ebenda T. 152 ff.; Hoppin II 41, 63, 83 u. ö.
3 Ebenda 151; Hoppin II 61.
4 Hartwig, Meisterschalen T. 53 (Hoppin I 401), zumal unten.
5 Furtw.-Reichh. T. 111, vgl. 133 (Malerei III T. 86; Hoppin I 41,
vgl. 33).