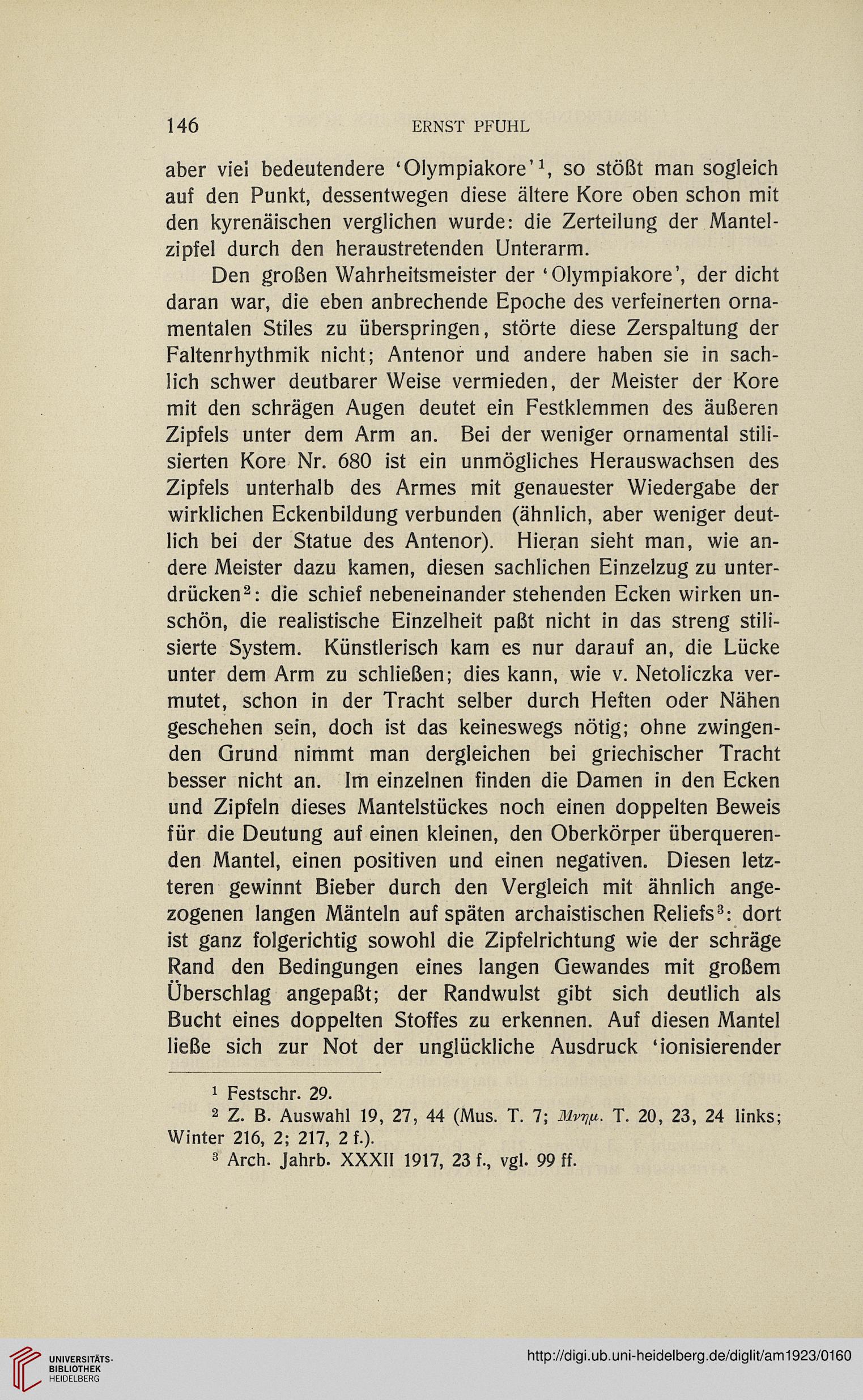146
ERNST PFUHL
aber viei bedeutendere ‘Olympiakore’\ so stößt man sogleich
auf den Punkt, dessentwegen diese ältere Kore oben schon mit
den kyrenäischen verglichen wurde: die Zerteilung der Mantel-
zipfel durch den heraustretenden Unterarm.
Den großen Wahrheitsmeister der ‘Olympiakore’, der dicht
daran war, die eben anbrechende Epoche des verfeinerten orna-
mentalen Stiles zu überspringen, störte diese Zerspaltung der
Faltenrhythmik nicht; Antenor und andere haben sie in sach-
lich schwer deutbarer Weise vermieden, der Meister der Kore
mit den schrägen Augen deutet ein Festklemmen des äußeren
Zipfels unter dem Arm an. Bei der weniger ornamental stili-
sierten Kore Nr. 680 ist ein unmögliches Herauswachsen des
Zipfels unterhalb des Armes mit genauester Wiedergabe der
wirklichen Eckenbildung verbunden (ähnlich, aber weniger deut-
lich bei der Statue des Antenor). Hieran sieht man, wie an-
dere Meister dazu kamen, diesen sachlichen Einzelzug zu unter-
drücken 1 2: die schief nebeneinander stehenden Ecken wirken un-
schön, die realistische Einzelheit paßt nicht in das streng stili-
sierte System. Künstlerisch kam es nur darauf an, die Liicke
unter dem Arm zu schließen; dies kann, wie v. Netoliczka ver-
mutet, schon in der Tracht selber durch Heften oder Nähen
geschehen sein, doch ist das keineswegs nötig; ohne zwingen-
den Grund nimmt man dergleichen bei griechischer Tracht
besser nicht an. Im einzelnen finden die Damen in den Ecken
und Zipfeln dieses Mantelstiickes noch einen doppelten Beweis
fiir die Deutung auf einen kleinen, den Oberkörper iiberqueren-
den Mantel, einen positiven und einen negativen. Diesen letz-
teren gewinnt Bieber durch den Vergleich mit ähnlich ange-
zogenen langen Mänteln auf späten archaistischen Reliefs 3: dort
ist ganz folgerichtig sowohl die Zipfelrichtung wie der schräge
Rand den Bedingungen eines langen Gewandes mit großem
Überschlag angepaßt; der Randwulst gibt sich deutlich als
Bucht eines doppelten Stoffes zu erkennen. Auf diesen Mantel
ließe sich zur Not der unglückliche Ausdruck ‘ionisierender
1 Festschr. 29.
2 Z. B. Auswahl 19, 27, 44 (Mus. T. 7; MvW. T. 20, 23, 24 links;
Winter 216, 2; 217, 2 f.).
3 Arch. Jahrb. XXXII 1917, 23 f., vgl. 99 ff.
ERNST PFUHL
aber viei bedeutendere ‘Olympiakore’\ so stößt man sogleich
auf den Punkt, dessentwegen diese ältere Kore oben schon mit
den kyrenäischen verglichen wurde: die Zerteilung der Mantel-
zipfel durch den heraustretenden Unterarm.
Den großen Wahrheitsmeister der ‘Olympiakore’, der dicht
daran war, die eben anbrechende Epoche des verfeinerten orna-
mentalen Stiles zu überspringen, störte diese Zerspaltung der
Faltenrhythmik nicht; Antenor und andere haben sie in sach-
lich schwer deutbarer Weise vermieden, der Meister der Kore
mit den schrägen Augen deutet ein Festklemmen des äußeren
Zipfels unter dem Arm an. Bei der weniger ornamental stili-
sierten Kore Nr. 680 ist ein unmögliches Herauswachsen des
Zipfels unterhalb des Armes mit genauester Wiedergabe der
wirklichen Eckenbildung verbunden (ähnlich, aber weniger deut-
lich bei der Statue des Antenor). Hieran sieht man, wie an-
dere Meister dazu kamen, diesen sachlichen Einzelzug zu unter-
drücken 1 2: die schief nebeneinander stehenden Ecken wirken un-
schön, die realistische Einzelheit paßt nicht in das streng stili-
sierte System. Künstlerisch kam es nur darauf an, die Liicke
unter dem Arm zu schließen; dies kann, wie v. Netoliczka ver-
mutet, schon in der Tracht selber durch Heften oder Nähen
geschehen sein, doch ist das keineswegs nötig; ohne zwingen-
den Grund nimmt man dergleichen bei griechischer Tracht
besser nicht an. Im einzelnen finden die Damen in den Ecken
und Zipfeln dieses Mantelstiickes noch einen doppelten Beweis
fiir die Deutung auf einen kleinen, den Oberkörper iiberqueren-
den Mantel, einen positiven und einen negativen. Diesen letz-
teren gewinnt Bieber durch den Vergleich mit ähnlich ange-
zogenen langen Mänteln auf späten archaistischen Reliefs 3: dort
ist ganz folgerichtig sowohl die Zipfelrichtung wie der schräge
Rand den Bedingungen eines langen Gewandes mit großem
Überschlag angepaßt; der Randwulst gibt sich deutlich als
Bucht eines doppelten Stoffes zu erkennen. Auf diesen Mantel
ließe sich zur Not der unglückliche Ausdruck ‘ionisierender
1 Festschr. 29.
2 Z. B. Auswahl 19, 27, 44 (Mus. T. 7; MvW. T. 20, 23, 24 links;
Winter 216, 2; 217, 2 f.).
3 Arch. Jahrb. XXXII 1917, 23 f., vgl. 99 ff.