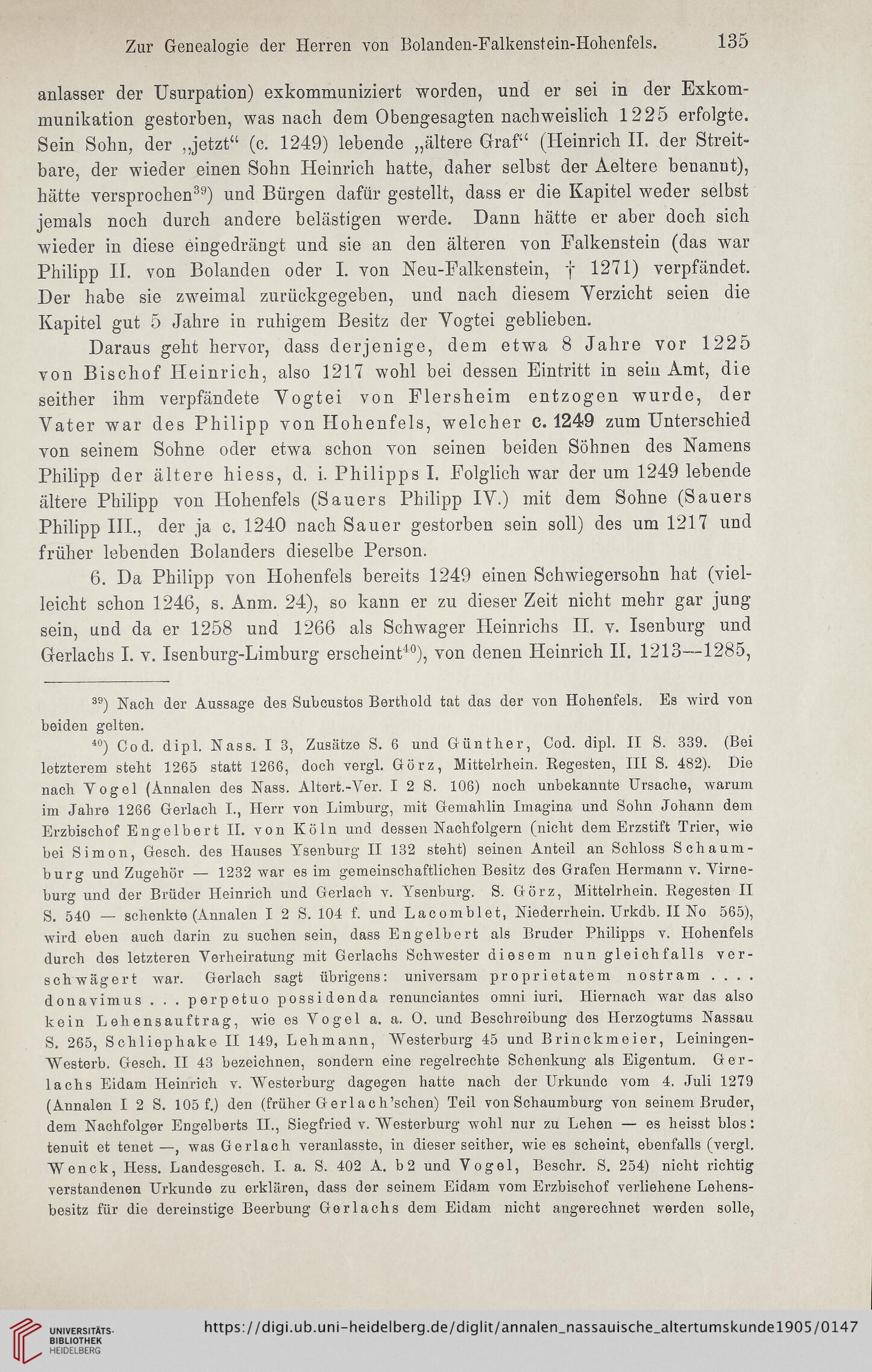Zur Genealogie der Herren von Bolanden-Falkenstein-Hohenfels.
135
anlasser der Usurpation) exkommuniziert worden, und er sei in der Exkom-
munikation gestorben, was nach dem Obengesagten nachweislich 1225 erfolgte.
Sein Sohn, der , jetzt“ (c. 1249) lebende „ältere Graf“ (Heinrich II. der Streit-
bare, der wieder einen Sohn Heinrich hatte, daher selbst der Aeltere benannt),
hätte versprochen* 39) und Bürgen dafür gestellt, dass er die Kapitel weder selbst
jemals noch durch andere belästigen werde. Dann hätte er aber doch sich
wieder in diese eingedrängt und sie an den älteren von Falkenstein (das war
Philipp II. von Bolanden oder I. von Neu-Falkenstein, f 1271) verpfändet.
Der habe sie zweimal zurückgegeben, und nach diesem Verzicht seien die
Kapitel gut 5 Jahre in ruhigem Besitz der Vogtei geblieben.
Daraus geht hervor, dass derjenige, dem etwa 8 Jahre vor 1225
von Bischof Heinrich, also 1217 wohl bei dessen Eintritt in sein Amt, die
seither ihm verpfändete Vogtei von Fiersheim entzogen wurde, der
Vater war des Philipp von Hohenfels, welcher C. 1249 zum Unterschied
von seinem Sohne oder etwa schon von seinen beiden Söhnen des Namens
Philipp der ältere hiess, d. i. Philipps I. Folglich war der um 1249 lebende
ältere Philipp von Hohenfels (Sauers Philipp IV.) mit dem Sohne (Sauers
Philipp III., der ja c. 1240 nach Sauer gestorben sein soll) des um 1217 und
früher lebenden Bolanders dieselbe Person.
6. Da Philipp von Hohenfels bereits 1249 einen Schwiegersohn hat (viel-
leicht schon 1246, s. Anm. 24), so kann er zu dieser Zeit nicht mehr gar jung
sein, und da er 1258 und 1266 als Schwager Heinrichs II. v. Isenburg und
Gerlachs I. v. Isenburg-Limburg erscheint40), von denen Heinrich II. 1213—1285,
S9) Nach der Aussage des Subcustos Berthold tat das der von Hohenfels. Es wird von
beiden gelten.
40) Cod. dipl. Nass. I 3, Zusätze S. 6 und Günther, Cod. dipl. II S. 339. (Bei
letzterem steht 1265 statt 1266, doch vergl. Görz, Mittelrhein. Regesten, III S. 482). Die
nach Vogel (Annalen des Nass. Altert.-Ver. I 2 S. 106) noch unbekannte Ursache, warum
im Jahre 1266 Gerlach I., Herr von Limburg, mit Gemahlin Imagina und Sohn Johann dem
Erzbischof Engelbert II. von Köln und dessen Nachfolgern (nicht dem Erzstift Trier, wie
bei Simon, Gesch. des Hauses Ysenburg II 132 steht) seinen Anteil an Schloss Schaum-
burg und Zugehör — 1232 war es im gemeinschaftlichen Besitz des Grafen Hermann v. Virne-
burg und der Brüder Heinrich und Gerlach v. Ysenburg. S. Görz, Mittelrhein. Regesten II
S. 540 — schenkte (Annalen I 2 S. 104 f. und Lacomblet, Niederrhein. Urkdb. II No 565),
wird eben auch darin zu suchen sein, dass Engelbert als Bruder Philipps v. Hohenfels
durch des letzteren Verheiratung mit Gerlachs Schwester diesem nun gleichfalls ver-
schwägert war. Gerlach sagt übrigens: universam proprietatem nostram . . . .
donavimus . . . perpetuo possidenda renunciantes omni iuri. Hiernach war das also
kein Lehens auftrag, wie es Vogel a. a. 0. und Beschreibung des Herzogtums Nassau
S. 265, Schliephake II 149, Lehmann, Westerburg 45 und Brinckmeier, Leiningen-
Westerb. Gesch. II 43 bezeichnen, sondern eine regelrechte Schenkung als Eigentum. Ger-
lachs Eidam Heinrich v. Westerburg dagegen hatte nach der Urkunde vom 4. Juli 1279
(Annalen I 2 S. 105 f.) den (früher G er 1 a c h’schen) Teil von Schaumburg von seinem Bruder,
dem Nachfolger Engelberts II., Siegfried v. Westerburg wohl nur zu Lehen — es heisst blos:
tenuit et tenet —, was Gerlach veranlasste, in dieser seither, wie es scheint, ebenfalls (vergl.
Wenck, Hess. Landesgesch. I. a. S. 402 A. b2 und Vogel, Beschr. S. 254) nicht richtig
verstandenen Urkunde zu erklären, dass der seinem Eidam vom Erzbischof verliehene Lehens-
besitz für die dereinstige Beerbung Gerlachs dem Eidam nicht angerechnet werden solle,
135
anlasser der Usurpation) exkommuniziert worden, und er sei in der Exkom-
munikation gestorben, was nach dem Obengesagten nachweislich 1225 erfolgte.
Sein Sohn, der , jetzt“ (c. 1249) lebende „ältere Graf“ (Heinrich II. der Streit-
bare, der wieder einen Sohn Heinrich hatte, daher selbst der Aeltere benannt),
hätte versprochen* 39) und Bürgen dafür gestellt, dass er die Kapitel weder selbst
jemals noch durch andere belästigen werde. Dann hätte er aber doch sich
wieder in diese eingedrängt und sie an den älteren von Falkenstein (das war
Philipp II. von Bolanden oder I. von Neu-Falkenstein, f 1271) verpfändet.
Der habe sie zweimal zurückgegeben, und nach diesem Verzicht seien die
Kapitel gut 5 Jahre in ruhigem Besitz der Vogtei geblieben.
Daraus geht hervor, dass derjenige, dem etwa 8 Jahre vor 1225
von Bischof Heinrich, also 1217 wohl bei dessen Eintritt in sein Amt, die
seither ihm verpfändete Vogtei von Fiersheim entzogen wurde, der
Vater war des Philipp von Hohenfels, welcher C. 1249 zum Unterschied
von seinem Sohne oder etwa schon von seinen beiden Söhnen des Namens
Philipp der ältere hiess, d. i. Philipps I. Folglich war der um 1249 lebende
ältere Philipp von Hohenfels (Sauers Philipp IV.) mit dem Sohne (Sauers
Philipp III., der ja c. 1240 nach Sauer gestorben sein soll) des um 1217 und
früher lebenden Bolanders dieselbe Person.
6. Da Philipp von Hohenfels bereits 1249 einen Schwiegersohn hat (viel-
leicht schon 1246, s. Anm. 24), so kann er zu dieser Zeit nicht mehr gar jung
sein, und da er 1258 und 1266 als Schwager Heinrichs II. v. Isenburg und
Gerlachs I. v. Isenburg-Limburg erscheint40), von denen Heinrich II. 1213—1285,
S9) Nach der Aussage des Subcustos Berthold tat das der von Hohenfels. Es wird von
beiden gelten.
40) Cod. dipl. Nass. I 3, Zusätze S. 6 und Günther, Cod. dipl. II S. 339. (Bei
letzterem steht 1265 statt 1266, doch vergl. Görz, Mittelrhein. Regesten, III S. 482). Die
nach Vogel (Annalen des Nass. Altert.-Ver. I 2 S. 106) noch unbekannte Ursache, warum
im Jahre 1266 Gerlach I., Herr von Limburg, mit Gemahlin Imagina und Sohn Johann dem
Erzbischof Engelbert II. von Köln und dessen Nachfolgern (nicht dem Erzstift Trier, wie
bei Simon, Gesch. des Hauses Ysenburg II 132 steht) seinen Anteil an Schloss Schaum-
burg und Zugehör — 1232 war es im gemeinschaftlichen Besitz des Grafen Hermann v. Virne-
burg und der Brüder Heinrich und Gerlach v. Ysenburg. S. Görz, Mittelrhein. Regesten II
S. 540 — schenkte (Annalen I 2 S. 104 f. und Lacomblet, Niederrhein. Urkdb. II No 565),
wird eben auch darin zu suchen sein, dass Engelbert als Bruder Philipps v. Hohenfels
durch des letzteren Verheiratung mit Gerlachs Schwester diesem nun gleichfalls ver-
schwägert war. Gerlach sagt übrigens: universam proprietatem nostram . . . .
donavimus . . . perpetuo possidenda renunciantes omni iuri. Hiernach war das also
kein Lehens auftrag, wie es Vogel a. a. 0. und Beschreibung des Herzogtums Nassau
S. 265, Schliephake II 149, Lehmann, Westerburg 45 und Brinckmeier, Leiningen-
Westerb. Gesch. II 43 bezeichnen, sondern eine regelrechte Schenkung als Eigentum. Ger-
lachs Eidam Heinrich v. Westerburg dagegen hatte nach der Urkunde vom 4. Juli 1279
(Annalen I 2 S. 105 f.) den (früher G er 1 a c h’schen) Teil von Schaumburg von seinem Bruder,
dem Nachfolger Engelberts II., Siegfried v. Westerburg wohl nur zu Lehen — es heisst blos:
tenuit et tenet —, was Gerlach veranlasste, in dieser seither, wie es scheint, ebenfalls (vergl.
Wenck, Hess. Landesgesch. I. a. S. 402 A. b2 und Vogel, Beschr. S. 254) nicht richtig
verstandenen Urkunde zu erklären, dass der seinem Eidam vom Erzbischof verliehene Lehens-
besitz für die dereinstige Beerbung Gerlachs dem Eidam nicht angerechnet werden solle,