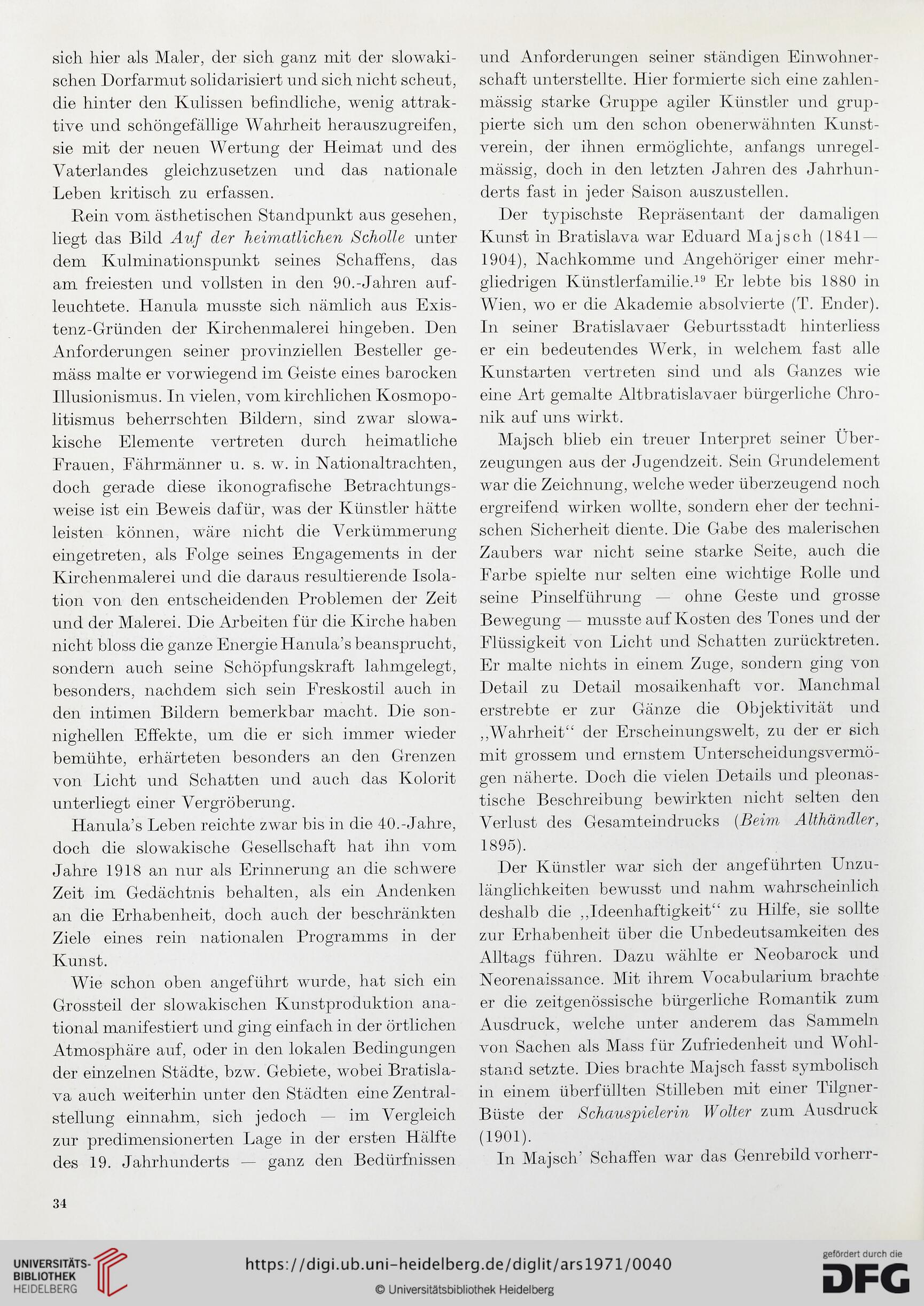sich hier als Maler, der sich ganz mit der slowaki-
schen Dorfarmut solidarisiert und sich nicht scheut,
die hinter den Kulissen befindliche, wenig attrak-
tive und schöngefällige Wahrheit herauszugreifen,
sie mit der neuen Wertung der Heimat und des
Vaterlandes gleichzusetzen und das nationale
Leben kritisch zu erfassen.
Rein vom ästhetischen Standpunkt aus gesehen,
liegt das Bild Auf der heimatlichen Scholle unter
dem Kulminationspunkt seines Schaffens, das
am freiesten und vollsten in den 90.-Jahren auf-
leuchtete. Hanula musste sich nämlich aus Exis-
tenz-Gründen der Kirchenmalerei hingeben. Den
Anforderungen seiner provinziellen Besteller ge-
mäss malte er vorwiegend im Geiste eines barocken
Illusionismus. In vielen, vom kirchlichen Kosmopo-
litismus beherrschten Bildern, sind zwar slowa-
kische Elemente vertreten durch heimatliche
Frauen, Fährmänner u. s. w. in Nationaltrachten,
doch gerade diese ikonografische Betrachtungs-
weise ist ein Beweis dafür, was der Künstler hätte
leisten können, wäre nicht die Verkümmerung
eingetreten, als Folge seines Engagements in der
Kirchenmalerei und die daraus resultierende Isola-
tion von den entscheidenden Problemen der Zeit
und der Malerei. Die Arbeiten für die Kirche haben
nicht bloss die ganze Energie Hanula’s beansprucht,
sondern auch seine Schöpfungskraft lahmgelegt,
besonders, nachdem sich sein Freskostil auch in
den intimen Bildern bemerkbar macht. Die son-
nighellen Effekte, um die er sich immer wieder
bemühte, erhärteten besonders an den Grenzen
von Licht und Schatten und auch das Kolorit
unterliegt einer Vergröberung.
Hanula’s Leben reichte zwar bis in die 40.-Jahre,
doch die slowakische Gesellschaft hat ihn vom
Jahre 1918 an nur als Erinnerung an die schwere
Zeit im Gedächtnis behalten, als ein Andenken
an die Erhabenheit, doch auch der beschränkten
Ziele eines rein nationalen Programms in der
Kunst.
Wie schon oben angeführt wurde, hat sich ein
Grossteil der slowakischen Kunstproduktion ana-
tional manifestiert und ging einfach in der örtlichen
Atmosphäre auf, oder in den lokalen Bedingungen
der einzelnen Städte, bzw. Gebiete, wobei Bratisla-
va auch weiterhin unter den Städten eine Zentral-
stellung einnahm, sich jedoch — im Vergleich
zur predimensionerten Lage in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts — ganz den Bedürfnissen
und Anforderungen seiner ständigen Einwohner-
schaft unterstellte. Hier formierte sich eine zahlen-
mässig starke Gruppe agiler Künstler und grup-
pierte sich um den schon obenerwähnten Kunst-
verein, der ihnen ermöglichte, anfangs unregel-
mässig, doch in den letzten Jahren des Jahrhun-
derts fast in jeder Saison auszustellen.
Der typischste Repräsentant der damaligen
Kunst in Bratislava war Eduard Majsch (1841 —
1904), Nachkomme und Angehöriger einer mehr-
gliedrigen Künstlerfamilie.19 Er lebte bis 1880 in
Wien, wo er die Akademie absolvierte (T. Ender).
In seiner Bratislavaer Geburtsstadt hinterliess
er ein bedeutendes Werk, in welchem fast alle
Kunstarten vertreten sind und als Ganzes wie
eine Art gemalte Altbratislavaer bürgerliche Chro-
nik auf uns wirkt.
Majsch blieb ein treuer Interpret seiner Über-
zeugungen aus der Jugendzeit. Sein Grundelement
war die Zeichnung, welche weder überzeugend noch
ergreifend wirken wollte, sondern eher der techni-
schen Sicherheit diente. Die Gabe des malerischen
Zaubers war nicht seine starke Seite, auch die
Farbe spielte nur selten eine wichtige Rolle und
seine Pinselführung — ohne Geste und grosse
Bewegung — musste auf Kosten des Tones und der
Flüssigkeit von Licht und Schatten zurücktreten.
Er malte nichts in einem Zuge, sondern ging von
Detail zu Detail mosaikenhaft vor. Manchmal
erstrebte er zur Gänze die Objektivität und
„Wahrheit“ der Erscheinungswelt, zu der er sich
mit grossem und ernstem Unterscheidungsvermö-
gen näherte. Doch die vielen Details und pleonas-
tische Beschreibung bewirkten nicht selten den
Verlust des Gesamteindrucks (Beim Althändler,
1895).
Der Künstler war sich der angeführten Unzu-
länglichkeiten bewusst und nahm wahrscheinlich
deshalb die „Ideenhaftigkeit“ zu Hilfe, sie sollte
zur Erhabenheit über die Unbedeutsamkeiten des
Alltags führen. Dazu wählte er Neobarock und
Neorenaissance. Mit ihrem Vocabularium brachte
er die zeitgenössische bürgerliche Romantik zum
Ausdruck, welche unter anderem das Sammeln
von Sachen als Mass für Zufriedenheit und Wohl-
stand setzte. Dies brachte Majsch fasst symbolisch
in einem überfüllten Stilleben mit einer Tilgner-
Büste der Schauspielerin Wolter zum Ausdruck
(1901).
In Majsch’ Schaffen war das Genrebild vorherr-
34
schen Dorfarmut solidarisiert und sich nicht scheut,
die hinter den Kulissen befindliche, wenig attrak-
tive und schöngefällige Wahrheit herauszugreifen,
sie mit der neuen Wertung der Heimat und des
Vaterlandes gleichzusetzen und das nationale
Leben kritisch zu erfassen.
Rein vom ästhetischen Standpunkt aus gesehen,
liegt das Bild Auf der heimatlichen Scholle unter
dem Kulminationspunkt seines Schaffens, das
am freiesten und vollsten in den 90.-Jahren auf-
leuchtete. Hanula musste sich nämlich aus Exis-
tenz-Gründen der Kirchenmalerei hingeben. Den
Anforderungen seiner provinziellen Besteller ge-
mäss malte er vorwiegend im Geiste eines barocken
Illusionismus. In vielen, vom kirchlichen Kosmopo-
litismus beherrschten Bildern, sind zwar slowa-
kische Elemente vertreten durch heimatliche
Frauen, Fährmänner u. s. w. in Nationaltrachten,
doch gerade diese ikonografische Betrachtungs-
weise ist ein Beweis dafür, was der Künstler hätte
leisten können, wäre nicht die Verkümmerung
eingetreten, als Folge seines Engagements in der
Kirchenmalerei und die daraus resultierende Isola-
tion von den entscheidenden Problemen der Zeit
und der Malerei. Die Arbeiten für die Kirche haben
nicht bloss die ganze Energie Hanula’s beansprucht,
sondern auch seine Schöpfungskraft lahmgelegt,
besonders, nachdem sich sein Freskostil auch in
den intimen Bildern bemerkbar macht. Die son-
nighellen Effekte, um die er sich immer wieder
bemühte, erhärteten besonders an den Grenzen
von Licht und Schatten und auch das Kolorit
unterliegt einer Vergröberung.
Hanula’s Leben reichte zwar bis in die 40.-Jahre,
doch die slowakische Gesellschaft hat ihn vom
Jahre 1918 an nur als Erinnerung an die schwere
Zeit im Gedächtnis behalten, als ein Andenken
an die Erhabenheit, doch auch der beschränkten
Ziele eines rein nationalen Programms in der
Kunst.
Wie schon oben angeführt wurde, hat sich ein
Grossteil der slowakischen Kunstproduktion ana-
tional manifestiert und ging einfach in der örtlichen
Atmosphäre auf, oder in den lokalen Bedingungen
der einzelnen Städte, bzw. Gebiete, wobei Bratisla-
va auch weiterhin unter den Städten eine Zentral-
stellung einnahm, sich jedoch — im Vergleich
zur predimensionerten Lage in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts — ganz den Bedürfnissen
und Anforderungen seiner ständigen Einwohner-
schaft unterstellte. Hier formierte sich eine zahlen-
mässig starke Gruppe agiler Künstler und grup-
pierte sich um den schon obenerwähnten Kunst-
verein, der ihnen ermöglichte, anfangs unregel-
mässig, doch in den letzten Jahren des Jahrhun-
derts fast in jeder Saison auszustellen.
Der typischste Repräsentant der damaligen
Kunst in Bratislava war Eduard Majsch (1841 —
1904), Nachkomme und Angehöriger einer mehr-
gliedrigen Künstlerfamilie.19 Er lebte bis 1880 in
Wien, wo er die Akademie absolvierte (T. Ender).
In seiner Bratislavaer Geburtsstadt hinterliess
er ein bedeutendes Werk, in welchem fast alle
Kunstarten vertreten sind und als Ganzes wie
eine Art gemalte Altbratislavaer bürgerliche Chro-
nik auf uns wirkt.
Majsch blieb ein treuer Interpret seiner Über-
zeugungen aus der Jugendzeit. Sein Grundelement
war die Zeichnung, welche weder überzeugend noch
ergreifend wirken wollte, sondern eher der techni-
schen Sicherheit diente. Die Gabe des malerischen
Zaubers war nicht seine starke Seite, auch die
Farbe spielte nur selten eine wichtige Rolle und
seine Pinselführung — ohne Geste und grosse
Bewegung — musste auf Kosten des Tones und der
Flüssigkeit von Licht und Schatten zurücktreten.
Er malte nichts in einem Zuge, sondern ging von
Detail zu Detail mosaikenhaft vor. Manchmal
erstrebte er zur Gänze die Objektivität und
„Wahrheit“ der Erscheinungswelt, zu der er sich
mit grossem und ernstem Unterscheidungsvermö-
gen näherte. Doch die vielen Details und pleonas-
tische Beschreibung bewirkten nicht selten den
Verlust des Gesamteindrucks (Beim Althändler,
1895).
Der Künstler war sich der angeführten Unzu-
länglichkeiten bewusst und nahm wahrscheinlich
deshalb die „Ideenhaftigkeit“ zu Hilfe, sie sollte
zur Erhabenheit über die Unbedeutsamkeiten des
Alltags führen. Dazu wählte er Neobarock und
Neorenaissance. Mit ihrem Vocabularium brachte
er die zeitgenössische bürgerliche Romantik zum
Ausdruck, welche unter anderem das Sammeln
von Sachen als Mass für Zufriedenheit und Wohl-
stand setzte. Dies brachte Majsch fasst symbolisch
in einem überfüllten Stilleben mit einer Tilgner-
Büste der Schauspielerin Wolter zum Ausdruck
(1901).
In Majsch’ Schaffen war das Genrebild vorherr-
34