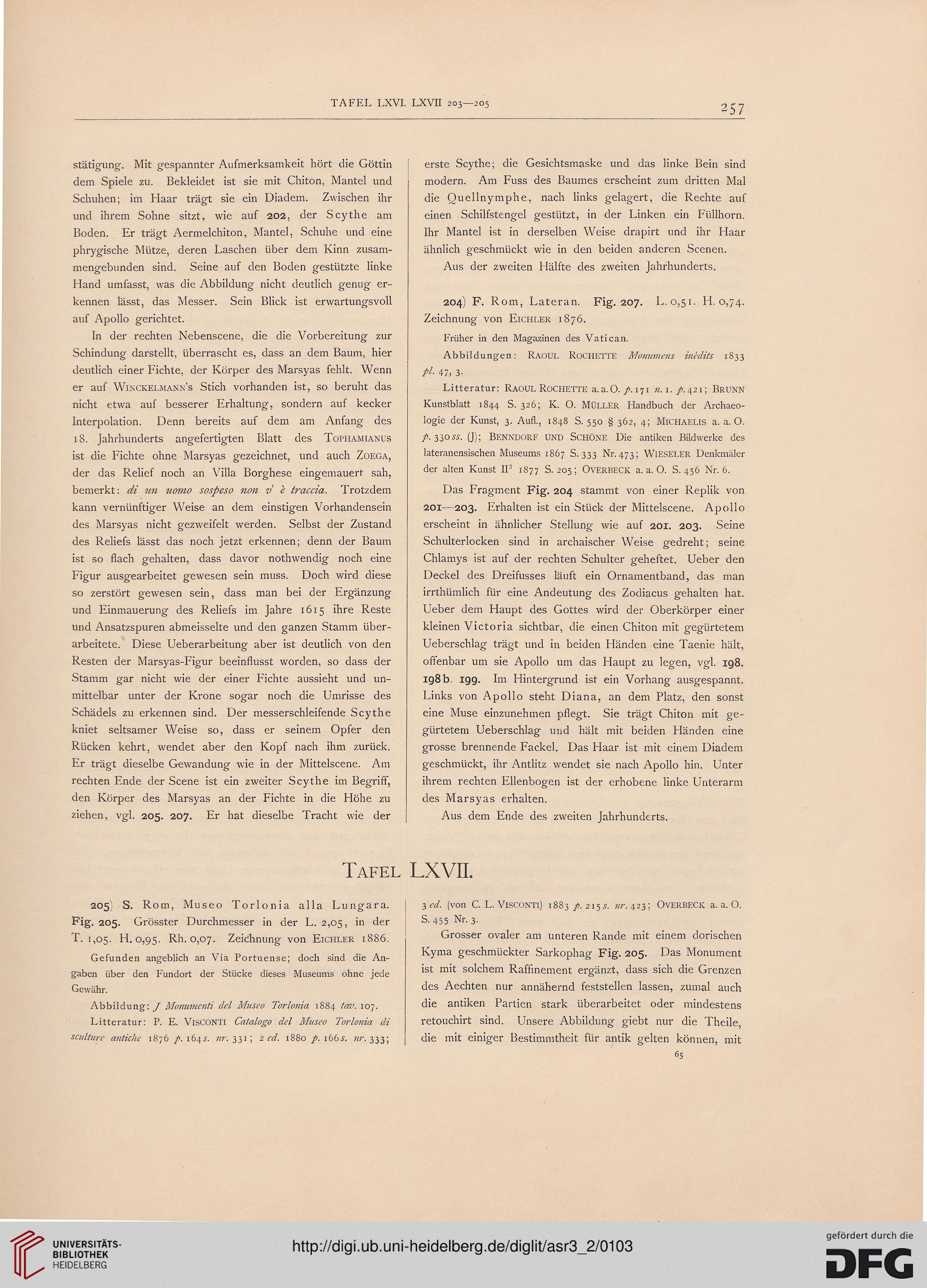TAFEL LXVI. LXVII 203—205
257
stätigung. Mit gespannter Aufmerksamkeit hört die Göttin
dem Spiele zu. Bekleidet ist sie mit Chiton, Mantel und
Schuhen; im Haar trägt sie ein Diadem. Zwischen ihr
und ihrem Sohne sitzt, wie auf 202, der Scythe am
Boden. Er trägt Aermelchiton, Mantel. Schuhe und eine
phrygische Mütze, deren Laschen über dem Kinn zusam-
mengebunden sind. Seine auf den Boden gestützte linke
Hand umfasst, was die Abbildung nicht deutlich genug er-
kennen lässt, das Messer. Sein Blick ist erwartungsvoll
auf Apollo gerichtet.
In der rechten Nebenscene, die die Vorbereitung zur
Schindung darstellt, überrascht es, dass an dem Baum, hier
deutlich einer Fichte, der Körper des Marsyas fehlt. Wenn
er auf Winckelmann's Stich vorhanden ist, so beruht das
nicht etwa auf besserer Erhaltung, sondern auf kecker
Interpolation. Denn bereits auf dem am Anfang des
18. Jahrhunderts angefertigten Blatt des Tophamianus
ist die Fichte ohne Marsyas gezeichnet, und auch Zoega,
der das Relief noch an Villa Borghese eingemauert sah,
bemerkt: di un uomo sospeso non v e traccia. Trotzdem
kann vernünftiger Weise an dem einstigen Vorhandensein
des Marsyas nicht gezweifelt werden. Selbst der Zustand
des Reliefs lässt das noch jetzt erkennen; denn der Baum
ist so flach gehalten, dass davor nothwendig noch eine
Figur ausgearbeitet gewesen sein muss. Doch wird diese
so zerstört gewesen sein, dass man bei der Ergänzung
und Einmauerung des Reliefs im Jahre 1615 ihre Reste
und Ansatzspuren abmeisselte und den ganzen Stamm über-
arbeitete. Diese Ueberarbeitung aber ist deutlich von den
Resten der Marsyas-Figur beeinflusst worden, so dass der
Stamm gar nicht wie der einer Fichte aussieht und un-
mittelbar unter der Krone sogar noch die Umrisse des
Schädels zu erkennen sind. Der messerschleifende Scythe
kniet seltsamer Weise so, dass er seinem Opfer den
Rücken kehrt, wendet aber den Kopf nach ihm zurück.
Er trägt dieselbe Gewandung wie in der Mittelscene. Am
rechten Ende der Scene ist ein zweiter Scythe im Begriff,
den Körper des Marsyas an der Fichte in die Höhe zu
ziehen, vgl. 205. 207. Er hat dieselbe Tracht wie der
erste Scythe; die Gesichtsmaske und das linke Bein sind
modern. Am Fuss des Baumes erscheint zum dritten Mal
die Ouellnymphe, nach links gelagert, die Rechte auf
einen Schilfstengel gestützt, in der Linken ein Füllhorn.
Ihr Mantel ist in derselben Weise drapirt und ihr Haar
ähnlich geschmückt wie in den beiden anderen Scenen.
Aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts.
204) F. Rom, Lateran. Fig. 207. L. 0,51. H. 0,74.
Zeichnung von Eichler 1876.
Früher in den Magazinen des Vatican.
Abbildungen: Raoul Rochette Monumens inedits 1833
Pl> 47, 3-
Litteratur: Raoul Rochette a.a..O.-/. 171 «.1./.421; Brunn
Kunstblatt 1844 S. 326; K. O. Müller Handbuch der Archaeo-
logie der Kunst, 3. Aufl., 1848 S. 550 § 362, 4; Michaelis a. a. O.
p. 330 55. (J); Benndorf und Schöne Die antiken Bildwerke des
lateranensischen Museums 1867 S. 333 Nr. 473; Wieseler Denkmäler
der alten Kunst II3 1877 S. 205; Overbeck a. a. O. S. 456 Nr. 6.
Das Fragment Fig. 204 stammt von einer Replik von
201—203. Erhalten ist ein Stück der Mittelscene. Apollo
erscheint in ähnlicher Stellung wie auf 201. 203. Seine
Schulterlocken sind in archaischer Weise gedreht; seine
Chlamys ist auf der rechten Schulter geheftet. Ueber den
Deckel des Dreifusses läuft ein Ornamentband, das man
irrthümlich für eine Andeutung des Zodiacus gehalten hat.
Ueber dem Haupt des Gottes wird der Oberkörper einer
kleinen Victoria sichtbar, die einen Chiton mit gegürtetem
Ueberschlag trägt und in beiden Händen eine Taenie hält,
offenbar um sie Apollo um das Haupt zu legen, vgl. 198.
198b. 199. Im Hintergrund ist ein Vorhang ausgespannt.
Links von Apollo steht Diana, an dem Platz, den sonst
eine Muse einzunehmen pflegt. Sie trägt Chiton mit ge-
gürtetem Ueberschlag und hält mit beiden Händen eine
grosse brennende Fackel. Das Haar ist mit einem Diadem
geschmückt, ihr Antlitz wendet sie nach Apollo hin. Unter
ihrem rechten Ellenbogen ist der erhobene linke Unterarm
des Marsyas erhalten.
Aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts.
Tafel LXVII.
205) S. Rom, Museo Torlonia alla Lungara.
Fig. 205. Grösster Durchmesser in der L. 2,05, in der
T. 1,05. H. 0,95. Rh. 0,07. Zeichnung von Eichler 1886.
Gefunden angeblich an Via Portuense; doch sind die An-
gaben über den Fundort der Stücke dieses Museums ohne jede
Gewähr.
Abbildung: J Monumenti del Museo Torlonia 1884 tav. 107.
Litteratur: P. E. visconti Catalogo del Museo Torlonia di
sadture antiche 1876 p. 164J. nr. 331; 2 ed. 1880 p.itts. nr. 333;
3 ed. (von C. L. Visconti) 1883 p. 2155. nr. 423; Overbeck a.a.O.
S. 455 Nr. 3.
Grosser ovaler am unteren Rande mit einem dorischen
Kyma geschmückter Sarkophag Fig. 205. Das Monument
ist mit solchem Raffinement ergänzt, dass sich die Grenzen
des Aechten nur annähernd feststellen lassen, zumal auch
die antiken Partien stark überarbeitet oder mindestens
retouchirt sind. Unsere Abbildung giebt nur die Theile,
die mit einiger Bestimmtheit für antik gelten können, mit
65
257
stätigung. Mit gespannter Aufmerksamkeit hört die Göttin
dem Spiele zu. Bekleidet ist sie mit Chiton, Mantel und
Schuhen; im Haar trägt sie ein Diadem. Zwischen ihr
und ihrem Sohne sitzt, wie auf 202, der Scythe am
Boden. Er trägt Aermelchiton, Mantel. Schuhe und eine
phrygische Mütze, deren Laschen über dem Kinn zusam-
mengebunden sind. Seine auf den Boden gestützte linke
Hand umfasst, was die Abbildung nicht deutlich genug er-
kennen lässt, das Messer. Sein Blick ist erwartungsvoll
auf Apollo gerichtet.
In der rechten Nebenscene, die die Vorbereitung zur
Schindung darstellt, überrascht es, dass an dem Baum, hier
deutlich einer Fichte, der Körper des Marsyas fehlt. Wenn
er auf Winckelmann's Stich vorhanden ist, so beruht das
nicht etwa auf besserer Erhaltung, sondern auf kecker
Interpolation. Denn bereits auf dem am Anfang des
18. Jahrhunderts angefertigten Blatt des Tophamianus
ist die Fichte ohne Marsyas gezeichnet, und auch Zoega,
der das Relief noch an Villa Borghese eingemauert sah,
bemerkt: di un uomo sospeso non v e traccia. Trotzdem
kann vernünftiger Weise an dem einstigen Vorhandensein
des Marsyas nicht gezweifelt werden. Selbst der Zustand
des Reliefs lässt das noch jetzt erkennen; denn der Baum
ist so flach gehalten, dass davor nothwendig noch eine
Figur ausgearbeitet gewesen sein muss. Doch wird diese
so zerstört gewesen sein, dass man bei der Ergänzung
und Einmauerung des Reliefs im Jahre 1615 ihre Reste
und Ansatzspuren abmeisselte und den ganzen Stamm über-
arbeitete. Diese Ueberarbeitung aber ist deutlich von den
Resten der Marsyas-Figur beeinflusst worden, so dass der
Stamm gar nicht wie der einer Fichte aussieht und un-
mittelbar unter der Krone sogar noch die Umrisse des
Schädels zu erkennen sind. Der messerschleifende Scythe
kniet seltsamer Weise so, dass er seinem Opfer den
Rücken kehrt, wendet aber den Kopf nach ihm zurück.
Er trägt dieselbe Gewandung wie in der Mittelscene. Am
rechten Ende der Scene ist ein zweiter Scythe im Begriff,
den Körper des Marsyas an der Fichte in die Höhe zu
ziehen, vgl. 205. 207. Er hat dieselbe Tracht wie der
erste Scythe; die Gesichtsmaske und das linke Bein sind
modern. Am Fuss des Baumes erscheint zum dritten Mal
die Ouellnymphe, nach links gelagert, die Rechte auf
einen Schilfstengel gestützt, in der Linken ein Füllhorn.
Ihr Mantel ist in derselben Weise drapirt und ihr Haar
ähnlich geschmückt wie in den beiden anderen Scenen.
Aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts.
204) F. Rom, Lateran. Fig. 207. L. 0,51. H. 0,74.
Zeichnung von Eichler 1876.
Früher in den Magazinen des Vatican.
Abbildungen: Raoul Rochette Monumens inedits 1833
Pl> 47, 3-
Litteratur: Raoul Rochette a.a..O.-/. 171 «.1./.421; Brunn
Kunstblatt 1844 S. 326; K. O. Müller Handbuch der Archaeo-
logie der Kunst, 3. Aufl., 1848 S. 550 § 362, 4; Michaelis a. a. O.
p. 330 55. (J); Benndorf und Schöne Die antiken Bildwerke des
lateranensischen Museums 1867 S. 333 Nr. 473; Wieseler Denkmäler
der alten Kunst II3 1877 S. 205; Overbeck a. a. O. S. 456 Nr. 6.
Das Fragment Fig. 204 stammt von einer Replik von
201—203. Erhalten ist ein Stück der Mittelscene. Apollo
erscheint in ähnlicher Stellung wie auf 201. 203. Seine
Schulterlocken sind in archaischer Weise gedreht; seine
Chlamys ist auf der rechten Schulter geheftet. Ueber den
Deckel des Dreifusses läuft ein Ornamentband, das man
irrthümlich für eine Andeutung des Zodiacus gehalten hat.
Ueber dem Haupt des Gottes wird der Oberkörper einer
kleinen Victoria sichtbar, die einen Chiton mit gegürtetem
Ueberschlag trägt und in beiden Händen eine Taenie hält,
offenbar um sie Apollo um das Haupt zu legen, vgl. 198.
198b. 199. Im Hintergrund ist ein Vorhang ausgespannt.
Links von Apollo steht Diana, an dem Platz, den sonst
eine Muse einzunehmen pflegt. Sie trägt Chiton mit ge-
gürtetem Ueberschlag und hält mit beiden Händen eine
grosse brennende Fackel. Das Haar ist mit einem Diadem
geschmückt, ihr Antlitz wendet sie nach Apollo hin. Unter
ihrem rechten Ellenbogen ist der erhobene linke Unterarm
des Marsyas erhalten.
Aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts.
Tafel LXVII.
205) S. Rom, Museo Torlonia alla Lungara.
Fig. 205. Grösster Durchmesser in der L. 2,05, in der
T. 1,05. H. 0,95. Rh. 0,07. Zeichnung von Eichler 1886.
Gefunden angeblich an Via Portuense; doch sind die An-
gaben über den Fundort der Stücke dieses Museums ohne jede
Gewähr.
Abbildung: J Monumenti del Museo Torlonia 1884 tav. 107.
Litteratur: P. E. visconti Catalogo del Museo Torlonia di
sadture antiche 1876 p. 164J. nr. 331; 2 ed. 1880 p.itts. nr. 333;
3 ed. (von C. L. Visconti) 1883 p. 2155. nr. 423; Overbeck a.a.O.
S. 455 Nr. 3.
Grosser ovaler am unteren Rande mit einem dorischen
Kyma geschmückter Sarkophag Fig. 205. Das Monument
ist mit solchem Raffinement ergänzt, dass sich die Grenzen
des Aechten nur annähernd feststellen lassen, zumal auch
die antiken Partien stark überarbeitet oder mindestens
retouchirt sind. Unsere Abbildung giebt nur die Theile,
die mit einiger Bestimmtheit für antik gelten können, mit
65