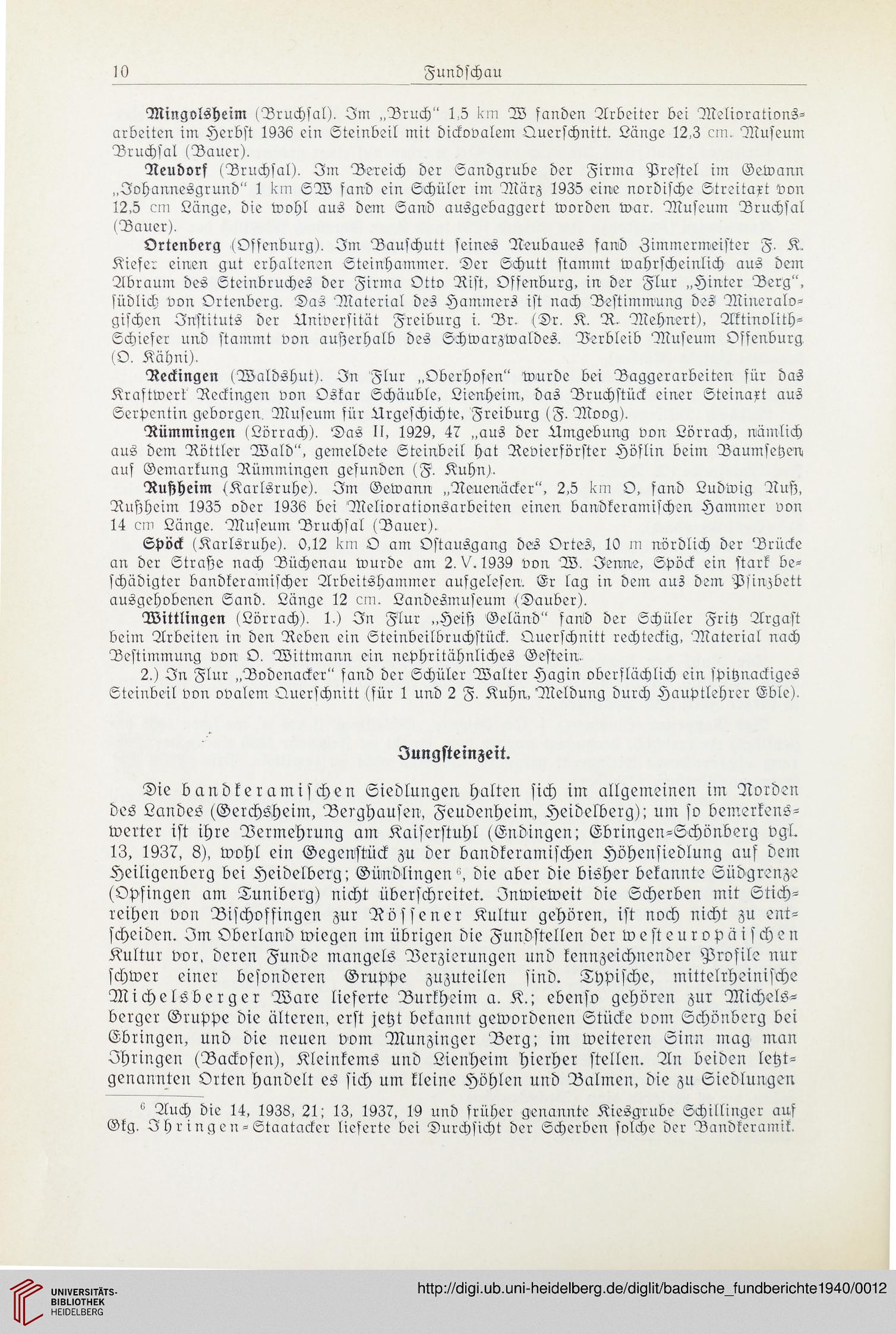10
Fundschau
Mingvlsheim (Bruchsal). Im „Bruch" 1,5 I<m W fanden Arbeiter bei Meliorations-
arbeiten im Herbst 1936 ein Steinbeil mit dickovalem Querschnitt. Länge 12,3 cm. Museum
Bruchsal (Dauer).
Neudorf (Bruchsal). Im Bereich der Sandgrube der Firma Prestel im Gewann
„Iohannesgrund" 1 bm SW fand ein Schüler im März 1935 eine nordische Streitaxt von
12,5 cm Länge, die Wohl aus dem Sand ausgebaggert worden war. Museum Bruchsal
(Bauer).
Ortenberg (Offenburg). Im Bauschutt seines Neubaues fand Zimmermeister F. K.
Kiefer einen gut erhaltenen Steinhammer. Der Schutt stammt wahrscheinlich aus dem
Abraum des Steinbruches der Firma Otto Rist, Offenburg, in der Flur „Hinter Berg",
südlich von Ortenberg. Das Material des Hammers ist nach Bestimmung des Mineralo-
gischen Instituts der Universität Freiburg i. Br.. (Dr. K. R. Mehnert), Aktinolith-
Schiefer und stammt von außerhalb des Schwarzwaldes. Verbleib Museum Offenburg
(O. Kähni).
Reckingen (Waldshut). In Flur „Oberhofen" wurde bei Baggerarbeiten für das
Kraftwert Reckingen von Oskar Schäuble, Lienheim, das Bruchstück einer Steinaxt aus
Serpentin geborgen. Museum für Urgeschichte, Freiburg (F. Moog).
Rümmingen (Lörrach). Das II, 1929, 47 „aus der Umgebung von Lörrach, nämlich
aus dem Rüttler Wald", gemeldete Steinbeil hat Revierförster Höflin beim Baumsehen
auf Gemarkung Rümmingen gefunden (F. Kuhn).
Rußheim (Karlsruhe). Im Gewann „Reuenäcker", 2,5 Irin O, fand Ludwig Ruh,
Ruhheim 1935 oder 1936 bei Meliorationsarbeiten einen bandkeramischen Hammer von
14 cm Länge. Museum Bruchsal (Bauer).
Spöck (Karlsruhe). 0,12 Irin O am Ostausgang des Ortes, 10 m nördlich der Brücke
an der Strahe nach Büchenau wurde am 2. V. 1939 von W. Ienne, Spöck ein stark be-
schädigter bandkeramischer Arbeitshammer aufgelesen. Er lag in dem aus dem Pfinzbett
ausgehobenen Sand. Länge 12 cm. Ländesmuseum (Dauber).
Wittlingen (Lörrach). 1.) In Flur „Heiß Geländ" fand der Schüler Fritz Argast
beim Arbeiten in den Reben ein Steinbeilbruchstück. Querschnitt rechteckig, Material nach
Bestimmung von O. Wittmann ein nephritähnliches Gestein.
2.) In Flur „Bodenacker" fand der Schüler Walter Hagin oberflächlich ein spitznackiges
Steinbeil von ovalem Querschnitt (für 1 und 2 F. Kuhn, Meldung durch Hauptlehrer Eble).
Jungsteinzeit.
Die bandkeramischen Siedlungen halten sich im allgemeinen im Norden
des Landes (Gerchsheim, Berghausen, Feudenheim, Heidelberg); um so bemerkens-
werter ist ihre Vermehrung am Kaiserstuhl (Cnstingen; Ebringen-Schönberg vgl.
13, 1937, 8), Wohl ein Gegenstück zu der bandkeramischen Höhensiedlung auf dem
Heiligenberg bei Heidelberg; Günstlingen st die aber die bisher bekannte Südgrenze
(Opfingen am Tuniberg) nicht überschreitet. Inwieweit die Scherben mit Stich-
reihen von Bischoffingen zur Rös feuer Kultur gehören, ist noch nicht zu ent-
scheiden. Im Oberland wiegen im übrigen die Fundstellen der w e st e u r o P ä i s ch e n
Kultur vor, deren Funde mangels Verzierungen und kennzeichnender Profile nur
schwer einer besonderen Gruppe zuzuteilen sind. Typische, mittelrheinische
Michelsberger Ware lieferte Burkheim a. K.; ebenso gehören zur Michels-
berger Gruppe die älteren, erst jetzt bekannt gewordenen Stücke vom Schönberg bei
Ebringen, und die neuen vom Munzinger Berg; im weiteren Sinn mag man
Ihringen (Backofen), Kleinkems und Lienheim hierher stellen. An beiden letzt-
genannten Orten handelt es sich um kleine Höhlen und Balmen, die zu Siedlungen
0 Auch die 14, 1938, 21; 13, 1937, 19 und früher genannte Kiesgrube Schillinger auf
Gkg. I h r i n g e u - Staatacker lieferte bei Durchsicht der Scherben solche der Bandkeramik.
Fundschau
Mingvlsheim (Bruchsal). Im „Bruch" 1,5 I<m W fanden Arbeiter bei Meliorations-
arbeiten im Herbst 1936 ein Steinbeil mit dickovalem Querschnitt. Länge 12,3 cm. Museum
Bruchsal (Dauer).
Neudorf (Bruchsal). Im Bereich der Sandgrube der Firma Prestel im Gewann
„Iohannesgrund" 1 bm SW fand ein Schüler im März 1935 eine nordische Streitaxt von
12,5 cm Länge, die Wohl aus dem Sand ausgebaggert worden war. Museum Bruchsal
(Bauer).
Ortenberg (Offenburg). Im Bauschutt seines Neubaues fand Zimmermeister F. K.
Kiefer einen gut erhaltenen Steinhammer. Der Schutt stammt wahrscheinlich aus dem
Abraum des Steinbruches der Firma Otto Rist, Offenburg, in der Flur „Hinter Berg",
südlich von Ortenberg. Das Material des Hammers ist nach Bestimmung des Mineralo-
gischen Instituts der Universität Freiburg i. Br.. (Dr. K. R. Mehnert), Aktinolith-
Schiefer und stammt von außerhalb des Schwarzwaldes. Verbleib Museum Offenburg
(O. Kähni).
Reckingen (Waldshut). In Flur „Oberhofen" wurde bei Baggerarbeiten für das
Kraftwert Reckingen von Oskar Schäuble, Lienheim, das Bruchstück einer Steinaxt aus
Serpentin geborgen. Museum für Urgeschichte, Freiburg (F. Moog).
Rümmingen (Lörrach). Das II, 1929, 47 „aus der Umgebung von Lörrach, nämlich
aus dem Rüttler Wald", gemeldete Steinbeil hat Revierförster Höflin beim Baumsehen
auf Gemarkung Rümmingen gefunden (F. Kuhn).
Rußheim (Karlsruhe). Im Gewann „Reuenäcker", 2,5 Irin O, fand Ludwig Ruh,
Ruhheim 1935 oder 1936 bei Meliorationsarbeiten einen bandkeramischen Hammer von
14 cm Länge. Museum Bruchsal (Bauer).
Spöck (Karlsruhe). 0,12 Irin O am Ostausgang des Ortes, 10 m nördlich der Brücke
an der Strahe nach Büchenau wurde am 2. V. 1939 von W. Ienne, Spöck ein stark be-
schädigter bandkeramischer Arbeitshammer aufgelesen. Er lag in dem aus dem Pfinzbett
ausgehobenen Sand. Länge 12 cm. Ländesmuseum (Dauber).
Wittlingen (Lörrach). 1.) In Flur „Heiß Geländ" fand der Schüler Fritz Argast
beim Arbeiten in den Reben ein Steinbeilbruchstück. Querschnitt rechteckig, Material nach
Bestimmung von O. Wittmann ein nephritähnliches Gestein.
2.) In Flur „Bodenacker" fand der Schüler Walter Hagin oberflächlich ein spitznackiges
Steinbeil von ovalem Querschnitt (für 1 und 2 F. Kuhn, Meldung durch Hauptlehrer Eble).
Jungsteinzeit.
Die bandkeramischen Siedlungen halten sich im allgemeinen im Norden
des Landes (Gerchsheim, Berghausen, Feudenheim, Heidelberg); um so bemerkens-
werter ist ihre Vermehrung am Kaiserstuhl (Cnstingen; Ebringen-Schönberg vgl.
13, 1937, 8), Wohl ein Gegenstück zu der bandkeramischen Höhensiedlung auf dem
Heiligenberg bei Heidelberg; Günstlingen st die aber die bisher bekannte Südgrenze
(Opfingen am Tuniberg) nicht überschreitet. Inwieweit die Scherben mit Stich-
reihen von Bischoffingen zur Rös feuer Kultur gehören, ist noch nicht zu ent-
scheiden. Im Oberland wiegen im übrigen die Fundstellen der w e st e u r o P ä i s ch e n
Kultur vor, deren Funde mangels Verzierungen und kennzeichnender Profile nur
schwer einer besonderen Gruppe zuzuteilen sind. Typische, mittelrheinische
Michelsberger Ware lieferte Burkheim a. K.; ebenso gehören zur Michels-
berger Gruppe die älteren, erst jetzt bekannt gewordenen Stücke vom Schönberg bei
Ebringen, und die neuen vom Munzinger Berg; im weiteren Sinn mag man
Ihringen (Backofen), Kleinkems und Lienheim hierher stellen. An beiden letzt-
genannten Orten handelt es sich um kleine Höhlen und Balmen, die zu Siedlungen
0 Auch die 14, 1938, 21; 13, 1937, 19 und früher genannte Kiesgrube Schillinger auf
Gkg. I h r i n g e u - Staatacker lieferte bei Durchsicht der Scherben solche der Bandkeramik.