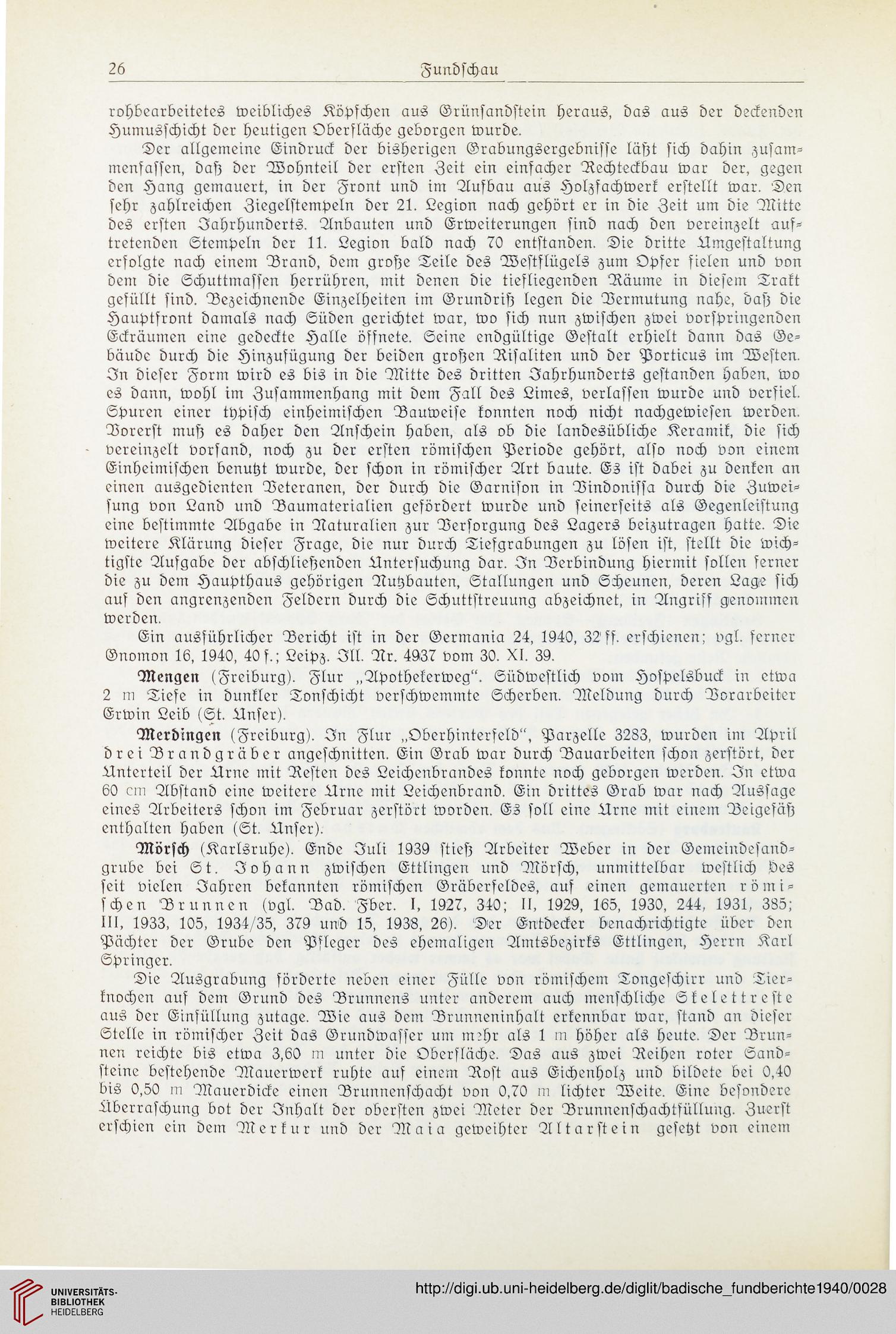26
Funöschau
rohbearbeitetes weibliches Köpfchen aus Grünsandstein heraus, das aus der deckenden
Humusschicht der heutigen Oberfläche geborgen wurde.
Der allgemeine Eindruck der bisherigen Grabungsergebnisse läßt sich dahin zusam-
menfassen, daß der Wohnteil der ersten Zeit ein einfacher Rechteckbau war der, gegen
den Hang gemauert, in der Front und im Aufbau aus Holzfachwerk erstellt war. Den
sehr zahlreichen Ziegelstempeln der 21. Legion nach gehört er in die Zeit um die Mitte
des ersten Jahrhunderts. Anbauten und Erweiterungen sind nach den vereinzelt auf-
tretenden Stempeln der 11. Legion bald nach 70 entstanden. Die dritte Umgestaltung
erfolgte nach einem Brand, dem große Teile des Westflügels zum Opfer fielen und von
dem die Schuttmassen herrühren, mit denen die tiefliegenden Räume in diesem Trakt
gefüllt sind. Bezeichnende Einzelheiten im Grundriß legen die Vermutung nahe, daß die
Hauptfront damals nach Süden gerichtet war, wo sich nun zwischen zwei vorspringenden
Eckräumen eine gedeckte Halle öffnete. Seine endgültige Gestalt erhielt dann das Ge-
bäude durch die Hinzufügung der beiden großen Risaliten und der Porticus im Westen.
In dieser Form wird es bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts gestanden haben, wo
es dann, Wohl im Zusammenhang mit dem Fall des Limes, verlassen wurde und verfiel.
Spuren einer typisch einheimischen Bauweise konnten noch nicht nachgewiesen werden.
Vorerst muß es daher den Anschein haben, als ob die landesübliche Keramik, die sich
vereinzelt vorsand, noch zu der ersten römischen Periode gehört, also noch von einem
Einheimischen benutzt wurde, der schon in römischer Art baute. Es ist dabei zu denken an
einen ausgedienten Veteranen, der durch die Garnison in Vindonissa durch die Zuwei-
sung von Land und Baumaterialien gefördert wurde und seinerseits als Gegenleistung
eine bestimmte Abgabe in Naturalien zur Versorgung des Lagers beizutragen hatte. Die
weitere Klärung dieser Frage, die nur durch Tiefgrabungen zu lösen ist, stellt die wich-
tigste Aufgabe der abschließenden Untersuchung dar. In Verbindung hierinit sollen ferner
die zu dem Haupthaus gehörigen Rutzbauten, Stallungen und Scheunen, deren Lage sich
auf den angrenzenden Feldern durch die Schuttstreuung abzeichnet, in Angriff genommen
werden.
Ein ausführlicher Bericht ist in der Germania 24, 1940, 32 ff. erschienen; vgl. ferner
Gnomon 16, 1940, 40 s.; Leipz. Jll. Nr. 4937 vom 30. XI. 39.
Mengen (Freiburg). Flur „Apothekerweg". Südwestlich vom Hospelsbuck in etwa
2 m Tiefe in dunkler Tonschicht verschwemmte Scherben. Meldung durch Vorarbeiter
Erwin Leib (St. Anser).
Merdingen (Freiburg). In Flur „Oberhinterfeld", Parzelle 3283, wurden im April
drei Brandgräber angeschnitten. Ein Grab war durch Bauarbeiten schon zerstört, der
Unterteil der Arne mit Resten des Leichenbrandes konnte noch geborgen werden. In etwa
60 em Abstand eine weitere Arne mit Leichenbrand. Ein drittes Grab war nach Aussage
eines Arbeiters schon im Februar zerstört worden. Es soll eine Arne mit einem Beigefäß
enthalten haben (St. Anfer).
Morsch (Karlsruhe). Ende Juli 1939 stieß Arbeiter Weber in der Gemeindesand-
grube bei St. Johann zwischen Ettlingen und Mörsch, unmittelbar westlich hes
seit vielen Jahren bekannten römischen Gräberfeldes, auf einen gemauerten römi-
schen Brunnen (vgl. Bad. Fber. I, 1927, 340; II, 1929, 165, 1930, 244, 1931, 385;
III, 1933, 105, 1934/35, 379 und 15, 1938, 26). Der Entdecker benachrichtigte über den
Pächter der Grube den Pfleger des ehemaligen Amtsbezirks Ettlingen, Herrn Karl
Springer.
Die Ausgrabung förderte neben einer Fülle von römischem Tongeschirr und Tier-
knochen auf dem Grund des Brunnens unter anderem auch menschliche Skelettreste
aus der Einfüllung zutage. Wie aus dem Brunneninhalt erkennbar war, stand an dieser
Stelle in römischer Zeit das Grundwasser um mehr als 1 m höher als heute. Der Brun-
nen reichte bis etwa 3,60 m unter die Oberfläche. Das aus zwei Reihen roter Sand-
steine bestehende Mauerwerk ruhte auf einem Rost aus Eichenholz und bildete bei 0,40
bis 0,50 m Mauerdicke einen Brunnenschacht von 0,70 in lichter Weite. Eine besondere
Überraschung bot der Inhalt der obersten zwei Meter der Brunnenschachtfüllung. Zuerst
erschien ein dem Merkur und der Maia geweihter Altarstein gesetzt von einem
Funöschau
rohbearbeitetes weibliches Köpfchen aus Grünsandstein heraus, das aus der deckenden
Humusschicht der heutigen Oberfläche geborgen wurde.
Der allgemeine Eindruck der bisherigen Grabungsergebnisse läßt sich dahin zusam-
menfassen, daß der Wohnteil der ersten Zeit ein einfacher Rechteckbau war der, gegen
den Hang gemauert, in der Front und im Aufbau aus Holzfachwerk erstellt war. Den
sehr zahlreichen Ziegelstempeln der 21. Legion nach gehört er in die Zeit um die Mitte
des ersten Jahrhunderts. Anbauten und Erweiterungen sind nach den vereinzelt auf-
tretenden Stempeln der 11. Legion bald nach 70 entstanden. Die dritte Umgestaltung
erfolgte nach einem Brand, dem große Teile des Westflügels zum Opfer fielen und von
dem die Schuttmassen herrühren, mit denen die tiefliegenden Räume in diesem Trakt
gefüllt sind. Bezeichnende Einzelheiten im Grundriß legen die Vermutung nahe, daß die
Hauptfront damals nach Süden gerichtet war, wo sich nun zwischen zwei vorspringenden
Eckräumen eine gedeckte Halle öffnete. Seine endgültige Gestalt erhielt dann das Ge-
bäude durch die Hinzufügung der beiden großen Risaliten und der Porticus im Westen.
In dieser Form wird es bis in die Mitte des dritten Jahrhunderts gestanden haben, wo
es dann, Wohl im Zusammenhang mit dem Fall des Limes, verlassen wurde und verfiel.
Spuren einer typisch einheimischen Bauweise konnten noch nicht nachgewiesen werden.
Vorerst muß es daher den Anschein haben, als ob die landesübliche Keramik, die sich
vereinzelt vorsand, noch zu der ersten römischen Periode gehört, also noch von einem
Einheimischen benutzt wurde, der schon in römischer Art baute. Es ist dabei zu denken an
einen ausgedienten Veteranen, der durch die Garnison in Vindonissa durch die Zuwei-
sung von Land und Baumaterialien gefördert wurde und seinerseits als Gegenleistung
eine bestimmte Abgabe in Naturalien zur Versorgung des Lagers beizutragen hatte. Die
weitere Klärung dieser Frage, die nur durch Tiefgrabungen zu lösen ist, stellt die wich-
tigste Aufgabe der abschließenden Untersuchung dar. In Verbindung hierinit sollen ferner
die zu dem Haupthaus gehörigen Rutzbauten, Stallungen und Scheunen, deren Lage sich
auf den angrenzenden Feldern durch die Schuttstreuung abzeichnet, in Angriff genommen
werden.
Ein ausführlicher Bericht ist in der Germania 24, 1940, 32 ff. erschienen; vgl. ferner
Gnomon 16, 1940, 40 s.; Leipz. Jll. Nr. 4937 vom 30. XI. 39.
Mengen (Freiburg). Flur „Apothekerweg". Südwestlich vom Hospelsbuck in etwa
2 m Tiefe in dunkler Tonschicht verschwemmte Scherben. Meldung durch Vorarbeiter
Erwin Leib (St. Anser).
Merdingen (Freiburg). In Flur „Oberhinterfeld", Parzelle 3283, wurden im April
drei Brandgräber angeschnitten. Ein Grab war durch Bauarbeiten schon zerstört, der
Unterteil der Arne mit Resten des Leichenbrandes konnte noch geborgen werden. In etwa
60 em Abstand eine weitere Arne mit Leichenbrand. Ein drittes Grab war nach Aussage
eines Arbeiters schon im Februar zerstört worden. Es soll eine Arne mit einem Beigefäß
enthalten haben (St. Anfer).
Morsch (Karlsruhe). Ende Juli 1939 stieß Arbeiter Weber in der Gemeindesand-
grube bei St. Johann zwischen Ettlingen und Mörsch, unmittelbar westlich hes
seit vielen Jahren bekannten römischen Gräberfeldes, auf einen gemauerten römi-
schen Brunnen (vgl. Bad. Fber. I, 1927, 340; II, 1929, 165, 1930, 244, 1931, 385;
III, 1933, 105, 1934/35, 379 und 15, 1938, 26). Der Entdecker benachrichtigte über den
Pächter der Grube den Pfleger des ehemaligen Amtsbezirks Ettlingen, Herrn Karl
Springer.
Die Ausgrabung förderte neben einer Fülle von römischem Tongeschirr und Tier-
knochen auf dem Grund des Brunnens unter anderem auch menschliche Skelettreste
aus der Einfüllung zutage. Wie aus dem Brunneninhalt erkennbar war, stand an dieser
Stelle in römischer Zeit das Grundwasser um mehr als 1 m höher als heute. Der Brun-
nen reichte bis etwa 3,60 m unter die Oberfläche. Das aus zwei Reihen roter Sand-
steine bestehende Mauerwerk ruhte auf einem Rost aus Eichenholz und bildete bei 0,40
bis 0,50 m Mauerdicke einen Brunnenschacht von 0,70 in lichter Weite. Eine besondere
Überraschung bot der Inhalt der obersten zwei Meter der Brunnenschachtfüllung. Zuerst
erschien ein dem Merkur und der Maia geweihter Altarstein gesetzt von einem