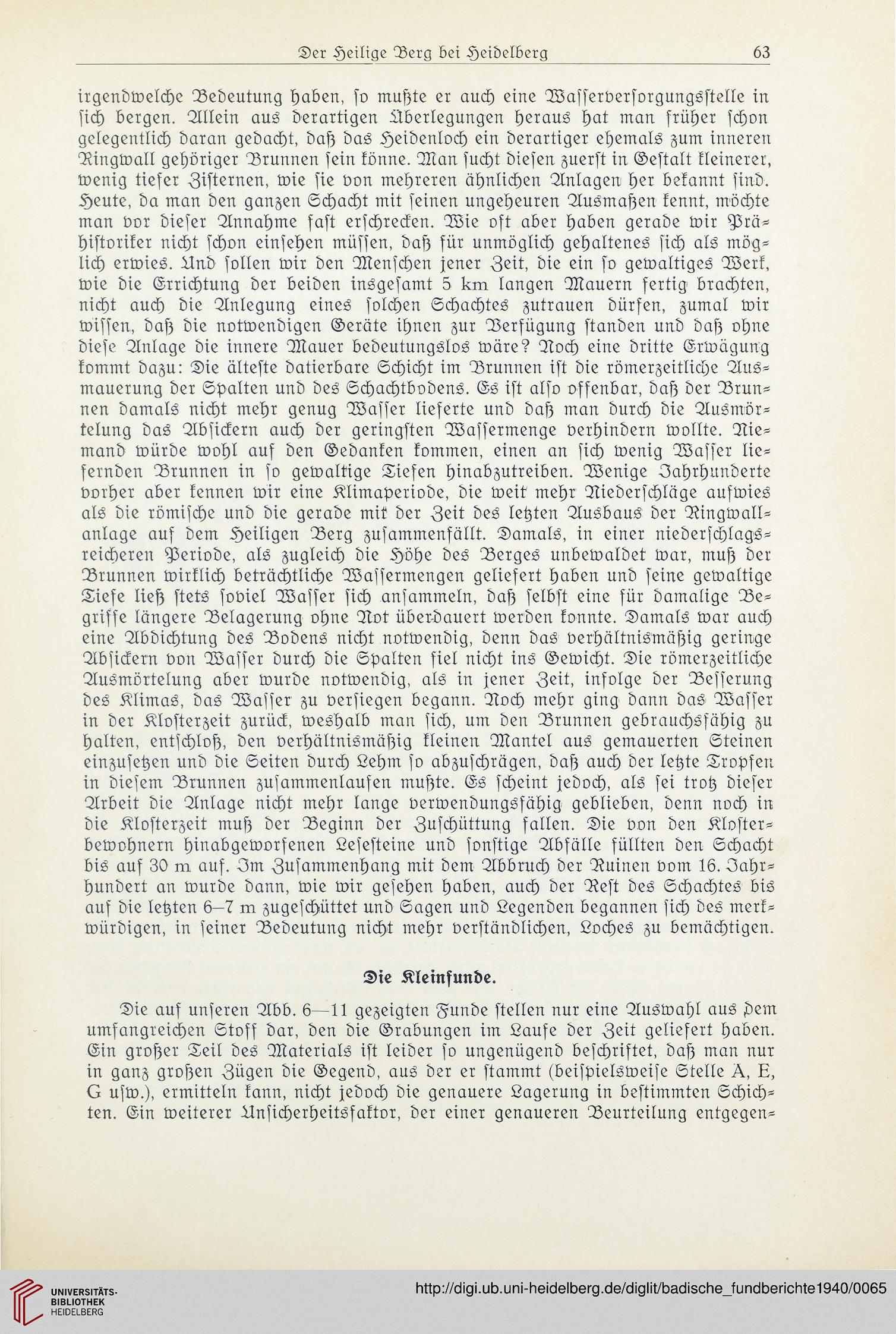Der Heilige Berg bei Heidelberg
63
irgendwelche Bedeutung haben, so muhte er auch eine Wasserversorgungsstelle in
sich bergen. Allein aus derartigen Äberlegungen heraus hat man srüher schon
gelegentlich daran gedacht, dah das Heidenloch ein derartiger ehemals zum inneren
Ringwall gehöriger Brunnen sein könne. Man sucht diesen zuerst in Gestalt kleinerer,
wenig tieser Zisternen, wie sie von mehreren ähnlichen Anlagen her bekannt sind.
Heute, da man den ganzen Schacht mit seinen ungeheuren Ausmaßen kennt, möchte
man vor dieser Annahme fast erschrecken. Wie oft aber haben gerade wir Prä-
historiker nicht schon einsehen müssen, dah für unmöglich gehaltenes sich als mög-
lich erwies. And sollen wir den Menschen jener Zeit, die ein so gewaltiges Werk,
wie die Errichtung der beiden insgesamt 5 Irra langen Mauern fertig brachten,
nicht auch die Anlegung eines solchen Schachtes zutrauen dürfen, zumal wir
wissen, dah die notwendigen Geräte ihnen zur Verfügung standen und dah ohne
diese Anlage die innere Mauer bedeutungslos wäre? Roch eine dritte Erwägung
kommt dazu: Die älteste datierbare Schicht im Brunnen ist die römerzeitliche Aus-
mauerung der Spalten und des Schachtbodens. Cs ist also offenbar, dah der Brun-
nen damals nicht mehr genug Wasser lieferte und dah man durch die Ausmör-
telung das Absickern auch der geringsten Wassermenge verhindern wollte. Nie-
mand würde Wohl aus den Gedanken kommen, einen an sich wenig Wasser lie-
fernden Brunnen in so gewaltige Tiefen hinabzutreiben. Wenige Jahrhunderte
vorher aber kennen wir eine Klimaperiode, die weit mehr Niederschläge aufwies
als die römische und die gerade mit der Zeit des letzten Ausbaus der Ringwall-
anlage auf dem Heiligen Berg zusammenfällt. Damals, in einer niederschlags-
reicheren Periode, als zugleich die Höhe des Berges unbewaldet war, muh der
Brunnen wirklich beträchtliche Wassermengen geliefert haben und seine gewaltige
Tiefe lieh stets soviel Wasser sich ansammeln, dah selbst eine für damalige Be-
griffe längere Belagerung ohne Not überdauert werden konnte. Damals war auch
eine Abdichtung des Bodens nicht notwendig, denn das verhältnismäßig geringe
Absickern von Wasser durch die Spalten fiel nicht ins Gewicht. Die römerzeitliche
Ausmörtelung aber wurde notwendig, als in jener Zeit, infolge der Besserung
des Klimas, das Wasser zu versiegen begann. Noch mehr ging dann das Wasser
in der Klosterzeit zurück, weshalb man sich, um den Brunnen gebrauchsfähig zu
halten, entschloß, den verhältnismäßig kleinen Mantel aus gemauerten Steinen
einzusetzen und die Seiten durch Lehm so abzuschrägen, dah auch der letzte Tropfen
in diesem Brunnen zusammenlausen muhte. Es scheint jedoch, als sei trotz dieser
Arbeit die Anlage nicht mehr lange verwendungsfähig geblieben, denn noch in
die Klosterzeit muh der Beginn der Zuschüttung fallen. Die von den Kloster-
bewohnern hinabgeworsenen Lesesteine und sonstige Abfälle füllten den Schacht
bis auf 30 na auf. Im Zusammenhang mit dem Abbruch der Ruinen vom 16. Jahr-
hundert an wurde dann, wie wir gesehen haben, auch der Rest des Schachtes bis
aus die letzten 6—7 in zugeschüttet und Sagen und Legenden begannen sich des merk-
würdigen, in seiner Bedeutung nicht mehr verständlichen, Loches zu bemächtigen.
Die Kleinfunde.
Die auf unseren Abb. 6—11 gezeigten Funde stellen nur eine Auswahl aus hem
umfangreichen Stoff dar, den die Grabungen im Laufe der Zeit geliefert haben.
Ein großer Teil des Materials ist leider so ungenügend beschriftet, dah man nur
in ganz großen Zügen die Gegend, aus der er stammt (beispielsweise Stelle A., Z,
6 usw.), ermitteln kann, nicht jedoch die genauere Lagerung in bestimmten Schich-
ten. Ein weiterer Ansicherheitsfaktor, der einer genaueren Beurteilung entgegen-
63
irgendwelche Bedeutung haben, so muhte er auch eine Wasserversorgungsstelle in
sich bergen. Allein aus derartigen Äberlegungen heraus hat man srüher schon
gelegentlich daran gedacht, dah das Heidenloch ein derartiger ehemals zum inneren
Ringwall gehöriger Brunnen sein könne. Man sucht diesen zuerst in Gestalt kleinerer,
wenig tieser Zisternen, wie sie von mehreren ähnlichen Anlagen her bekannt sind.
Heute, da man den ganzen Schacht mit seinen ungeheuren Ausmaßen kennt, möchte
man vor dieser Annahme fast erschrecken. Wie oft aber haben gerade wir Prä-
historiker nicht schon einsehen müssen, dah für unmöglich gehaltenes sich als mög-
lich erwies. And sollen wir den Menschen jener Zeit, die ein so gewaltiges Werk,
wie die Errichtung der beiden insgesamt 5 Irra langen Mauern fertig brachten,
nicht auch die Anlegung eines solchen Schachtes zutrauen dürfen, zumal wir
wissen, dah die notwendigen Geräte ihnen zur Verfügung standen und dah ohne
diese Anlage die innere Mauer bedeutungslos wäre? Roch eine dritte Erwägung
kommt dazu: Die älteste datierbare Schicht im Brunnen ist die römerzeitliche Aus-
mauerung der Spalten und des Schachtbodens. Cs ist also offenbar, dah der Brun-
nen damals nicht mehr genug Wasser lieferte und dah man durch die Ausmör-
telung das Absickern auch der geringsten Wassermenge verhindern wollte. Nie-
mand würde Wohl aus den Gedanken kommen, einen an sich wenig Wasser lie-
fernden Brunnen in so gewaltige Tiefen hinabzutreiben. Wenige Jahrhunderte
vorher aber kennen wir eine Klimaperiode, die weit mehr Niederschläge aufwies
als die römische und die gerade mit der Zeit des letzten Ausbaus der Ringwall-
anlage auf dem Heiligen Berg zusammenfällt. Damals, in einer niederschlags-
reicheren Periode, als zugleich die Höhe des Berges unbewaldet war, muh der
Brunnen wirklich beträchtliche Wassermengen geliefert haben und seine gewaltige
Tiefe lieh stets soviel Wasser sich ansammeln, dah selbst eine für damalige Be-
griffe längere Belagerung ohne Not überdauert werden konnte. Damals war auch
eine Abdichtung des Bodens nicht notwendig, denn das verhältnismäßig geringe
Absickern von Wasser durch die Spalten fiel nicht ins Gewicht. Die römerzeitliche
Ausmörtelung aber wurde notwendig, als in jener Zeit, infolge der Besserung
des Klimas, das Wasser zu versiegen begann. Noch mehr ging dann das Wasser
in der Klosterzeit zurück, weshalb man sich, um den Brunnen gebrauchsfähig zu
halten, entschloß, den verhältnismäßig kleinen Mantel aus gemauerten Steinen
einzusetzen und die Seiten durch Lehm so abzuschrägen, dah auch der letzte Tropfen
in diesem Brunnen zusammenlausen muhte. Es scheint jedoch, als sei trotz dieser
Arbeit die Anlage nicht mehr lange verwendungsfähig geblieben, denn noch in
die Klosterzeit muh der Beginn der Zuschüttung fallen. Die von den Kloster-
bewohnern hinabgeworsenen Lesesteine und sonstige Abfälle füllten den Schacht
bis auf 30 na auf. Im Zusammenhang mit dem Abbruch der Ruinen vom 16. Jahr-
hundert an wurde dann, wie wir gesehen haben, auch der Rest des Schachtes bis
aus die letzten 6—7 in zugeschüttet und Sagen und Legenden begannen sich des merk-
würdigen, in seiner Bedeutung nicht mehr verständlichen, Loches zu bemächtigen.
Die Kleinfunde.
Die auf unseren Abb. 6—11 gezeigten Funde stellen nur eine Auswahl aus hem
umfangreichen Stoff dar, den die Grabungen im Laufe der Zeit geliefert haben.
Ein großer Teil des Materials ist leider so ungenügend beschriftet, dah man nur
in ganz großen Zügen die Gegend, aus der er stammt (beispielsweise Stelle A., Z,
6 usw.), ermitteln kann, nicht jedoch die genauere Lagerung in bestimmten Schich-
ten. Ein weiterer Ansicherheitsfaktor, der einer genaueren Beurteilung entgegen-