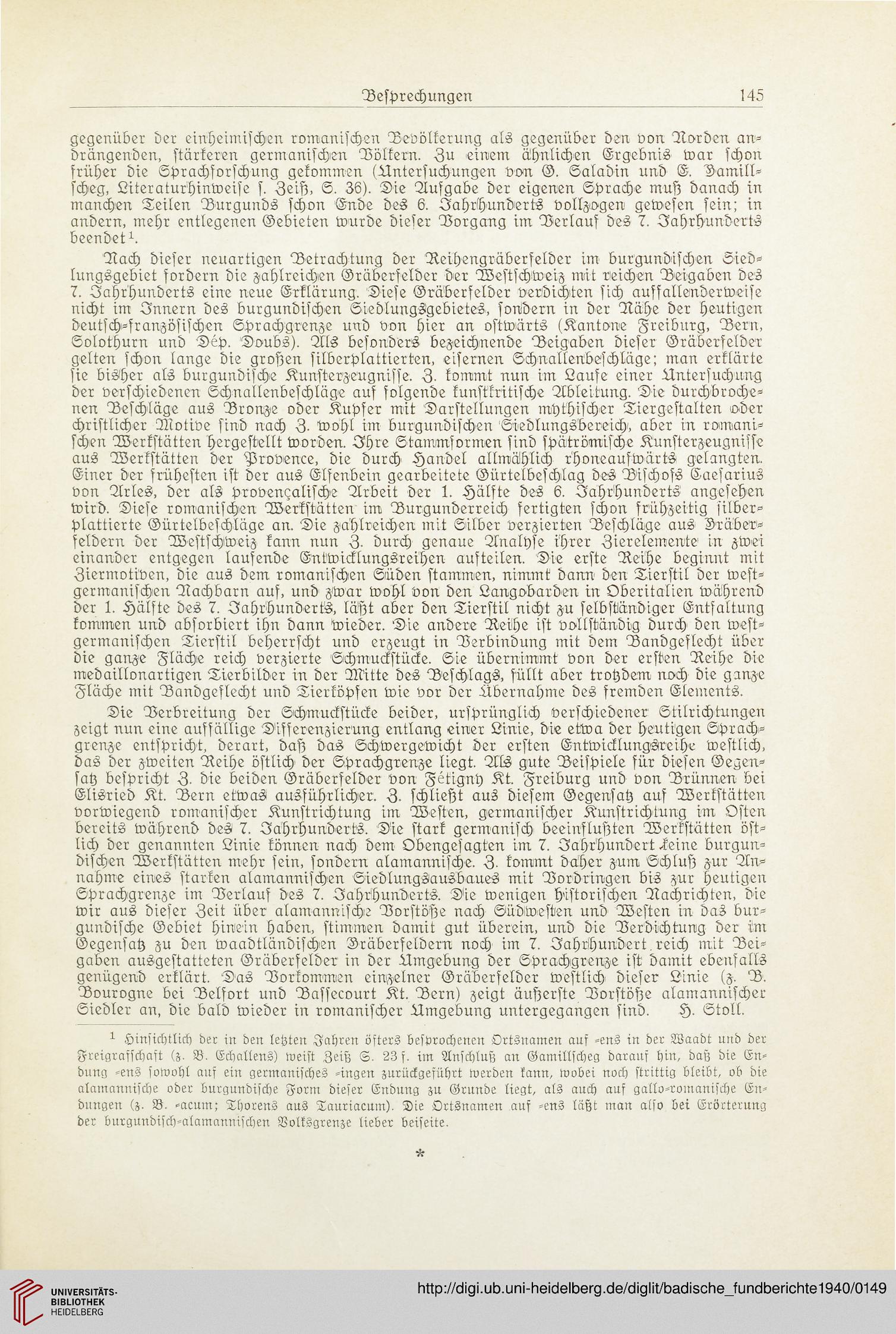Besprechungen
145
gegenüber der einheimischen romanischen Bevölkerung als gegenüber den von Borden an-
drängenden, stärkeren germanischen Völkern. Zu .einem ähnlichen Ergebnis war schon
früher die Sprachforschung gekommen (Untersuchungen von G. Saladin und E. G-amtll-
scheg, Literaturhinweise s. Zeih, S. L6). Die Aufgabe der eigenen Sprache muh danach in
manchen Teilen Burgunds schon Ende des 6. Jahrhunderts vollzogen gewesen sein; in
andern, mehr entlegenen Gebieten wurde dieser Vorgang im Verlauf des 7. Jahrhunderts
beendet
Bach dieser neuartigen Betrachtung der Beihengräberfelder im burgundischen Sied-
lungsgebiet fordern die zahlreichen Gräberfelder der Westschweiz mit reichen Beigaben des
7. Jahrhunderts eine neue Erklärung. Diese Gräberfelder verdichten sich auffallenderweise
nicht im Innern des burgundischen Siedlungsgebietes, sonidern in der Bähe der heutigen
deutsch-französischen Sprachgrenze und von hier an ostwärts (Kantone Freiburg, Bern,
Solothurn und Dep. Doubs). Als besonders bezeichnende Beigaben dieser Gräberfelder
gelten schon lange die grohen silberplattierten, eisernen Schnallenbeschläge; man erklärte
sie bisher als burgundische Kunsterzeugnisse. Z. kommt nun im Laufe einer Untersuchung
der verschiedenen Schnallenbeschläge auf folgende kunstkritische Ableitung. Die durchbroche-
nen Beschläge aus Bronze oder Kupfer mit Darstellungen mythischer Tiergestalten oder
christlicher Motive sind nach Z. Wohl im burgundischen 'Siedlungsbereich, aber in romani-
schen Werkstätten hergestellt worden. Ihre Stammformen sind spätrömische Kunsterzeugnisse
aus Werkstätten der Provence, die durch Handel allmählich rhoneaufwärts gelangten.
Einer der frühesten ist der aus Elfenbein gearbeitete Gürtelbeschlag des Bischofs Caesarius
von Arles, der als proven^alische Arbeit der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts angesehen
wird. Diese romanischen Werkstätten im Burgunderreich fertigten schon frühzeitig silber-
plattierte Gürtelbeschläge an. Die zahlreichen mit Silber verzierten Beschläge aus Gräber-
feldern der Westschweiz kann nun Z. durch genaue Analyse ihrer Zierelemente in zwei
einander entgegen laufende Ent'wicklungsreihen aufteilen. Die erste Reihe beginnt mit
Ziermotiven, die aus dem romanischen Süden stammen, nimmt dann den Tierstil der west-
germanischen Bachbarn auf, und zwar Wohl von den Langobarden in Oberitalien während
der 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts, läßt aber den Tierstil nicht zu selbständiger Entfaltung
kommen und absorbiert ihn dann wieder. Die andere Reihe ist vollständig durch den west-
germanischen Tierstil beherrscht und erzeugt in Verbindung mit dem Bandgeflecht über
die ganze Fläche reich verzierte Schmuckstücke. Sie übernimmt von der ersten Reihe die
medaillonartigen Tierbilder in der Mitte des Beschlags, füllt aber trotzdem noch die ganze
Fläche mit Bandgeflecht und Tierköpfen wie vor der Übernahme des fremden Elements.
Die Verbreitung der Schmuckstücke beider, ursprünglich verschiedener Stilrichtungen
zeigt nun eine auffällige Differenzierung entlang einer Linie, die etwa der heutigen Sprach-
grenze entspricht, derart, daß das Schwergewicht der ersten Entwicklungsreihe westlich,
das der zweiten Reihe östlich der Sprachgrenze liegt. Als gute Beispiele für diesen Gegen-
satz bespricht Z. die beiden Gräberfelder von Fetigny Kt. Freiburg und von Brünnen bei
Elisried Kt. Bern etwas ausführlicher. Z. schließt aus diesem Gegensatz auf Werkstätten
vorwiegend romanischer Kunstrichtung im Westen, germanischer Kunstrichtung im Osten
bereits während des 7. Jahrhunderts. Die stark germanisch beeinflußten Werkstätten öst-
lich der genannten Linie können nach dem Obengesagten im 7. Jahrhundert ckeine burgun-
dischen Werkstätten mehr sein, sondern alamannische. Z. kommt daher zum Schluß zur An-
nahme eines starken alamannischen Siedlungsausbaues mit Vordringen bis zur heutigen
Sprachgrenze im Verlauf des 7. Jahrhunderts. Die wenigen historischen Bachrichten, die
wir aus dieser Zeit über alamannische Vorstöße nach Südwesten und Westen in das bur-
gundische Gebiet hinein haben, stimmen damit gut überein, und die Verdichtung der im
Gegensatz zu den waadtländischen Gräberfeldern noch im 7. Jahrhundert weich mit Bei-
gaben ausgestatteten Gräberfelder in der Umgebung der Sprachgrenze ist damit ebenfalls
genügend erklärt. Das Vorkommen einzelner Gräberfelder westlich dieser Linie (z. B.
Bourogne bei Belfort und Bassecourt Kt. Bern) zeigt äußerste Vorstöße alamannischer
Siedler an, die bald wieder in romanischer Umgebung untergegangen sind. H. Stoll.
i Hinsichtlich der in den letzten Jahren öfters besprochenen Ortsnamen auf -ens in der Waadt und der
Freigrafschaft (z. B. Echallens) weist Zeiß S. 23 f. im Anschluß an Gamillscheg darauf hin, daß die En-
dung -ens sowohl auf ein germanisches -ingen zurückgeführt werden kann, wobei noch strittig bleibt, ob die
alamannische oder burgundische Form dieser Endung zu Grunde liegt, als auch auf gallo-romanische En-
dungen (z. B. -acum; Thorens aus Tauriaeum). Die Ortsnamen auf -ens läßt man also bei Erörterung
der burgundisch-alamannischen Bolksgrenze lieber beiseite.
145
gegenüber der einheimischen romanischen Bevölkerung als gegenüber den von Borden an-
drängenden, stärkeren germanischen Völkern. Zu .einem ähnlichen Ergebnis war schon
früher die Sprachforschung gekommen (Untersuchungen von G. Saladin und E. G-amtll-
scheg, Literaturhinweise s. Zeih, S. L6). Die Aufgabe der eigenen Sprache muh danach in
manchen Teilen Burgunds schon Ende des 6. Jahrhunderts vollzogen gewesen sein; in
andern, mehr entlegenen Gebieten wurde dieser Vorgang im Verlauf des 7. Jahrhunderts
beendet
Bach dieser neuartigen Betrachtung der Beihengräberfelder im burgundischen Sied-
lungsgebiet fordern die zahlreichen Gräberfelder der Westschweiz mit reichen Beigaben des
7. Jahrhunderts eine neue Erklärung. Diese Gräberfelder verdichten sich auffallenderweise
nicht im Innern des burgundischen Siedlungsgebietes, sonidern in der Bähe der heutigen
deutsch-französischen Sprachgrenze und von hier an ostwärts (Kantone Freiburg, Bern,
Solothurn und Dep. Doubs). Als besonders bezeichnende Beigaben dieser Gräberfelder
gelten schon lange die grohen silberplattierten, eisernen Schnallenbeschläge; man erklärte
sie bisher als burgundische Kunsterzeugnisse. Z. kommt nun im Laufe einer Untersuchung
der verschiedenen Schnallenbeschläge auf folgende kunstkritische Ableitung. Die durchbroche-
nen Beschläge aus Bronze oder Kupfer mit Darstellungen mythischer Tiergestalten oder
christlicher Motive sind nach Z. Wohl im burgundischen 'Siedlungsbereich, aber in romani-
schen Werkstätten hergestellt worden. Ihre Stammformen sind spätrömische Kunsterzeugnisse
aus Werkstätten der Provence, die durch Handel allmählich rhoneaufwärts gelangten.
Einer der frühesten ist der aus Elfenbein gearbeitete Gürtelbeschlag des Bischofs Caesarius
von Arles, der als proven^alische Arbeit der 1. Hälfte des 6. Jahrhunderts angesehen
wird. Diese romanischen Werkstätten im Burgunderreich fertigten schon frühzeitig silber-
plattierte Gürtelbeschläge an. Die zahlreichen mit Silber verzierten Beschläge aus Gräber-
feldern der Westschweiz kann nun Z. durch genaue Analyse ihrer Zierelemente in zwei
einander entgegen laufende Ent'wicklungsreihen aufteilen. Die erste Reihe beginnt mit
Ziermotiven, die aus dem romanischen Süden stammen, nimmt dann den Tierstil der west-
germanischen Bachbarn auf, und zwar Wohl von den Langobarden in Oberitalien während
der 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts, läßt aber den Tierstil nicht zu selbständiger Entfaltung
kommen und absorbiert ihn dann wieder. Die andere Reihe ist vollständig durch den west-
germanischen Tierstil beherrscht und erzeugt in Verbindung mit dem Bandgeflecht über
die ganze Fläche reich verzierte Schmuckstücke. Sie übernimmt von der ersten Reihe die
medaillonartigen Tierbilder in der Mitte des Beschlags, füllt aber trotzdem noch die ganze
Fläche mit Bandgeflecht und Tierköpfen wie vor der Übernahme des fremden Elements.
Die Verbreitung der Schmuckstücke beider, ursprünglich verschiedener Stilrichtungen
zeigt nun eine auffällige Differenzierung entlang einer Linie, die etwa der heutigen Sprach-
grenze entspricht, derart, daß das Schwergewicht der ersten Entwicklungsreihe westlich,
das der zweiten Reihe östlich der Sprachgrenze liegt. Als gute Beispiele für diesen Gegen-
satz bespricht Z. die beiden Gräberfelder von Fetigny Kt. Freiburg und von Brünnen bei
Elisried Kt. Bern etwas ausführlicher. Z. schließt aus diesem Gegensatz auf Werkstätten
vorwiegend romanischer Kunstrichtung im Westen, germanischer Kunstrichtung im Osten
bereits während des 7. Jahrhunderts. Die stark germanisch beeinflußten Werkstätten öst-
lich der genannten Linie können nach dem Obengesagten im 7. Jahrhundert ckeine burgun-
dischen Werkstätten mehr sein, sondern alamannische. Z. kommt daher zum Schluß zur An-
nahme eines starken alamannischen Siedlungsausbaues mit Vordringen bis zur heutigen
Sprachgrenze im Verlauf des 7. Jahrhunderts. Die wenigen historischen Bachrichten, die
wir aus dieser Zeit über alamannische Vorstöße nach Südwesten und Westen in das bur-
gundische Gebiet hinein haben, stimmen damit gut überein, und die Verdichtung der im
Gegensatz zu den waadtländischen Gräberfeldern noch im 7. Jahrhundert weich mit Bei-
gaben ausgestatteten Gräberfelder in der Umgebung der Sprachgrenze ist damit ebenfalls
genügend erklärt. Das Vorkommen einzelner Gräberfelder westlich dieser Linie (z. B.
Bourogne bei Belfort und Bassecourt Kt. Bern) zeigt äußerste Vorstöße alamannischer
Siedler an, die bald wieder in romanischer Umgebung untergegangen sind. H. Stoll.
i Hinsichtlich der in den letzten Jahren öfters besprochenen Ortsnamen auf -ens in der Waadt und der
Freigrafschaft (z. B. Echallens) weist Zeiß S. 23 f. im Anschluß an Gamillscheg darauf hin, daß die En-
dung -ens sowohl auf ein germanisches -ingen zurückgeführt werden kann, wobei noch strittig bleibt, ob die
alamannische oder burgundische Form dieser Endung zu Grunde liegt, als auch auf gallo-romanische En-
dungen (z. B. -acum; Thorens aus Tauriaeum). Die Ortsnamen auf -ens läßt man also bei Erörterung
der burgundisch-alamannischen Bolksgrenze lieber beiseite.