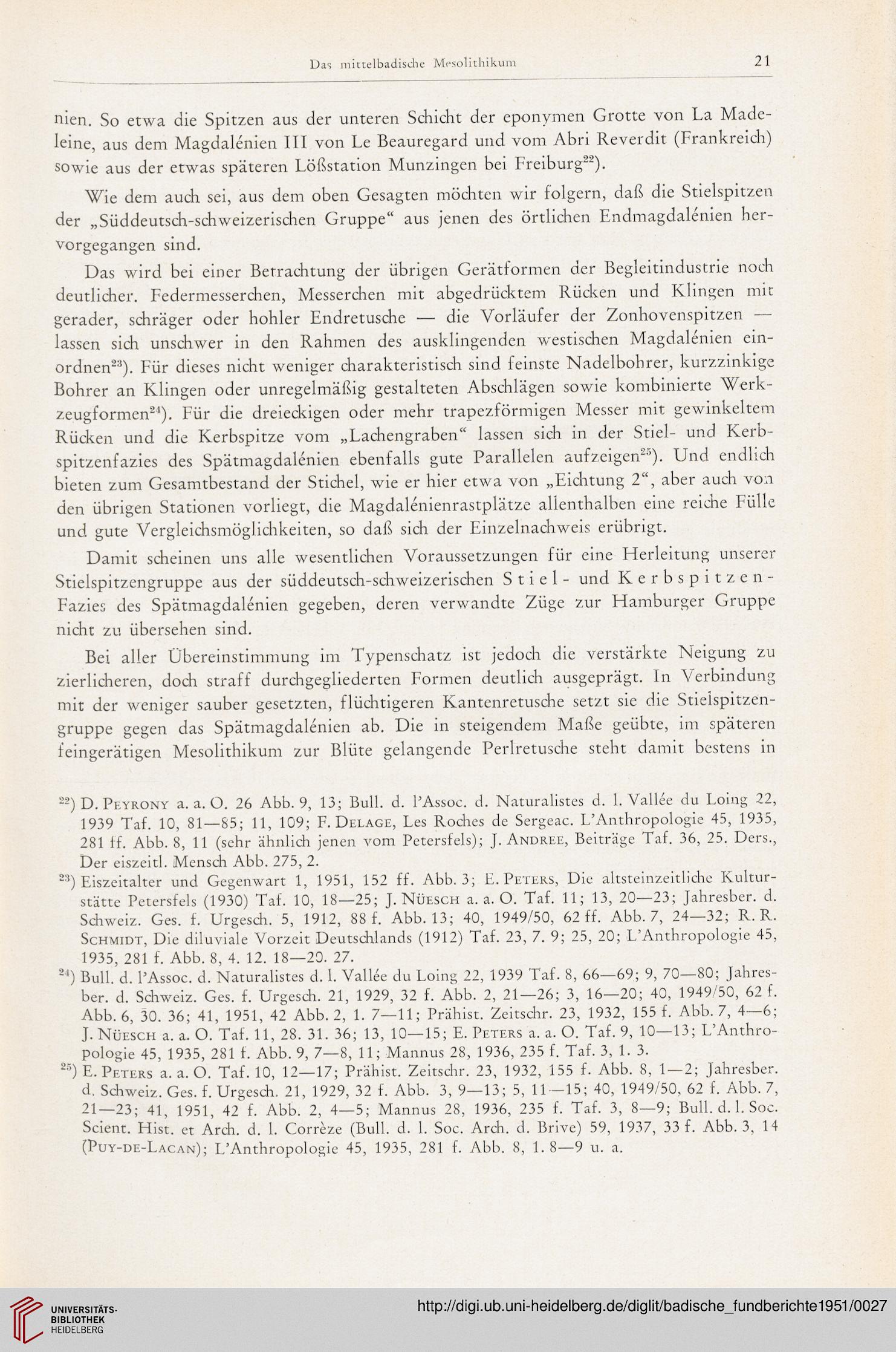Das mittelbadische Mesolithikum
21
nien. So etwa die Spitzen aus der unteren Schicht der eponymen Grotte von La Made-
leine, aus dem Magdalenien III von Le Beauregard und vom Abri Reverdit (Frankreich)
sowie aus der etwas späteren Lößstation Munzingen bei Freiburg22).
Wie dem auch sei, aus dem oben Gesagten möchten wir folgern, daß die Stielspitzen
der „Süddeutsch-schweizerischen Gruppe“ aus jenen des örtlichen Endmagdalenien her-
vorgegangen sind.
Das wird bei einer Betrachtung der übrigen Gerätformen der Begleitindustrie noch
deutlicher. Federmesserchen, Messerchen mit abgedrücktem Rücken und Klingen mir
gerader, schräger oder hohler Endretusche — die Vorläufer der Zonhovenspitzen —
lassen sich unschwer in den Rahmen des ausklingenden westischen Magdalenien ein-
ordnen23). Für dieses nicht weniger charakteristisch sind feinste Nadelbohrer, kurzzinkige
Bohrer an Klingen oder unregelmäßig gestalteten Abschlägen sowie kombinierte Werk-
zeugformen24). Für die dreieckigen oder mehr trapezförmigen Messer mit gewinkeltem
Rücken und die Kerbspitze vom „Lachengraben“ lassen sich in der Stiel- und Kerb-
spitzenfazies des Spätmagdalenien ebenfalls gute Parallelen auf zeigen2“). Und endlich
bieten zum Gesamtbestand der Stichel, wie er hier etwa von „Eichtung 2“, aber auch von
den übrigen Stationen vorliegt, die Magdalenienrastplätze allenthalben eine reiche Fülle
und gute Vergleichsmöglichkeiten, so daß sich der Einzelnachweis erübrigt.
Damit scheinen uns alle wesentlichen Voraussetzungen für eine Herleitung unserer
Stielspitzengruppe aus der süddeutsch-schweizerischen Stiel- und Kerbspitzen-
Fazies des Spätmagdalenien gegeben, deren verwandte Züge zur Hamburger Gruppe
nicht zu übersehen sind.
Bei aller Übereinstimmung im Typenschatz ist jedoch die verstärkte Neigung zu
zierlicheren, doch straff durchgegliederten Formen deutlich ausgeprägt. In Verbindung
mit der weniger sauber gesetzten, flüchtigeren Kantenretusche setzt sie die Stieispitzen-
gruppe gegen das Spätmagdalenien ab. Die in steigendem Maße geübte, im späteren
feingerätigen Mesolithikum zur Blüte gelangende Perlretusche steht damit bestens in
ä2) D. Peyrony a. a. O. 26 Abb. 9, 13; Bull. d. l’Assoc. d. Naturalistes d. 1. Vallee du Loing 22,
1939 Taf. 10, 81—85; 11, 109; F. Delage, Les Roches de Sergeac. L’Anthropologie 45, 1935,
281 ff. Abb. 8, 11 (sehr ähnlich jenen vom Petersfels); J. Andree, Beiträge Taf. 36, 25. Ders.,
Der eiszeitl. Mensch Abb. 275, 2.
23) Eiszeitalter und Gegenwart 1, 1951, 152 ff. Abb. 3; E. Peters, Die altsteinzeitliche Kultur-
stätte Petersfels (1930) Taf. 10, 18—25; J. Nüesch a. a. O. Taf. 11; 13, 20—23; Jahresber. d.
Schweiz. Ges. f. Urgesch. 5, 1912, 88 f. Abb. 13; 40, 1949/50, 62 ff. Abb. 7, 24—32; R. R.
Schmidt, Die diluviale Vorzeit Deutschlands (1912) Taf. 23, 7. 9; 25, 20; L’Anthropologie 45,
1935, 281 f. Abb. 8, 4. 12. 18—20. 27.
24) Bull. d. l’Assoc. d. Naturalistes d. 1. Vallee du Loing 22, 1939 Taf. 8, 66—69; 9, 70—80; Jahres-
ber. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 21, 1929, 32 f. Abb. 2, 21—26; 3, 16—20; 40, 1949/50, 62 f.
Abb. 6, 30. 36; 41, 1951, 42 Abb. 2, 1. 7—11; Prähist. Zeitschr. 23, 1932, 155 f. Abb. 7, 4—6;
J. Nüesch a. a. O. Taf. 11, 28. 31. 36; 13, 10—15; E. Peters a. a. O. Taf. 9, 10—13; L’Anthro-
pologie 45, 1935, 281 f. Abb. 9, 7—8, 11; Mannus 28, 1936, 235 f. Taf. 3, 1. 3.
2“) E. Peters a. a. O. Taf. 10, 12—17; Prähist. Zeitschr. 23, 1932, 155 f. Abb. 8, 1—2; Jahresber.
d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 21, 1929, 32 f. Abb. 3, 9—13; 5, 11—15; 40, 1949/50, 62 f. Abb. 7,
21—23; 41, 1951, 42 f. Abb. 2, 4—5; Mannus 28, 1936, 235 f. Taf. 3, 8—9; Bull. d. 1. Soc.
Scient. Hist, et Arch. d. 1. Correze (Bull. d. 1. Soc. Arch. d. Brive) 59, 1937, 33 f. Abb. 3, 14
(Puy-de-Lacan); L’Anthropologie 45, 1935, 281 f. Abb. 8, 1. 8—9 u. a.
21
nien. So etwa die Spitzen aus der unteren Schicht der eponymen Grotte von La Made-
leine, aus dem Magdalenien III von Le Beauregard und vom Abri Reverdit (Frankreich)
sowie aus der etwas späteren Lößstation Munzingen bei Freiburg22).
Wie dem auch sei, aus dem oben Gesagten möchten wir folgern, daß die Stielspitzen
der „Süddeutsch-schweizerischen Gruppe“ aus jenen des örtlichen Endmagdalenien her-
vorgegangen sind.
Das wird bei einer Betrachtung der übrigen Gerätformen der Begleitindustrie noch
deutlicher. Federmesserchen, Messerchen mit abgedrücktem Rücken und Klingen mir
gerader, schräger oder hohler Endretusche — die Vorläufer der Zonhovenspitzen —
lassen sich unschwer in den Rahmen des ausklingenden westischen Magdalenien ein-
ordnen23). Für dieses nicht weniger charakteristisch sind feinste Nadelbohrer, kurzzinkige
Bohrer an Klingen oder unregelmäßig gestalteten Abschlägen sowie kombinierte Werk-
zeugformen24). Für die dreieckigen oder mehr trapezförmigen Messer mit gewinkeltem
Rücken und die Kerbspitze vom „Lachengraben“ lassen sich in der Stiel- und Kerb-
spitzenfazies des Spätmagdalenien ebenfalls gute Parallelen auf zeigen2“). Und endlich
bieten zum Gesamtbestand der Stichel, wie er hier etwa von „Eichtung 2“, aber auch von
den übrigen Stationen vorliegt, die Magdalenienrastplätze allenthalben eine reiche Fülle
und gute Vergleichsmöglichkeiten, so daß sich der Einzelnachweis erübrigt.
Damit scheinen uns alle wesentlichen Voraussetzungen für eine Herleitung unserer
Stielspitzengruppe aus der süddeutsch-schweizerischen Stiel- und Kerbspitzen-
Fazies des Spätmagdalenien gegeben, deren verwandte Züge zur Hamburger Gruppe
nicht zu übersehen sind.
Bei aller Übereinstimmung im Typenschatz ist jedoch die verstärkte Neigung zu
zierlicheren, doch straff durchgegliederten Formen deutlich ausgeprägt. In Verbindung
mit der weniger sauber gesetzten, flüchtigeren Kantenretusche setzt sie die Stieispitzen-
gruppe gegen das Spätmagdalenien ab. Die in steigendem Maße geübte, im späteren
feingerätigen Mesolithikum zur Blüte gelangende Perlretusche steht damit bestens in
ä2) D. Peyrony a. a. O. 26 Abb. 9, 13; Bull. d. l’Assoc. d. Naturalistes d. 1. Vallee du Loing 22,
1939 Taf. 10, 81—85; 11, 109; F. Delage, Les Roches de Sergeac. L’Anthropologie 45, 1935,
281 ff. Abb. 8, 11 (sehr ähnlich jenen vom Petersfels); J. Andree, Beiträge Taf. 36, 25. Ders.,
Der eiszeitl. Mensch Abb. 275, 2.
23) Eiszeitalter und Gegenwart 1, 1951, 152 ff. Abb. 3; E. Peters, Die altsteinzeitliche Kultur-
stätte Petersfels (1930) Taf. 10, 18—25; J. Nüesch a. a. O. Taf. 11; 13, 20—23; Jahresber. d.
Schweiz. Ges. f. Urgesch. 5, 1912, 88 f. Abb. 13; 40, 1949/50, 62 ff. Abb. 7, 24—32; R. R.
Schmidt, Die diluviale Vorzeit Deutschlands (1912) Taf. 23, 7. 9; 25, 20; L’Anthropologie 45,
1935, 281 f. Abb. 8, 4. 12. 18—20. 27.
24) Bull. d. l’Assoc. d. Naturalistes d. 1. Vallee du Loing 22, 1939 Taf. 8, 66—69; 9, 70—80; Jahres-
ber. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 21, 1929, 32 f. Abb. 2, 21—26; 3, 16—20; 40, 1949/50, 62 f.
Abb. 6, 30. 36; 41, 1951, 42 Abb. 2, 1. 7—11; Prähist. Zeitschr. 23, 1932, 155 f. Abb. 7, 4—6;
J. Nüesch a. a. O. Taf. 11, 28. 31. 36; 13, 10—15; E. Peters a. a. O. Taf. 9, 10—13; L’Anthro-
pologie 45, 1935, 281 f. Abb. 9, 7—8, 11; Mannus 28, 1936, 235 f. Taf. 3, 1. 3.
2“) E. Peters a. a. O. Taf. 10, 12—17; Prähist. Zeitschr. 23, 1932, 155 f. Abb. 8, 1—2; Jahresber.
d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 21, 1929, 32 f. Abb. 3, 9—13; 5, 11—15; 40, 1949/50, 62 f. Abb. 7,
21—23; 41, 1951, 42 f. Abb. 2, 4—5; Mannus 28, 1936, 235 f. Taf. 3, 8—9; Bull. d. 1. Soc.
Scient. Hist, et Arch. d. 1. Correze (Bull. d. 1. Soc. Arch. d. Brive) 59, 1937, 33 f. Abb. 3, 14
(Puy-de-Lacan); L’Anthropologie 45, 1935, 281 f. Abb. 8, 1. 8—9 u. a.