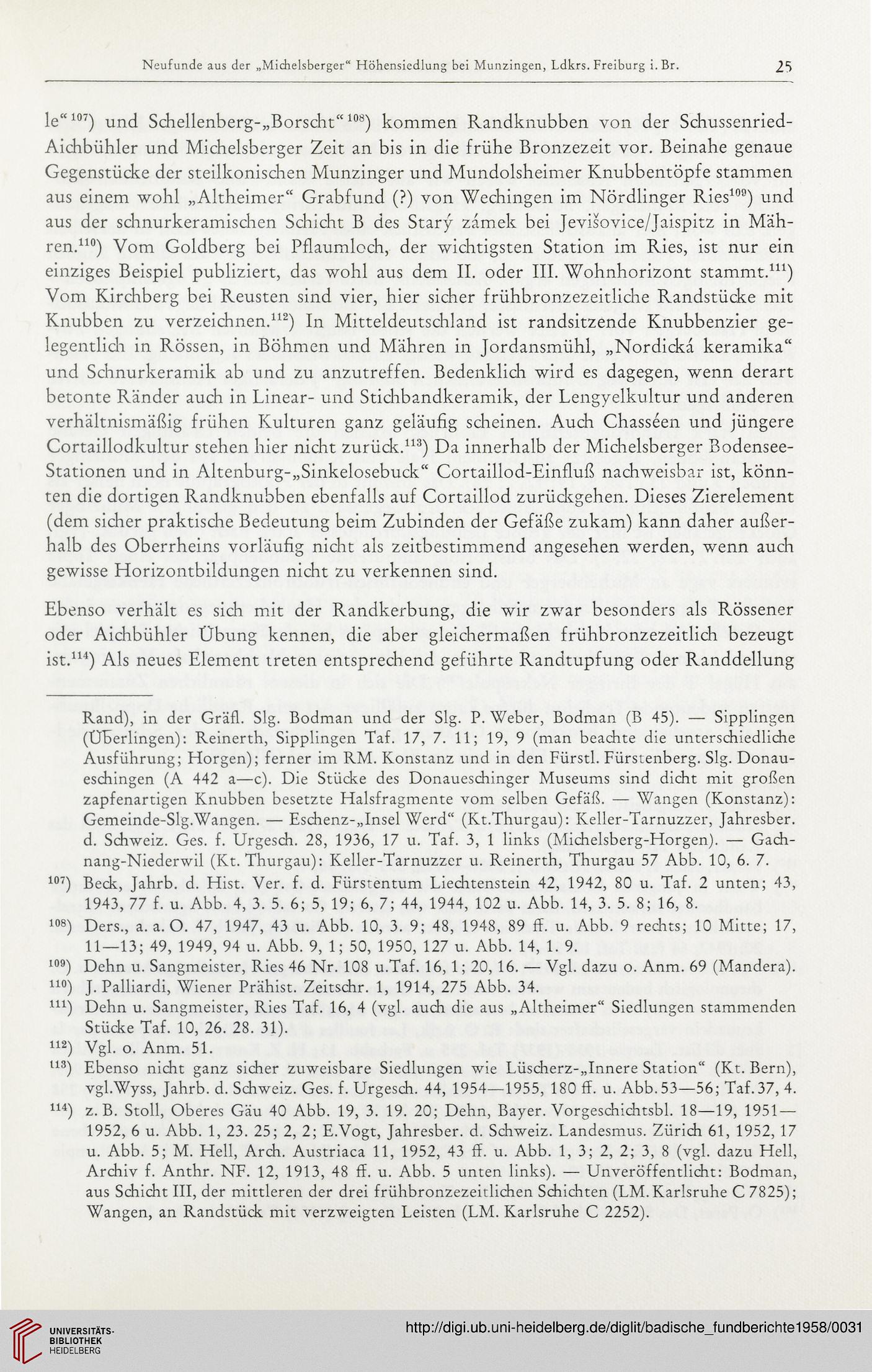Neufunde aus der „Michelsberger“ Höhensiedlung bei Munzingen, Ldkrs. Freiburg i.Br.
25
le“* * * * * * * * 107) und Schellenberg-„Borscht“108 109) kommen Randknubben von der Schussenried-
Aichbühler und Michelsberger Zeit an bis in die frühe Bronzezeit vor. Beinahe genaue
Gegenstücke der steilkonischen Munzinger und Mundolsheimer Knubbentöpfe stammen
aus einem wohl „Altheimer“ Grabfund (?) von Wechingen im Nördlinger Ries100) und
aus der schnurkeramischen Schicht B des Stary zamek bei Jevisovice/Jaispitz in Mäh-
ren.110) Vom Goldberg bei Pflaumloch, der wichtigsten Station im Ries, ist nur ein
einziges Beispiel publiziert, das wohl aus dem II. oder III. Wohnhorizont stammt.111)
Vom Kirchberg bei Reusten sind vier, hier sicher frühbronzezeitliche Randstücke mit
Knubben zu verzeichnen.112) In Mitteldeutschland ist randsitzende Knubbenzier ge-
legentlich in Rössen, in Böhmen und Mähren in Jordansmühl, „Nordickä keramika“
und Schnurkeramik ab und zu anzutreffen. Bedenklich wird es dagegen, wenn derart
betonte Ränder auch in Linear- und Stichbandkeramik, der Lengyelkultur und anderen
verhältnismäßig frühen Kulturen ganz geläufig scheinen. Auch Chasseen und jüngere
Cortaillodkultur stehen hier nicht zurück.113) Da innerhalb der Michelsberger Bodensee-
Stationen und in Altenburg-,,Sinkelosebuck“ Cortaillod-Einfluß nachweisbar ist, könn-
ten die dortigen Randknubben ebenfalls auf Cortaillod zurückgehen. Dieses Zierelement
(dem sicher praktische Bedeutung beim Zubinden der Gefäße zukam) kann daher außer-
halb des Oberrheins vorläufig nicht als zeitbestimmend angesehen werden, wenn auch
gewisse Horizontbildungen nicht zu verkennen sind.
Ebenso verhält es sich mit der Randkerbung, die wir zwar besonders als Rössener
oder Aichbühler Übung kennen, die aber gleichermaßen frühbronzezeitlich bezeugt
ist.114) Als neues Element treten entsprechend geführte Randtupfung oder Randdellung
Rand), in der Gräfl. Slg. Bodman und der Slg. P. Weber, Bodman (B 45). — Sipplingen
(Überlingen): Reinerth, Sipplingen Taf. 17, 7. 11; 19, 9 (man beachte die unterschiedliche
Ausführung; Horgen); ferner im RM. Konstanz und in den Fürstl. Fürstenberg. Slg. Donau¬
eschingen (A 442 a—c). Die Stücke des Donaueschinger Museums sind dicht mit großen
zapfenartigen Knubben besetzte Halsfragmente vom selben Gefäß. — Wangen (Konstanz):
Gemeinde-Slg.Wangen. — Eschenz-,.Insel Werd“ (Kt.Thurgau): Keller-Tarnuzzer, Jahresber.
d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 28, 1936, 17 u. Taf. 3, 1 links (Michelsberg-Horgen). — Gach-
nang-Niederwil (Kt.Thurgau): Keller-Tarnuzzer u. Reinerth, Thurgau 57 Abb. 10, 6. 7.
107) Beck, Jahrb. d. Hist. Ver. f. d. Fürstentum Liechtenstein 42, 1942, 80 u. Taf. 2 unten; 43,
1943, 77 f. u. Abb. 4, 3. 5. 6; 5, 19; 6, 7; 44, 1944, 102 u. Abb. 14, 3. 5. 8; 16, 8.
108) Ders., a. a. O. 47, 1947, 43 u. Abb. 10, 3. 9; 48, 1948, 89 ff. u. Abb. 9 rechts; 10 Mitte; 17,
11—13; 49, 1949, 94 u. Abb. 9, 1; 50, 1950, 127 u. Abb. 14, 1. 9.
109) Dehn u. Sangmeister, Ries 46 Nr. 108 u.Taf. 16, 1; 20, 16. — Vgl. dazu o. Anm. 69 (Mandera).
110) J. Palliardi, Wiener Prähist. Zeitschr. 1, 1914, 275 Abb. 34.
U1) Dehn u. Sangmeister, Ries Taf. 16, 4 (vgl. auch die aus „Altheimer“ Siedlungen stammenden
Stücke Taf. 10, 26. 28. 31).
112) Vgl. o. Anm. 51.
113) Ebenso nicht ganz sicher zuweisbare Siedlungen wie Lüscherz-„Innere Station“ (Kt. Bern),
vgl.Wyss, Jahrb. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 44, 1954—1955, 180 ff. u. Abb.53—56; Taf.37, 4.
114) z. B. Stoll, Oberes Gäu 40 Abb. 19, 3. 19. 20; Dehn, Bayer. Vorgeschichtsbl. 18—19, 1951 —
1952, 6 u. Abb. 1, 23. 25; 2, 2; E.Vogt, Jahresber. d. Schweiz. Landesmus. Zürich 61, 1952, 17
u. Abb. 5; M. Hell, Arch. Austriaca 11, 1952, 43 ff. u. Abb. 1, 3; 2, 2; 3, 8 (vgl. dazu Hell,
Archiv f. Anthr. NF. 12, 1913, 48 ff. u. Abb. 5 unten links). — Unveröffentlicht: Bodman,
aus Schicht III, der mittleren der drei frühbronzezeitlichen Schichten (LM. Karlsruhe C 7825);
Wangen, an Randstück mit verzweigten Leisten (LM. Karlsruhe C 2252).
25
le“* * * * * * * * 107) und Schellenberg-„Borscht“108 109) kommen Randknubben von der Schussenried-
Aichbühler und Michelsberger Zeit an bis in die frühe Bronzezeit vor. Beinahe genaue
Gegenstücke der steilkonischen Munzinger und Mundolsheimer Knubbentöpfe stammen
aus einem wohl „Altheimer“ Grabfund (?) von Wechingen im Nördlinger Ries100) und
aus der schnurkeramischen Schicht B des Stary zamek bei Jevisovice/Jaispitz in Mäh-
ren.110) Vom Goldberg bei Pflaumloch, der wichtigsten Station im Ries, ist nur ein
einziges Beispiel publiziert, das wohl aus dem II. oder III. Wohnhorizont stammt.111)
Vom Kirchberg bei Reusten sind vier, hier sicher frühbronzezeitliche Randstücke mit
Knubben zu verzeichnen.112) In Mitteldeutschland ist randsitzende Knubbenzier ge-
legentlich in Rössen, in Böhmen und Mähren in Jordansmühl, „Nordickä keramika“
und Schnurkeramik ab und zu anzutreffen. Bedenklich wird es dagegen, wenn derart
betonte Ränder auch in Linear- und Stichbandkeramik, der Lengyelkultur und anderen
verhältnismäßig frühen Kulturen ganz geläufig scheinen. Auch Chasseen und jüngere
Cortaillodkultur stehen hier nicht zurück.113) Da innerhalb der Michelsberger Bodensee-
Stationen und in Altenburg-,,Sinkelosebuck“ Cortaillod-Einfluß nachweisbar ist, könn-
ten die dortigen Randknubben ebenfalls auf Cortaillod zurückgehen. Dieses Zierelement
(dem sicher praktische Bedeutung beim Zubinden der Gefäße zukam) kann daher außer-
halb des Oberrheins vorläufig nicht als zeitbestimmend angesehen werden, wenn auch
gewisse Horizontbildungen nicht zu verkennen sind.
Ebenso verhält es sich mit der Randkerbung, die wir zwar besonders als Rössener
oder Aichbühler Übung kennen, die aber gleichermaßen frühbronzezeitlich bezeugt
ist.114) Als neues Element treten entsprechend geführte Randtupfung oder Randdellung
Rand), in der Gräfl. Slg. Bodman und der Slg. P. Weber, Bodman (B 45). — Sipplingen
(Überlingen): Reinerth, Sipplingen Taf. 17, 7. 11; 19, 9 (man beachte die unterschiedliche
Ausführung; Horgen); ferner im RM. Konstanz und in den Fürstl. Fürstenberg. Slg. Donau¬
eschingen (A 442 a—c). Die Stücke des Donaueschinger Museums sind dicht mit großen
zapfenartigen Knubben besetzte Halsfragmente vom selben Gefäß. — Wangen (Konstanz):
Gemeinde-Slg.Wangen. — Eschenz-,.Insel Werd“ (Kt.Thurgau): Keller-Tarnuzzer, Jahresber.
d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 28, 1936, 17 u. Taf. 3, 1 links (Michelsberg-Horgen). — Gach-
nang-Niederwil (Kt.Thurgau): Keller-Tarnuzzer u. Reinerth, Thurgau 57 Abb. 10, 6. 7.
107) Beck, Jahrb. d. Hist. Ver. f. d. Fürstentum Liechtenstein 42, 1942, 80 u. Taf. 2 unten; 43,
1943, 77 f. u. Abb. 4, 3. 5. 6; 5, 19; 6, 7; 44, 1944, 102 u. Abb. 14, 3. 5. 8; 16, 8.
108) Ders., a. a. O. 47, 1947, 43 u. Abb. 10, 3. 9; 48, 1948, 89 ff. u. Abb. 9 rechts; 10 Mitte; 17,
11—13; 49, 1949, 94 u. Abb. 9, 1; 50, 1950, 127 u. Abb. 14, 1. 9.
109) Dehn u. Sangmeister, Ries 46 Nr. 108 u.Taf. 16, 1; 20, 16. — Vgl. dazu o. Anm. 69 (Mandera).
110) J. Palliardi, Wiener Prähist. Zeitschr. 1, 1914, 275 Abb. 34.
U1) Dehn u. Sangmeister, Ries Taf. 16, 4 (vgl. auch die aus „Altheimer“ Siedlungen stammenden
Stücke Taf. 10, 26. 28. 31).
112) Vgl. o. Anm. 51.
113) Ebenso nicht ganz sicher zuweisbare Siedlungen wie Lüscherz-„Innere Station“ (Kt. Bern),
vgl.Wyss, Jahrb. d. Schweiz. Ges. f. Urgesch. 44, 1954—1955, 180 ff. u. Abb.53—56; Taf.37, 4.
114) z. B. Stoll, Oberes Gäu 40 Abb. 19, 3. 19. 20; Dehn, Bayer. Vorgeschichtsbl. 18—19, 1951 —
1952, 6 u. Abb. 1, 23. 25; 2, 2; E.Vogt, Jahresber. d. Schweiz. Landesmus. Zürich 61, 1952, 17
u. Abb. 5; M. Hell, Arch. Austriaca 11, 1952, 43 ff. u. Abb. 1, 3; 2, 2; 3, 8 (vgl. dazu Hell,
Archiv f. Anthr. NF. 12, 1913, 48 ff. u. Abb. 5 unten links). — Unveröffentlicht: Bodman,
aus Schicht III, der mittleren der drei frühbronzezeitlichen Schichten (LM. Karlsruhe C 7825);
Wangen, an Randstück mit verzweigten Leisten (LM. Karlsruhe C 2252).