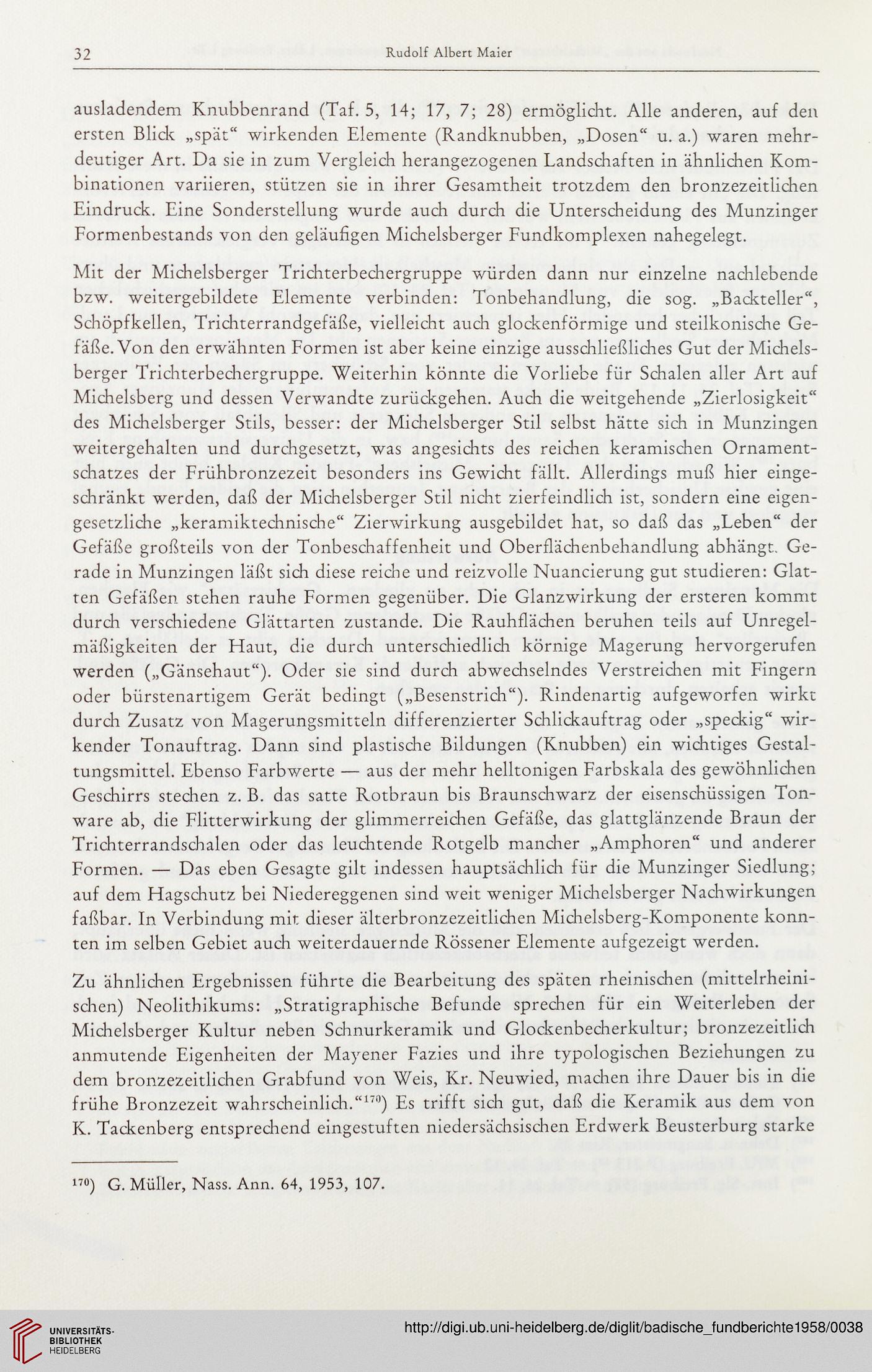32
Rudolf Albert Maier
ausladendem Knubbenrand (Taf. 5, 14; 17, 7; 28) ermöglicht. Alle anderen, auf den
ersten Blick „spät“ wirkenden Elemente (Randknubben, „Dosen“ u. a.) waren mehr-
deutiger Art. Da sie in zum Vergleich herangezogenen Landschaften in ähnlichen Kom-
binationen variieren, stützen sie in ihrer Gesamtheit trotzdem den bronzezeitlichen
Eindruck. Eine Sonderstellung wurde auch durch die Unterscheidung des Munzinger
Formenbestands von den geläufigen Michelsberger Fundkomplexen nahegelegt.
Mit der Michelsberger Trichterbechergruppe würden dann nur einzelne nachlebende
bzw. weitergebildete Elemente verbinden: Tonbehandlung, die sog. „Backteller“,
Schöpfkellen, Trichterrandgefäße, vielleicht auch glockenförmige und steilkonische Ge-
fäße. Von den erwähnten Formen ist aber keine einzige ausschließliches Gut der Michels-
berger Trichterbechergruppe. Weiterhin könnte die Vorliebe für Schalen aller Art auf
Michelsberg und dessen Verwandte zurückgehen. Auch die weitgehende „Zierlosigkeit“
des Michelsberger Stils, besser: der Michelsberger Stil selbst hätte sich in Munzingen
weitergehalten und durchgesetzt, was angesichts des reichen keramischen Ornament-
schatzes der Frühbronzezeit besonders ins Gewicht fällt. Allerdings muß hier einge-
schränkt werden, daß der Michelsberger Stil nicht zierfeindlich ist, sondern eine eigen-
gesetzliche „keramiktechnische“ Zierwirkung ausgebildet hat, so daß das „Leben“ der
Gefäße großteils von der Tonbeschaffenheit und Oberflächenbehandlung abhängt. Ge-
rade in Munzingen läßt sich diese reiche und reizvolle Nuancierung gut studieren: Glat-
ten Gefäßen stehen rauhe Formen gegenüber. Die Glanzwirkung der ersteren kommt
durch verschiedene Glättarten zustande. Die Rauhflächen beruhen teils auf Unregel-
mäßigkeiten der Haut, die durch unterschiedlich körnige Magerung hervorgerufen
werden („Gänsehaut“). Oder sie sind durch abwechselndes Verstreichen mit Fingern
oder bürstenartigem Gerät bedingt („Besenstrich“). Rindenartig aufgeworfen wirkt
durch Zusatz von Magerungsmitteln differenzierter Schlickauftrag oder „speckig“ wir-
kender Tonauftrag. Dann sind plastische Bildungen (Knubben) ein wichtiges Gestal-
tungsmittel. Ebenso Farbwerte — aus der mehr helltonigen Farbskala des gewöhnlichen
Geschirrs stechen z. B. das satte Rotbraun bis Braunschwarz der eisenschüssigen Ton-
ware ab, die Flitterwirkung der glimmerreichen Gefäße, das glattglänzende Braun der
Trichterrandschalen oder das leuchtende Rotgelb mancher „Amphoren“ und anderer
Formen. — Das eben Gesagte gilt indessen hauptsächlich für die Munzinger Siedlung;
auf dem Hagschutz bei Niedereggenen sind weit weniger Michelsberger Nachwirkungen
faßbar. In Verbindung mit dieser älterbronzezeitlichen Michelsberg-Komponente konn-
ten im selben Gebiet auch weiterdauernde Rössener Elemente aufgezeigt werden.
Zu ähnlichen Ergebnissen führte die Bearbeitung des späten rheinischen (mittelrheini-
schen) Neolithikums: „Stratigraphische Befunde sprechen für ein Weiterleben der
Michelsberger Kultur neben Schnurkeramik und Glockenbecherkultur; bronzezeitlich
anmutende Eigenheiten der Mayener Fazies und ihre typologischen Beziehungen zu
dem bronzezeitlichen Grabfund von Weis, Kr. Neuwied, machen ihre Dauer bis in die
frühe Bronzezeit wahrscheinlich.“1''1) Es trifft sich gut, daß die Keramik aus dem von
K. Tackenberg entsprechend eingestuften niedersächsischen Erdwerk Beusterburg starke
170) G. Müller, Nass. Ann. 64, 1953, 107.
Rudolf Albert Maier
ausladendem Knubbenrand (Taf. 5, 14; 17, 7; 28) ermöglicht. Alle anderen, auf den
ersten Blick „spät“ wirkenden Elemente (Randknubben, „Dosen“ u. a.) waren mehr-
deutiger Art. Da sie in zum Vergleich herangezogenen Landschaften in ähnlichen Kom-
binationen variieren, stützen sie in ihrer Gesamtheit trotzdem den bronzezeitlichen
Eindruck. Eine Sonderstellung wurde auch durch die Unterscheidung des Munzinger
Formenbestands von den geläufigen Michelsberger Fundkomplexen nahegelegt.
Mit der Michelsberger Trichterbechergruppe würden dann nur einzelne nachlebende
bzw. weitergebildete Elemente verbinden: Tonbehandlung, die sog. „Backteller“,
Schöpfkellen, Trichterrandgefäße, vielleicht auch glockenförmige und steilkonische Ge-
fäße. Von den erwähnten Formen ist aber keine einzige ausschließliches Gut der Michels-
berger Trichterbechergruppe. Weiterhin könnte die Vorliebe für Schalen aller Art auf
Michelsberg und dessen Verwandte zurückgehen. Auch die weitgehende „Zierlosigkeit“
des Michelsberger Stils, besser: der Michelsberger Stil selbst hätte sich in Munzingen
weitergehalten und durchgesetzt, was angesichts des reichen keramischen Ornament-
schatzes der Frühbronzezeit besonders ins Gewicht fällt. Allerdings muß hier einge-
schränkt werden, daß der Michelsberger Stil nicht zierfeindlich ist, sondern eine eigen-
gesetzliche „keramiktechnische“ Zierwirkung ausgebildet hat, so daß das „Leben“ der
Gefäße großteils von der Tonbeschaffenheit und Oberflächenbehandlung abhängt. Ge-
rade in Munzingen läßt sich diese reiche und reizvolle Nuancierung gut studieren: Glat-
ten Gefäßen stehen rauhe Formen gegenüber. Die Glanzwirkung der ersteren kommt
durch verschiedene Glättarten zustande. Die Rauhflächen beruhen teils auf Unregel-
mäßigkeiten der Haut, die durch unterschiedlich körnige Magerung hervorgerufen
werden („Gänsehaut“). Oder sie sind durch abwechselndes Verstreichen mit Fingern
oder bürstenartigem Gerät bedingt („Besenstrich“). Rindenartig aufgeworfen wirkt
durch Zusatz von Magerungsmitteln differenzierter Schlickauftrag oder „speckig“ wir-
kender Tonauftrag. Dann sind plastische Bildungen (Knubben) ein wichtiges Gestal-
tungsmittel. Ebenso Farbwerte — aus der mehr helltonigen Farbskala des gewöhnlichen
Geschirrs stechen z. B. das satte Rotbraun bis Braunschwarz der eisenschüssigen Ton-
ware ab, die Flitterwirkung der glimmerreichen Gefäße, das glattglänzende Braun der
Trichterrandschalen oder das leuchtende Rotgelb mancher „Amphoren“ und anderer
Formen. — Das eben Gesagte gilt indessen hauptsächlich für die Munzinger Siedlung;
auf dem Hagschutz bei Niedereggenen sind weit weniger Michelsberger Nachwirkungen
faßbar. In Verbindung mit dieser älterbronzezeitlichen Michelsberg-Komponente konn-
ten im selben Gebiet auch weiterdauernde Rössener Elemente aufgezeigt werden.
Zu ähnlichen Ergebnissen führte die Bearbeitung des späten rheinischen (mittelrheini-
schen) Neolithikums: „Stratigraphische Befunde sprechen für ein Weiterleben der
Michelsberger Kultur neben Schnurkeramik und Glockenbecherkultur; bronzezeitlich
anmutende Eigenheiten der Mayener Fazies und ihre typologischen Beziehungen zu
dem bronzezeitlichen Grabfund von Weis, Kr. Neuwied, machen ihre Dauer bis in die
frühe Bronzezeit wahrscheinlich.“1''1) Es trifft sich gut, daß die Keramik aus dem von
K. Tackenberg entsprechend eingestuften niedersächsischen Erdwerk Beusterburg starke
170) G. Müller, Nass. Ann. 64, 1953, 107.