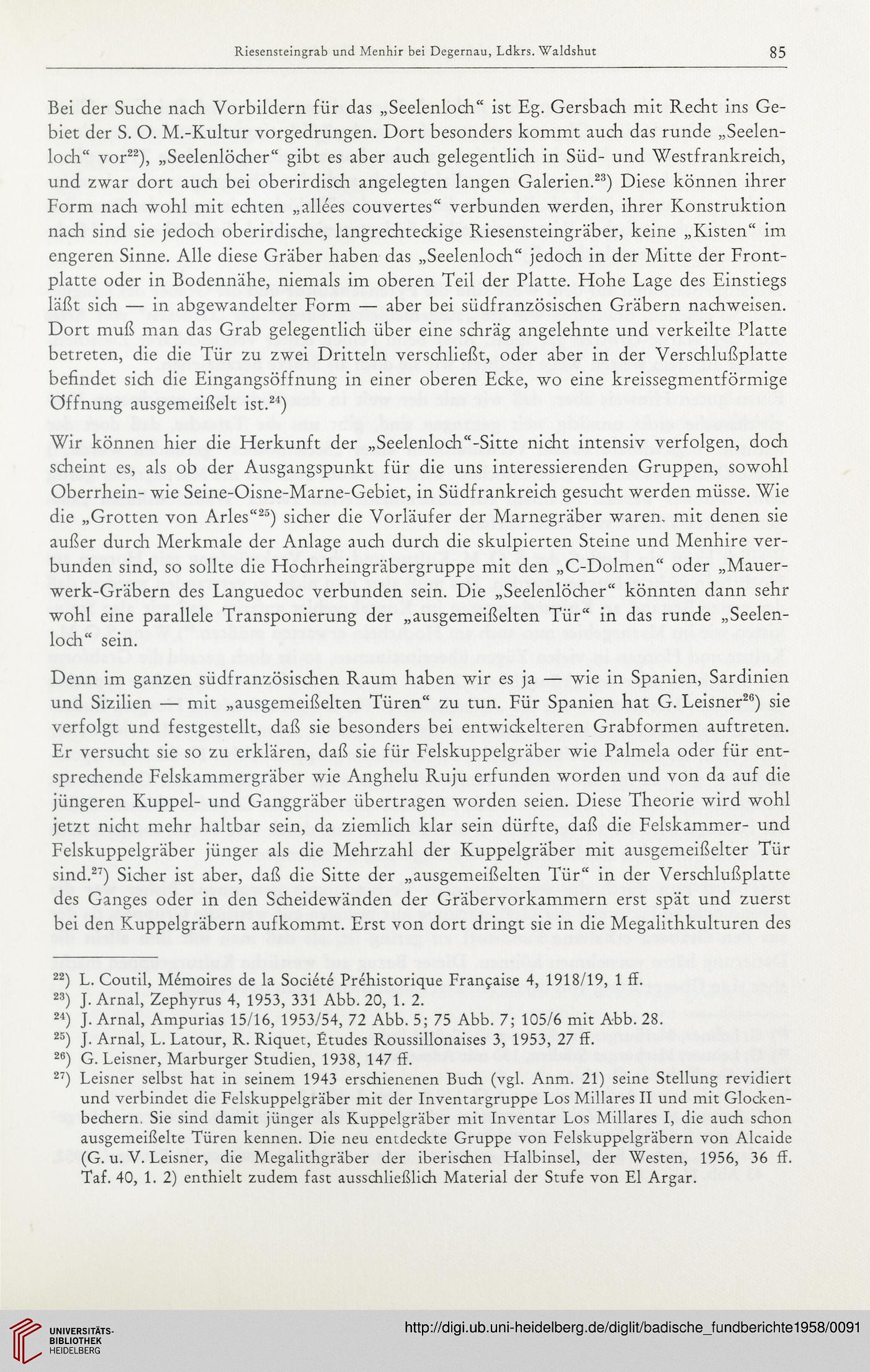Riesensteingrab und Menhir bei Degernau, Ldkrs. Waldshut
85
Bei der Suche nach Vorbildern für das „Seelenloch“ ist Eg. Gersbach mit Recht ins Ge-
biet der S. O. M.-Kultur vorgedrungen. Dort besonders kommt auch das runde „Seelen-
loch“ vor22), „Seelenlöcher“ gibt es aber auch gelegentlich in Süd- und Westfrankreich,
und zwar dort auch bei oberirdisch angelegten langen Galerien.23) Diese können ihrer
Form nach wohl mit echten „allees couvertes“ verbunden werden, ihrer Konstruktion
nach sind sie jedoch oberirdische, langrechteckige Riesensteingräber, keine „Kisten“ im
engeren Sinne. Alle diese Gräber haben das „Seelenloch“ jedoch in der Mitte der Front-
platte oder in Bodennähe, niemals im oberen Teil der Platte. Hohe Lage des Einstiegs
läßt sich — in abgewandelter Form — aber bei südfranzösischen Gräbern nachweisen.
Dort muß man das Grab gelegentlich über eine schräg angelehnte und verkeilte Platte
betreten, die die Tür zu zwei Dritteln verschließt, oder aber in der Verschlußplatte
befindet sich die Eingangsöffnung in einer oberen Ecke, wo eine kreissegmentförmige
Öffnung ausgemeißelt ist.24)
Wir können hier die Herkunft der „Seelenloch“-Sitte nicht intensiv verfolgen, doch
scheint es, als ob der Ausgangspunkt für die uns interessierenden Gruppen, sowohl
Oberrhein- wie Seine-Oisne-Marne-Gebiet, in Südfrankreich gesucht werden müsse. Wie
die „Grotten von Arles“25) sicher die Vorläufer der Marnegräber waren, mit denen sie
außer durch Merkmale der Anlage auch durch die skulpierten Steine und Menhire ver-
bunden sind, so sollte die Hochrheingräbergruppe mit den „C-Dolmen“ oder „Mauer-
werk-Gräbern des Languedoc verbunden sein. Die „Seelenlöcher“ könnten dann sehr
wohl eine parallele Transponierung der „ausgemeißelten Tür“ in das runde „Seelen-
loch“ sein.
Denn im ganzen südfranzösischen Raum haben wir es ja — wie in Spanien, Sardinien
und Sizilien — mit „ausgemeißelten Türen“ zu tun. Für Spanien hat G. Leisner26) sie
verfolgt und festgestellt, daß sie besonders bei entwickelteren Grabformen auftreten.
Er versucht sie so zu erklären, daß sie für Felskuppelgräber wie Palmela oder für ent-
sprechende Felskammergräber wie Anghelu Ruju erfunden worden und von da auf die
jüngeren Kuppel- und Ganggräber übertragen worden seien. Diese Theorie wird wohl
jetzt nicht mehr haltbar sein, da ziemlich klar sein dürfte, daß die Felskammer- und
Felskuppelgräber jünger als die Mehrzahl der Kuppelgräber mit ausgemeißelter Tür
sind.27) Sicher ist aber, daß die Sitte der „ausgemeißelten Tür“ in der Verschlußplatte
des Ganges oder in den Scheidewänden der Gräbervorkammern erst spät und zuerst
bei den Kuppelgräbern aufkommt. Erst von dort dringt sie in die Megalithkulturen des
22) L. Coutil, Memoires de la Societe Prehistorique Franfaise 4, 1918/19, 1 ff.
23) J. Arnal, Zephyrus 4, 1953, 331 Abb. 20, 1. 2.
24) J. Arnal, Ampurias 15/16, 1953/54, 72 Abb. 5; 75 Abb. 7; 105/6 mit Abb. 28.
25) J. Arnal, L. Latour, R. Riquet, fitudes Roussillonaises 3, 1953, 27 ff.
26) G. Leisner, Marburger Studien, 1938, 147 ff.
27) Leisner selbst hat in seinem 1943 erschienenen Buch (vgl. Anm. 21) seine Stellung revidiert
und verbindet die Felskuppelgräber mit der Inventargruppe Los Miliares II und mit Glocken-
bechern. Sie sind damit jünger als Kuppelgräber mit Inventar Los Miliares I, die auch schon
ausgemeißelte Türen kennen. Die neu entdeckte Gruppe von Felskuppelgräbern von Alcaide
(G. u. V. Leisner, die Megalithgräber der iberischen Halbinsel, der Westen, 1956, 36 ff.
Taf. 40, 1. 2) enthielt zudem fast ausschließlich Material der Stufe von El Argar.
85
Bei der Suche nach Vorbildern für das „Seelenloch“ ist Eg. Gersbach mit Recht ins Ge-
biet der S. O. M.-Kultur vorgedrungen. Dort besonders kommt auch das runde „Seelen-
loch“ vor22), „Seelenlöcher“ gibt es aber auch gelegentlich in Süd- und Westfrankreich,
und zwar dort auch bei oberirdisch angelegten langen Galerien.23) Diese können ihrer
Form nach wohl mit echten „allees couvertes“ verbunden werden, ihrer Konstruktion
nach sind sie jedoch oberirdische, langrechteckige Riesensteingräber, keine „Kisten“ im
engeren Sinne. Alle diese Gräber haben das „Seelenloch“ jedoch in der Mitte der Front-
platte oder in Bodennähe, niemals im oberen Teil der Platte. Hohe Lage des Einstiegs
läßt sich — in abgewandelter Form — aber bei südfranzösischen Gräbern nachweisen.
Dort muß man das Grab gelegentlich über eine schräg angelehnte und verkeilte Platte
betreten, die die Tür zu zwei Dritteln verschließt, oder aber in der Verschlußplatte
befindet sich die Eingangsöffnung in einer oberen Ecke, wo eine kreissegmentförmige
Öffnung ausgemeißelt ist.24)
Wir können hier die Herkunft der „Seelenloch“-Sitte nicht intensiv verfolgen, doch
scheint es, als ob der Ausgangspunkt für die uns interessierenden Gruppen, sowohl
Oberrhein- wie Seine-Oisne-Marne-Gebiet, in Südfrankreich gesucht werden müsse. Wie
die „Grotten von Arles“25) sicher die Vorläufer der Marnegräber waren, mit denen sie
außer durch Merkmale der Anlage auch durch die skulpierten Steine und Menhire ver-
bunden sind, so sollte die Hochrheingräbergruppe mit den „C-Dolmen“ oder „Mauer-
werk-Gräbern des Languedoc verbunden sein. Die „Seelenlöcher“ könnten dann sehr
wohl eine parallele Transponierung der „ausgemeißelten Tür“ in das runde „Seelen-
loch“ sein.
Denn im ganzen südfranzösischen Raum haben wir es ja — wie in Spanien, Sardinien
und Sizilien — mit „ausgemeißelten Türen“ zu tun. Für Spanien hat G. Leisner26) sie
verfolgt und festgestellt, daß sie besonders bei entwickelteren Grabformen auftreten.
Er versucht sie so zu erklären, daß sie für Felskuppelgräber wie Palmela oder für ent-
sprechende Felskammergräber wie Anghelu Ruju erfunden worden und von da auf die
jüngeren Kuppel- und Ganggräber übertragen worden seien. Diese Theorie wird wohl
jetzt nicht mehr haltbar sein, da ziemlich klar sein dürfte, daß die Felskammer- und
Felskuppelgräber jünger als die Mehrzahl der Kuppelgräber mit ausgemeißelter Tür
sind.27) Sicher ist aber, daß die Sitte der „ausgemeißelten Tür“ in der Verschlußplatte
des Ganges oder in den Scheidewänden der Gräbervorkammern erst spät und zuerst
bei den Kuppelgräbern aufkommt. Erst von dort dringt sie in die Megalithkulturen des
22) L. Coutil, Memoires de la Societe Prehistorique Franfaise 4, 1918/19, 1 ff.
23) J. Arnal, Zephyrus 4, 1953, 331 Abb. 20, 1. 2.
24) J. Arnal, Ampurias 15/16, 1953/54, 72 Abb. 5; 75 Abb. 7; 105/6 mit Abb. 28.
25) J. Arnal, L. Latour, R. Riquet, fitudes Roussillonaises 3, 1953, 27 ff.
26) G. Leisner, Marburger Studien, 1938, 147 ff.
27) Leisner selbst hat in seinem 1943 erschienenen Buch (vgl. Anm. 21) seine Stellung revidiert
und verbindet die Felskuppelgräber mit der Inventargruppe Los Miliares II und mit Glocken-
bechern. Sie sind damit jünger als Kuppelgräber mit Inventar Los Miliares I, die auch schon
ausgemeißelte Türen kennen. Die neu entdeckte Gruppe von Felskuppelgräbern von Alcaide
(G. u. V. Leisner, die Megalithgräber der iberischen Halbinsel, der Westen, 1956, 36 ff.
Taf. 40, 1. 2) enthielt zudem fast ausschließlich Material der Stufe von El Argar.