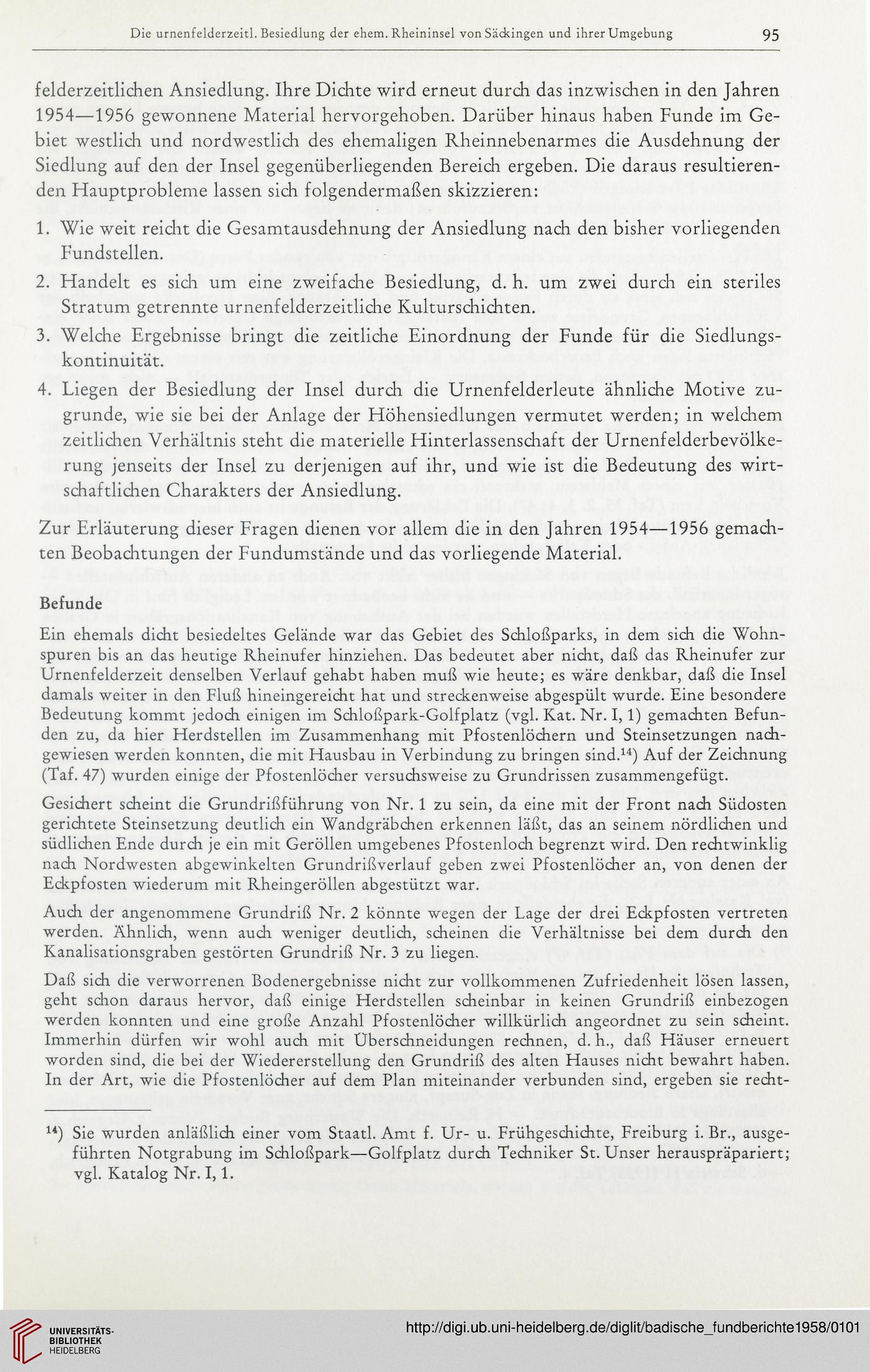Die urnenfelderzeitl. Besiedlung der ehern. Rheininsel vonSäckingen und ihrer Umgebung
95
felderzeitlichen Ansiedlung. Ihre Dichte wird erneut durch das inzwischen in den Jahren
1954—1956 gewonnene Material hervorgehoben. Darüber hinaus haben Funde im Ge-
biet westlich und nordwestlich des ehemaligen Rheinnebenarmes die Ausdehnung der
Siedlung auf den der Insel gegenüberliegenden Bereich ergeben. Die daraus resultieren-
den Hauptprobleme lassen sich folgendermaßen skizzieren:
1. Wie weit reicht die Gesamtausdehnung der Ansiedlung nach den bisher vorliegenden
Fundstellen.
2. Handelt es sich um eine zweifache Besiedlung, d. h. um zwei durch ein steriles
Stratum getrennte urnenfelderzeitliche Kulturschichten.
3. Welche Ergebnisse bringt die zeitliche Einordnung der Funde für die Siedlungs-
kontinuität.
4. Liegen der Besiedlung der Insel durch die Urnenfelderleute ähnliche Motive zu-
grunde, wie sie bei der Anlage der Höhensiedlungen vermutet werden; in welchem
zeitlichen Verhältnis steht die materielle Hinterlassenschaft der Urnenfelderbevölke-
rung jenseits der Insel zu derjenigen auf ihr, und wie ist die Bedeutung des wirt-
schaftlichen Charakters der Ansiedlung.
Zur Erläuterung dieser Fragen dienen vor allem die in den Jahren 1954—1956 gemach-
ten Beobachtungen der Fundumstände und das vorliegende Material.
Befunde
Ein ehemals dicht besiedeltes Gelände war das Gebiet des Schloßparks, in dem sich die Wohn-
spuren bis an das heutige Rheinufer hinziehen. Das bedeutet aber nicht, daß das Rheinufer zur
Urnenfelderzeit denselben Verlauf gehabt haben muß wie heute; es wäre denkbar, daß die Insel
damals weiter in den Fluß hineingereicht hat und streckenweise abgespült wurde. Eine besondere
Bedeutung kommt jedoch einigen im Schloßpark-Golfplatz (vgl. Kat. Nr. 1,1) gemachten Befun-
den zu, da hier Herdstellen im Zusammenhang mit Pfostenlöchern und Steinsetzungen nach-
gewiesen werden konnten, die mit Hausbau in Verbindung zu bringen sind.14) Auf der Zeichnung
(Taf. 47) wurden einige der Pfostenlöcher versuchsweise zu Grundrissen zusammengefügt.
Gesichert scheint die Grundrißführung von Nr. 1 zu sein, da eine mit der Front nach Südosten
gerichtete Steinsetzung deutlich ein Wandgräbchen erkennen läßt, das an seinem nördlichen und
südlichen Ende durch je ein mit Gerollen umgebenes Pfostenloch begrenzt wird. Den rechtwinklig
nach Nordwesten abgewinkelten Grundrißverlauf geben zwei Pfostenlöcher an, von denen der
Eckpfosten wiederum mit Rheingeröllen abgestützt war.
Auch der angenommene Grundriß Nr. 2 könnte wegen der Lage der drei Eckpfosten vertreten
werden. Ähnlich, wenn auch weniger deutlich, scheinen die Verhältnisse bei dem durch den
Kanalisationsgraben gestörten Grundriß Nr. 3 zu liegen.
Daß sich die verworrenen Bodenergebnisse nicht zur vollkommenen Zufriedenheit lösen lassen,
geht schon daraus hervor, daß einige Herdstellen scheinbar in keinen Grundriß einbezogen
werden konnten und eine große Anzahl Pfostenlöcher willkürlich angeordnet zu sein scheint.
Immerhin dürfen wir wohl auch mit Überschneidungen rechnen, d. h., daß Häuser erneuert
worden sind, die bei der Wiedererstellung den Grundriß des alten Hauses nicht bewahrt haben.
In der Art, wie die Pfostenlöcher auf dem Plan miteinander verbunden sind, ergeben sie recht-
14) Sie wurden anläßlich einer vom Staatl. Amt f. Ur- u. Frühgeschichte, Freiburg i. Br., ausge-
führten Notgrabung im Schloßpark—Golfplatz durch Techniker St. Unser herauspräpariert;
vgl. Katalog Nr. 1,1.
95
felderzeitlichen Ansiedlung. Ihre Dichte wird erneut durch das inzwischen in den Jahren
1954—1956 gewonnene Material hervorgehoben. Darüber hinaus haben Funde im Ge-
biet westlich und nordwestlich des ehemaligen Rheinnebenarmes die Ausdehnung der
Siedlung auf den der Insel gegenüberliegenden Bereich ergeben. Die daraus resultieren-
den Hauptprobleme lassen sich folgendermaßen skizzieren:
1. Wie weit reicht die Gesamtausdehnung der Ansiedlung nach den bisher vorliegenden
Fundstellen.
2. Handelt es sich um eine zweifache Besiedlung, d. h. um zwei durch ein steriles
Stratum getrennte urnenfelderzeitliche Kulturschichten.
3. Welche Ergebnisse bringt die zeitliche Einordnung der Funde für die Siedlungs-
kontinuität.
4. Liegen der Besiedlung der Insel durch die Urnenfelderleute ähnliche Motive zu-
grunde, wie sie bei der Anlage der Höhensiedlungen vermutet werden; in welchem
zeitlichen Verhältnis steht die materielle Hinterlassenschaft der Urnenfelderbevölke-
rung jenseits der Insel zu derjenigen auf ihr, und wie ist die Bedeutung des wirt-
schaftlichen Charakters der Ansiedlung.
Zur Erläuterung dieser Fragen dienen vor allem die in den Jahren 1954—1956 gemach-
ten Beobachtungen der Fundumstände und das vorliegende Material.
Befunde
Ein ehemals dicht besiedeltes Gelände war das Gebiet des Schloßparks, in dem sich die Wohn-
spuren bis an das heutige Rheinufer hinziehen. Das bedeutet aber nicht, daß das Rheinufer zur
Urnenfelderzeit denselben Verlauf gehabt haben muß wie heute; es wäre denkbar, daß die Insel
damals weiter in den Fluß hineingereicht hat und streckenweise abgespült wurde. Eine besondere
Bedeutung kommt jedoch einigen im Schloßpark-Golfplatz (vgl. Kat. Nr. 1,1) gemachten Befun-
den zu, da hier Herdstellen im Zusammenhang mit Pfostenlöchern und Steinsetzungen nach-
gewiesen werden konnten, die mit Hausbau in Verbindung zu bringen sind.14) Auf der Zeichnung
(Taf. 47) wurden einige der Pfostenlöcher versuchsweise zu Grundrissen zusammengefügt.
Gesichert scheint die Grundrißführung von Nr. 1 zu sein, da eine mit der Front nach Südosten
gerichtete Steinsetzung deutlich ein Wandgräbchen erkennen läßt, das an seinem nördlichen und
südlichen Ende durch je ein mit Gerollen umgebenes Pfostenloch begrenzt wird. Den rechtwinklig
nach Nordwesten abgewinkelten Grundrißverlauf geben zwei Pfostenlöcher an, von denen der
Eckpfosten wiederum mit Rheingeröllen abgestützt war.
Auch der angenommene Grundriß Nr. 2 könnte wegen der Lage der drei Eckpfosten vertreten
werden. Ähnlich, wenn auch weniger deutlich, scheinen die Verhältnisse bei dem durch den
Kanalisationsgraben gestörten Grundriß Nr. 3 zu liegen.
Daß sich die verworrenen Bodenergebnisse nicht zur vollkommenen Zufriedenheit lösen lassen,
geht schon daraus hervor, daß einige Herdstellen scheinbar in keinen Grundriß einbezogen
werden konnten und eine große Anzahl Pfostenlöcher willkürlich angeordnet zu sein scheint.
Immerhin dürfen wir wohl auch mit Überschneidungen rechnen, d. h., daß Häuser erneuert
worden sind, die bei der Wiedererstellung den Grundriß des alten Hauses nicht bewahrt haben.
In der Art, wie die Pfostenlöcher auf dem Plan miteinander verbunden sind, ergeben sie recht-
14) Sie wurden anläßlich einer vom Staatl. Amt f. Ur- u. Frühgeschichte, Freiburg i. Br., ausge-
führten Notgrabung im Schloßpark—Golfplatz durch Techniker St. Unser herauspräpariert;
vgl. Katalog Nr. 1,1.