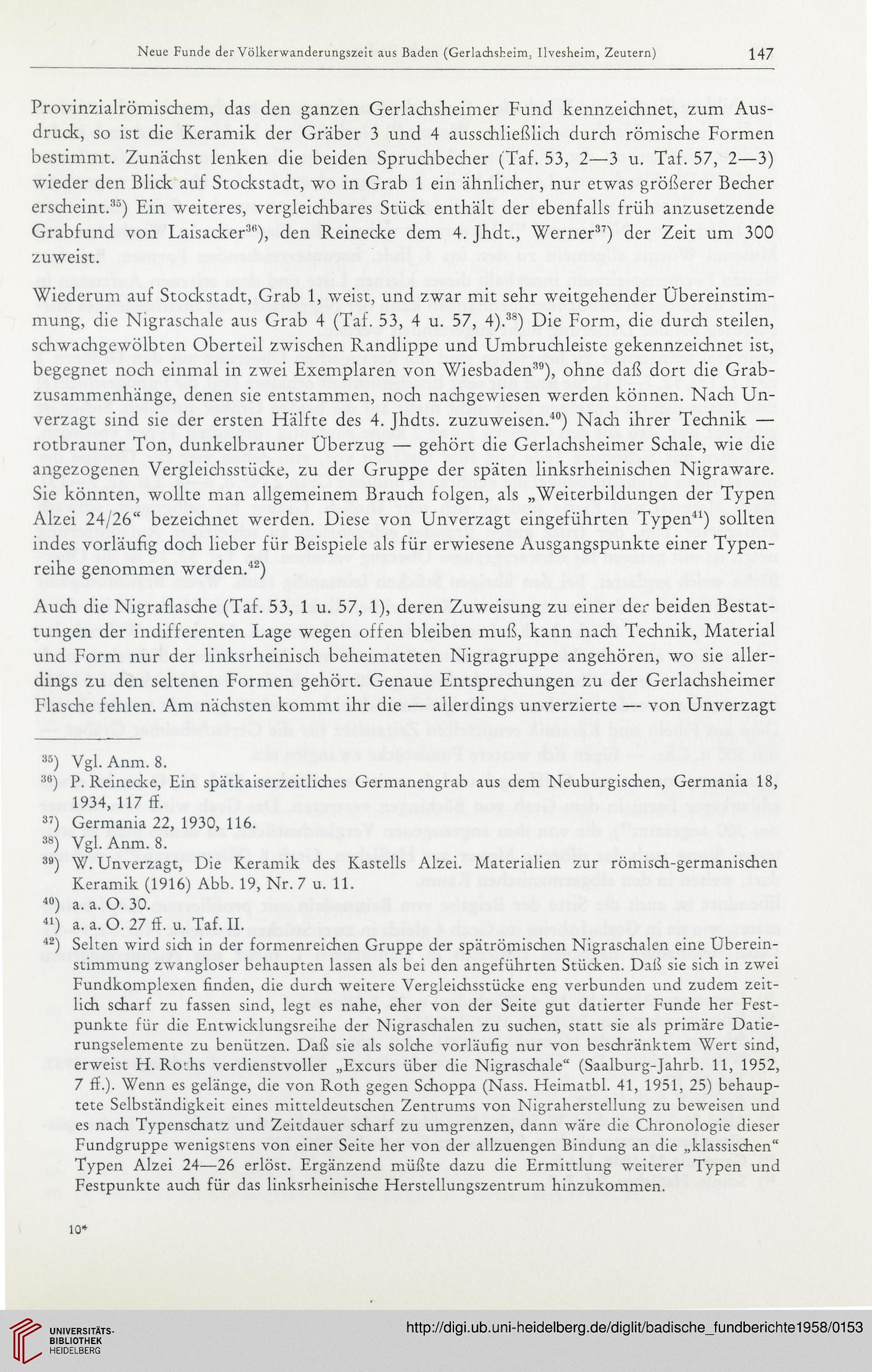Neue Funde der Völkerwanderungszeit aus Baden (Gerladisheim, Ilvesheim, Zeutern)
147
Provinzialrömischem, das den ganzen Gerlachsheimer Fund kennzeichnet, zum Aus-
druck, so ist die Keramik der Gräber 3 und 4 ausschließlich durch römische Formen
bestimmt. Zunächst lenken die beiden Spruchbecher (Taf. 53, 2—3 u. Taf. 57, 2—3)
wieder den Blick auf Stockstadt, wo in Grab 1 ein ähnlicher, nur etwas größerer Becher
erscheint.* 30) Ein weiteres, vergleichbares Stück enthält der ebenfalls früh anzusetzende
Grabfund von Laisacker30 * * * * *), den Reinecke dem 4. Jhdt., Werner37) der Zeit um 300
zuweist.
Wiederum auf Stockstadt, Grab 1, weist, und zwar mit sehr weitgehender Übereinstim-
mung, die Nigraschale aus Grab 4 (Taf. 53, 4 u. 57, 4).38) Die Form, die durch steilen,
schwachgewölbten Oberteil zwischen Randlippe und Umbruchleiste gekennzeichnet ist,
begegnet noch einmal in zwei Exemplaren von Wiesbaden39), ohne daß dort die Grab-
zusammenhänge, denen sie entstammen, noch nachgewiesen werden können. Nach Un-
verzagt sind sie der ersten Hälfte des 4. Jhdts. zuzuweisen.40) Nadi ihrer Technik —
rotbrauner Ton, dunkelbrauner Überzug — gehört die Gerlachsheimer Schale, wie die
angezogenen Vergleichsstücke, zu der Gruppe der späten linksrheinischen Nigraware.
Sie könnten, wollte man allgemeinem Brauch folgen, als „Weiterbildungen der Typen
Alzei 24/26“ bezeichnet werden. Diese von Unverzagt eingeführten Typen41) sollten
indes vorläufig doch lieber für Beispiele als für erwiesene Ausgangspunkte einer Typen-
reihe genommen werden.42)
Auch die Nigraflasche (Taf. 53, 1 u. 57, 1), deren Zuweisung zu einer der beiden Bestat-
tungen der indifferenten Lage wegen offen bleiben muß, kann nach Technik, Material
und Form nur der linksrheinisch beheimateten Nigragruppe angehören, wo sie aller-
dings zu den seltenen Formen gehört. Genaue Entsprechungen zu der Gerlachsheimer
Flasche fehlen. Am nächsten kommt ihr die — allerdings unverzierte — von Unverzagt
35) Vgl. Anm. 8.
30) P. Reinecke, Ein spätkaiserzeitliches Germanengrab aus dem Neuburgischen, Germania 18,
1934,117 ff.
37) Germania 22, 1930, 116.
38) Vgl. Anm. 8.
39) W. Unverzagt, Die Keramik des Kastells Alzei. Materialien zur römisch-germanischen
Keramik (1916) Abb. 19, Nr. 7 u. 11.
40) a. a. O. 30.
41) a. a. O. 27 ff. u. Taf. II.
42) Selten wird sich in der formenreichen Gruppe der spätrömischen Nigraschalen eine Überein¬
stimmung zwangloser behaupten lassen als bei den angeführten Stücken. Daß sie sich in zwei
Fundkomplexen finden, die durch weitere Vergleichsstücke eng verbunden und zudem zeit¬
lich scharf zu fassen sind, legt es nahe, eher von der Seite gut datierter Funde her Fest-
punkte für die Entwicklungsreihe der Nigraschalen zu suchen, statt sie als primäre Datie-
rungselemente zu benützen. Daß sie als solche vorläufig nur von beschränktem Wert sind,
erweist H. Roths verdienstvoller „Excurs über die Nigraschale“ (Saalburg-Jahrb. 11, 1952,
7 ff.). Wenn es gelänge, die von Roth gegen Schoppa (Nass. Heimatbl. 41, 1951, 25) behaup-
tete Selbständigkeit eines mitteldeutschen Zentrums von Nigraherstellung zu beweisen und
es nach Typenschatz und Zeitdauer scharf zu umgrenzen, dann wäre die Chronologie dieser
Fundgruppe wenigstens von einer Seite her von der allzuengen Bindung an die „klassischen“
Typen Alzei 24—26 erlöst. Ergänzend müßte dazu die Ermittlung weiterer Typen und
Festpunkte auch für das linksrheinische Herstellungszentrum hinzukommen.
10*
147
Provinzialrömischem, das den ganzen Gerlachsheimer Fund kennzeichnet, zum Aus-
druck, so ist die Keramik der Gräber 3 und 4 ausschließlich durch römische Formen
bestimmt. Zunächst lenken die beiden Spruchbecher (Taf. 53, 2—3 u. Taf. 57, 2—3)
wieder den Blick auf Stockstadt, wo in Grab 1 ein ähnlicher, nur etwas größerer Becher
erscheint.* 30) Ein weiteres, vergleichbares Stück enthält der ebenfalls früh anzusetzende
Grabfund von Laisacker30 * * * * *), den Reinecke dem 4. Jhdt., Werner37) der Zeit um 300
zuweist.
Wiederum auf Stockstadt, Grab 1, weist, und zwar mit sehr weitgehender Übereinstim-
mung, die Nigraschale aus Grab 4 (Taf. 53, 4 u. 57, 4).38) Die Form, die durch steilen,
schwachgewölbten Oberteil zwischen Randlippe und Umbruchleiste gekennzeichnet ist,
begegnet noch einmal in zwei Exemplaren von Wiesbaden39), ohne daß dort die Grab-
zusammenhänge, denen sie entstammen, noch nachgewiesen werden können. Nach Un-
verzagt sind sie der ersten Hälfte des 4. Jhdts. zuzuweisen.40) Nadi ihrer Technik —
rotbrauner Ton, dunkelbrauner Überzug — gehört die Gerlachsheimer Schale, wie die
angezogenen Vergleichsstücke, zu der Gruppe der späten linksrheinischen Nigraware.
Sie könnten, wollte man allgemeinem Brauch folgen, als „Weiterbildungen der Typen
Alzei 24/26“ bezeichnet werden. Diese von Unverzagt eingeführten Typen41) sollten
indes vorläufig doch lieber für Beispiele als für erwiesene Ausgangspunkte einer Typen-
reihe genommen werden.42)
Auch die Nigraflasche (Taf. 53, 1 u. 57, 1), deren Zuweisung zu einer der beiden Bestat-
tungen der indifferenten Lage wegen offen bleiben muß, kann nach Technik, Material
und Form nur der linksrheinisch beheimateten Nigragruppe angehören, wo sie aller-
dings zu den seltenen Formen gehört. Genaue Entsprechungen zu der Gerlachsheimer
Flasche fehlen. Am nächsten kommt ihr die — allerdings unverzierte — von Unverzagt
35) Vgl. Anm. 8.
30) P. Reinecke, Ein spätkaiserzeitliches Germanengrab aus dem Neuburgischen, Germania 18,
1934,117 ff.
37) Germania 22, 1930, 116.
38) Vgl. Anm. 8.
39) W. Unverzagt, Die Keramik des Kastells Alzei. Materialien zur römisch-germanischen
Keramik (1916) Abb. 19, Nr. 7 u. 11.
40) a. a. O. 30.
41) a. a. O. 27 ff. u. Taf. II.
42) Selten wird sich in der formenreichen Gruppe der spätrömischen Nigraschalen eine Überein¬
stimmung zwangloser behaupten lassen als bei den angeführten Stücken. Daß sie sich in zwei
Fundkomplexen finden, die durch weitere Vergleichsstücke eng verbunden und zudem zeit¬
lich scharf zu fassen sind, legt es nahe, eher von der Seite gut datierter Funde her Fest-
punkte für die Entwicklungsreihe der Nigraschalen zu suchen, statt sie als primäre Datie-
rungselemente zu benützen. Daß sie als solche vorläufig nur von beschränktem Wert sind,
erweist H. Roths verdienstvoller „Excurs über die Nigraschale“ (Saalburg-Jahrb. 11, 1952,
7 ff.). Wenn es gelänge, die von Roth gegen Schoppa (Nass. Heimatbl. 41, 1951, 25) behaup-
tete Selbständigkeit eines mitteldeutschen Zentrums von Nigraherstellung zu beweisen und
es nach Typenschatz und Zeitdauer scharf zu umgrenzen, dann wäre die Chronologie dieser
Fundgruppe wenigstens von einer Seite her von der allzuengen Bindung an die „klassischen“
Typen Alzei 24—26 erlöst. Ergänzend müßte dazu die Ermittlung weiterer Typen und
Festpunkte auch für das linksrheinische Herstellungszentrum hinzukommen.
10*