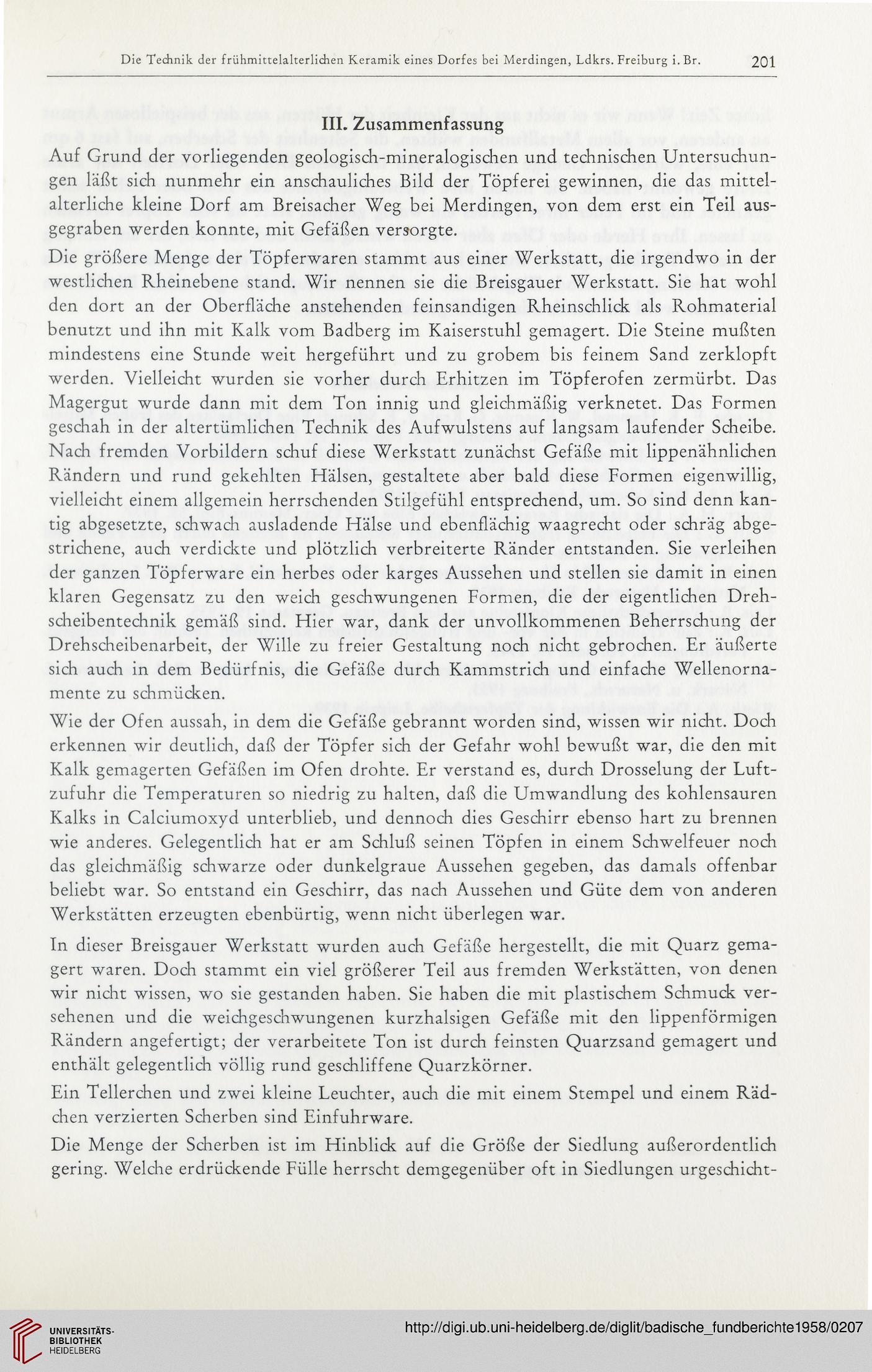Die Technik der frühmittelalterlichen Keramik eines Dorfes bei Merdingen, Ldkrs. Freiburg i.Br.
201
III. Zusammenfassung
Auf Grund der vorliegenden geologisch-mineralogischen und technischen Untersuchun-
gen läßt sich nunmehr ein anschauliches Bild der Töpferei gewinnen, die das mittel-
alterliche kleine Dorf am Breisacher Weg bei Merdingen, von dem erst ein Teil aus-
gegraben werden konnte, mit Gefäßen versorgte.
Die größere Menge der Töpferwaren stammt aus einer Werkstatt, die irgendwo in der
westlichen Rheinebene stand. Wir nennen sie die Breisgauer Werkstatt. Sie hat wohl
den dort an der Oberfläche anstehenden feinsandigen Rheinschlick als Rohmaterial
benutzt und ihn mit Kalk vom Badberg im Kaiserstuhl gemagert. Die Steine mußten
mindestens eine Stunde weit hergeführt und zu grobem bis feinem Sand zerklopft
werden. Vielleicht wurden sie vorher durch Erhitzen im Töpferofen zermürbt. Das
Magergut wurde dann mit dem Ton innig und gleichmäßig verknetet. Das Formen
geschah in der altertümlichen Technik des Aufwulstens auf langsam laufender Scheibe.
Nach fremden Vorbildern schuf diese Werkstatt zunächst Gefäße mit lippenähnlichen
Rändern und rund gekehlten Hälsen, gestaltete aber bald diese Formen eigenwillig,
vielleicht einem allgemein herrschenden Stilgefühl entsprechend, um. So sind denn kan-
tig abgesetzte, schwach ausladende Hälse und ebenflächig waagrecht oder schräg abge-
strichene, auch verdickte und plötzlich verbreiterte Ränder entstanden. Sie verleihen
der ganzen Töpferware ein herbes oder karges Aussehen und stellen sie damit in einen
klaren Gegensatz zu den weich geschwungenen Formen, die der eigentlichen Dreh-
scheibentechnik gemäß sind. Hier war, dank der unvollkommenen Beherrschung der
Drehscheibenarbeit, der Wille zu freier Gestaltung noch nicht gebrochen. Er äußerte
sich auch in dem Bedürfnis, die Gefäße durch Kammstrich und einfache Wellenorna-
mente zu schmücken.
Wie der Ofen aussah, in dem die Gefäße gebrannt worden sind, wissen wir nicht. Doch
erkennen wir deutlich, daß der Töpfer sich der Gefahr wohl bewußt war, die den mit
Kalk gemagerten Gefäßen im Ofen drohte. Er verstand es, durch Drosselung der Luft-
zufuhr die Temperaturen so niedrig zu halten, daß die Umwandlung des kohlensauren
Kalks in Calciumoxyd unterblieb, und dennoch dies Geschirr ebenso hart zu brennen
wie anderes. Gelegentlich hat er am Schluß seinen Töpfen in einem Schwelfeuer noch
das gleichmäßig schwarze oder dunkelgraue Aussehen gegeben, das damals offenbar
beliebt war. So entstand ein Geschirr, das nach Aussehen und Güte dem von anderen
Werkstätten erzeugten ebenbürtig, wenn nicht überlegen war.
In dieser Breisgauer Werkstatt wurden auch Gefäße hergestellt, die mit Quarz gema-
gert waren. Doch stammt ein viel größerer Teil aus fremden Werkstätten, von denen
wir nicht wissen, wo sie gestanden haben. Sie haben die mit plastischem Schmuck ver-
sehenen und die weichgeschwungenen kurzhalsigen Gefäße mit den lippenförmigen
Rändern angefertigt; der verarbeitete Ton ist durch feinsten Quarzsand gemagert und
enthält gelegentlich völlig rund geschliffene Quarzkörner.
Ein Teilerchen und zwei kleine Leuchter, auch die mit einem Stempel und einem Räd-
chen verzierten Scherben sind Einfuhrware.
Die Menge der Scherben ist im Hinblick auf die Größe der Siedlung außerordentlich
gering. Welche erdrückende Fülle herrscht demgegenüber oft in Siedlungen urgeschicht-
201
III. Zusammenfassung
Auf Grund der vorliegenden geologisch-mineralogischen und technischen Untersuchun-
gen läßt sich nunmehr ein anschauliches Bild der Töpferei gewinnen, die das mittel-
alterliche kleine Dorf am Breisacher Weg bei Merdingen, von dem erst ein Teil aus-
gegraben werden konnte, mit Gefäßen versorgte.
Die größere Menge der Töpferwaren stammt aus einer Werkstatt, die irgendwo in der
westlichen Rheinebene stand. Wir nennen sie die Breisgauer Werkstatt. Sie hat wohl
den dort an der Oberfläche anstehenden feinsandigen Rheinschlick als Rohmaterial
benutzt und ihn mit Kalk vom Badberg im Kaiserstuhl gemagert. Die Steine mußten
mindestens eine Stunde weit hergeführt und zu grobem bis feinem Sand zerklopft
werden. Vielleicht wurden sie vorher durch Erhitzen im Töpferofen zermürbt. Das
Magergut wurde dann mit dem Ton innig und gleichmäßig verknetet. Das Formen
geschah in der altertümlichen Technik des Aufwulstens auf langsam laufender Scheibe.
Nach fremden Vorbildern schuf diese Werkstatt zunächst Gefäße mit lippenähnlichen
Rändern und rund gekehlten Hälsen, gestaltete aber bald diese Formen eigenwillig,
vielleicht einem allgemein herrschenden Stilgefühl entsprechend, um. So sind denn kan-
tig abgesetzte, schwach ausladende Hälse und ebenflächig waagrecht oder schräg abge-
strichene, auch verdickte und plötzlich verbreiterte Ränder entstanden. Sie verleihen
der ganzen Töpferware ein herbes oder karges Aussehen und stellen sie damit in einen
klaren Gegensatz zu den weich geschwungenen Formen, die der eigentlichen Dreh-
scheibentechnik gemäß sind. Hier war, dank der unvollkommenen Beherrschung der
Drehscheibenarbeit, der Wille zu freier Gestaltung noch nicht gebrochen. Er äußerte
sich auch in dem Bedürfnis, die Gefäße durch Kammstrich und einfache Wellenorna-
mente zu schmücken.
Wie der Ofen aussah, in dem die Gefäße gebrannt worden sind, wissen wir nicht. Doch
erkennen wir deutlich, daß der Töpfer sich der Gefahr wohl bewußt war, die den mit
Kalk gemagerten Gefäßen im Ofen drohte. Er verstand es, durch Drosselung der Luft-
zufuhr die Temperaturen so niedrig zu halten, daß die Umwandlung des kohlensauren
Kalks in Calciumoxyd unterblieb, und dennoch dies Geschirr ebenso hart zu brennen
wie anderes. Gelegentlich hat er am Schluß seinen Töpfen in einem Schwelfeuer noch
das gleichmäßig schwarze oder dunkelgraue Aussehen gegeben, das damals offenbar
beliebt war. So entstand ein Geschirr, das nach Aussehen und Güte dem von anderen
Werkstätten erzeugten ebenbürtig, wenn nicht überlegen war.
In dieser Breisgauer Werkstatt wurden auch Gefäße hergestellt, die mit Quarz gema-
gert waren. Doch stammt ein viel größerer Teil aus fremden Werkstätten, von denen
wir nicht wissen, wo sie gestanden haben. Sie haben die mit plastischem Schmuck ver-
sehenen und die weichgeschwungenen kurzhalsigen Gefäße mit den lippenförmigen
Rändern angefertigt; der verarbeitete Ton ist durch feinsten Quarzsand gemagert und
enthält gelegentlich völlig rund geschliffene Quarzkörner.
Ein Teilerchen und zwei kleine Leuchter, auch die mit einem Stempel und einem Räd-
chen verzierten Scherben sind Einfuhrware.
Die Menge der Scherben ist im Hinblick auf die Größe der Siedlung außerordentlich
gering. Welche erdrückende Fülle herrscht demgegenüber oft in Siedlungen urgeschicht-