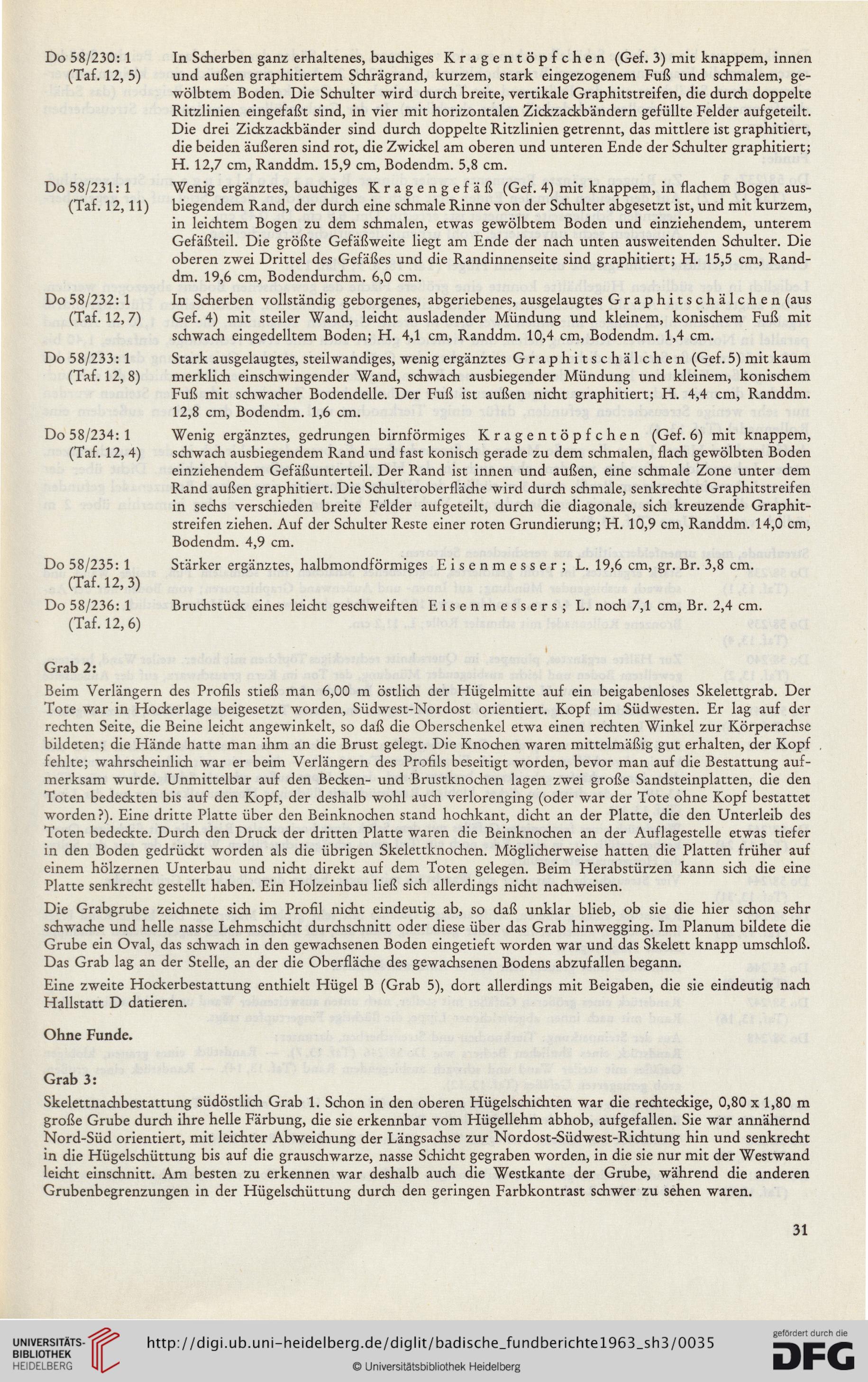Do 58/230: 1
(Taf. 12, 5)
Do 58/231: 1
(Taf. 12,11)
Do 58/232: 1
(Taf. 12, 7)
Do 58/233: 1
(Taf. 12, 8)
Do 58/234: 1
(Taf. 12, 4)
Do 58/235: 1
(Taf. 12, 3)
Do 58/236: 1
(Taf. 12, 6)
In Scherben ganz erhaltenes, bauchiges Kragentöpfchen (Gef. 3) mit knappem, innen
und außen graphitiertem Schrägrand, kurzem, stark eingezogenem Fuß und schmalem, ge-
wölbtem Boden. Die Schulter wird durch breite, vertikale Graphitstreifen, die durch doppelte
Ritzlinien eingefaßt sind, in vier mit horizontalen Zickzackbändern gefüllte Felder aufgeteilt.
Die drei Zickzackbänder sind durch doppelte Ritzlinien getrennt, das mittlere ist graphitiert,
die beiden äußeren sind rot, die Zwickel am oberen und unteren Ende der Schulter graphitiert;
H. 12,7 cm, Randdm. 15,9 cm, Bodendm. 5,8 cm.
Wenig ergänztes, bauchiges Kragengefäß (Gef. 4) mit knappem, in flachem Bogen aus-
biegendem Rand, der durch eine schmale Rinne von der Schulter abgesetzt ist, und mit kurzem,
in leichtem Bogen zu dem schmalen, etwas gewölbtem Boden und einziehendem, unterem
Gefäßteil. Die größte Gefäßweite liegt am Ende der nach unten ausweitenden Schulter. Die
oberen zwei Drittel des Gefäßes und die Randinnenseite sind graphitiert; H. 15,5 cm, Rand-
dm. 19,6 cm, Bodendurchm. 6,0 cm.
In Scherben vollständig geborgenes, abgeriebenes, ausgelaugtes Graphitschälchen (aus
Gef. 4) mit steiler Wand, leicht ausladender Mündung und kleinem, konischem Fuß mit
schwach eingedelltem Boden; H. 4,1 cm, Randdm. 10,4 cm, Bodendm. 1,4 cm.
Stark ausgelaugtes, steilwandiges, wenig ergänztes Graphitschälchen (Gef. 5) mit kaum
merklich einschwingender Wand, schwach ausbiegender Mündung und kleinem, konischem
Fuß mit schwacher Bodendelle. Der Fuß ist außen nicht graphitiert; H. 4,4 cm, Randdm.
12,8 cm, Bodendm. 1,6 cm.
Wenig ergänztes, gedrungen bimförmiges Kragentöpfchen (Gef. 6) mit knappem,
schwach ausbiegendem Rand und fast konisch gerade zu dem schmalen, flach gewölbten Boden
einziehendem Gefäßunterteil. Der Rand ist innen und außen, eine schmale Zone unter dem
Rand außen graphitiert. Die Schulteroberfläche wird durch schmale, senkrechte Graphitstreifen
in sechs verschieden breite Felder aufgeteilt, durch die diagonale, sich kreuzende Graphit-
streifen ziehen. Auf der Schulter Reste einer roten Grundierung; H. 10,9 cm, Randdm. 14,0 cm,
Bodendm. 4,9 cm.
Stärker ergänztes, halbmondförmiges Eisenmesser; L. 19,6 cm, gr. Br. 3,8 cm.
Bruchstück eines leicht geschweiften Eisenmessers; L. noch 7,1 cm, Br. 2,4 cm.
Grab 2:
Beim Verlängern des Profils stieß man 6,00 m östlich der Hügelmitte auf ein beigabenloses Skelettgrab. Der
Tote war in Hockerlage beigesetzt worden, Südwest-Nordost orientiert. Kopf im Südwesten. Er lag auf der
rechten Seite, die Beine leicht angewinkelt, so daß die Oberschenkel etwa einen rechten Winkel zur Körperachse
bildeten; die Hände hatte man ihm an die Brust gelegt. Die Knochen waren mittelmäßig gut erhalten, der Kopf
fehlte; wahrscheinlich war er beim Verlängern des Profils beseitigt worden, bevor man auf die Bestattung auf-
merksam wurde. Unmittelbar auf den Becken- und Brustknochen lagen zwei große Sandsteinplatten, die den
Toten bedeckten bis auf den Kopf, der deshalb wohl auch verlorenging (oder war der Tote ohne Kopf bestattet
worden?). Eine dritte Platte über den Beinknochen stand hochkant, dicht an der Platte, die den Unterleib des
Toten bedeckte. Durch den Druck der dritten Platte waren die Beinknochen an der Auflagestelle etwas tiefer
in den Boden gedrückt worden als die übrigen Skelettknochen. Möglicherweise hatten die Platten früher auf
einem hölzernen Unterbau und nicht direkt auf dem Toten gelegen. Beim Herabstürzen kann sich die eine
Platte senkrecht gestellt haben. Ein Holzeinbau ließ sich allerdings nicht nachweisen.
Die Grabgrube zeichnete sich im Profil nicht eindeutig ab, so daß unklar blieb, ob sie die hier schon sehr
schwache und helle nasse Lehmschicht durchschnitt oder diese über das Grab hinwegging. Im Planum bildete die
Grube ein Oval, das schwach in den gewachsenen Boden eingetieft worden war und das Skelett knapp umschloß.
Das Grab lag an der Stelle, an der die Oberfläche des gewachsenen Bodens abzufallen begann.
Eine zweite Hockerbestattung enthielt Hügel B (Grab 5), dort allerdings mit Beigaben, die sie eindeutig nach
Hallstatt D datieren.
Ohne Funde.
Grab 3:
Skelettnachbestattung südöstlich Grab 1. Schon in den oberen Hügelschichten war die rechteckige, 0,80 x 1,80 m
große Grube durch ihre helle Färbung, die sie erkennbar vom Hügellehm abhob, aufgefallen. Sie war annähernd
Nord-Süd orientiert, mit leichter Abweichung der Längsachse zur Nordost-Südwest-Richtung hin und senkrecht
in die Hügelschüttung bis auf die grauschwarze, nasse Schicht gegraben worden, in die sie nur mit der Westwand
leicht einschnitt. Am besten zu erkennen war deshalb auch die Westkante der Grube, während die anderen
Grubenbegrenzungen in der Hügelschüttung durch den geringen Farbkontrast schwer zu sehen waren.
31
(Taf. 12, 5)
Do 58/231: 1
(Taf. 12,11)
Do 58/232: 1
(Taf. 12, 7)
Do 58/233: 1
(Taf. 12, 8)
Do 58/234: 1
(Taf. 12, 4)
Do 58/235: 1
(Taf. 12, 3)
Do 58/236: 1
(Taf. 12, 6)
In Scherben ganz erhaltenes, bauchiges Kragentöpfchen (Gef. 3) mit knappem, innen
und außen graphitiertem Schrägrand, kurzem, stark eingezogenem Fuß und schmalem, ge-
wölbtem Boden. Die Schulter wird durch breite, vertikale Graphitstreifen, die durch doppelte
Ritzlinien eingefaßt sind, in vier mit horizontalen Zickzackbändern gefüllte Felder aufgeteilt.
Die drei Zickzackbänder sind durch doppelte Ritzlinien getrennt, das mittlere ist graphitiert,
die beiden äußeren sind rot, die Zwickel am oberen und unteren Ende der Schulter graphitiert;
H. 12,7 cm, Randdm. 15,9 cm, Bodendm. 5,8 cm.
Wenig ergänztes, bauchiges Kragengefäß (Gef. 4) mit knappem, in flachem Bogen aus-
biegendem Rand, der durch eine schmale Rinne von der Schulter abgesetzt ist, und mit kurzem,
in leichtem Bogen zu dem schmalen, etwas gewölbtem Boden und einziehendem, unterem
Gefäßteil. Die größte Gefäßweite liegt am Ende der nach unten ausweitenden Schulter. Die
oberen zwei Drittel des Gefäßes und die Randinnenseite sind graphitiert; H. 15,5 cm, Rand-
dm. 19,6 cm, Bodendurchm. 6,0 cm.
In Scherben vollständig geborgenes, abgeriebenes, ausgelaugtes Graphitschälchen (aus
Gef. 4) mit steiler Wand, leicht ausladender Mündung und kleinem, konischem Fuß mit
schwach eingedelltem Boden; H. 4,1 cm, Randdm. 10,4 cm, Bodendm. 1,4 cm.
Stark ausgelaugtes, steilwandiges, wenig ergänztes Graphitschälchen (Gef. 5) mit kaum
merklich einschwingender Wand, schwach ausbiegender Mündung und kleinem, konischem
Fuß mit schwacher Bodendelle. Der Fuß ist außen nicht graphitiert; H. 4,4 cm, Randdm.
12,8 cm, Bodendm. 1,6 cm.
Wenig ergänztes, gedrungen bimförmiges Kragentöpfchen (Gef. 6) mit knappem,
schwach ausbiegendem Rand und fast konisch gerade zu dem schmalen, flach gewölbten Boden
einziehendem Gefäßunterteil. Der Rand ist innen und außen, eine schmale Zone unter dem
Rand außen graphitiert. Die Schulteroberfläche wird durch schmale, senkrechte Graphitstreifen
in sechs verschieden breite Felder aufgeteilt, durch die diagonale, sich kreuzende Graphit-
streifen ziehen. Auf der Schulter Reste einer roten Grundierung; H. 10,9 cm, Randdm. 14,0 cm,
Bodendm. 4,9 cm.
Stärker ergänztes, halbmondförmiges Eisenmesser; L. 19,6 cm, gr. Br. 3,8 cm.
Bruchstück eines leicht geschweiften Eisenmessers; L. noch 7,1 cm, Br. 2,4 cm.
Grab 2:
Beim Verlängern des Profils stieß man 6,00 m östlich der Hügelmitte auf ein beigabenloses Skelettgrab. Der
Tote war in Hockerlage beigesetzt worden, Südwest-Nordost orientiert. Kopf im Südwesten. Er lag auf der
rechten Seite, die Beine leicht angewinkelt, so daß die Oberschenkel etwa einen rechten Winkel zur Körperachse
bildeten; die Hände hatte man ihm an die Brust gelegt. Die Knochen waren mittelmäßig gut erhalten, der Kopf
fehlte; wahrscheinlich war er beim Verlängern des Profils beseitigt worden, bevor man auf die Bestattung auf-
merksam wurde. Unmittelbar auf den Becken- und Brustknochen lagen zwei große Sandsteinplatten, die den
Toten bedeckten bis auf den Kopf, der deshalb wohl auch verlorenging (oder war der Tote ohne Kopf bestattet
worden?). Eine dritte Platte über den Beinknochen stand hochkant, dicht an der Platte, die den Unterleib des
Toten bedeckte. Durch den Druck der dritten Platte waren die Beinknochen an der Auflagestelle etwas tiefer
in den Boden gedrückt worden als die übrigen Skelettknochen. Möglicherweise hatten die Platten früher auf
einem hölzernen Unterbau und nicht direkt auf dem Toten gelegen. Beim Herabstürzen kann sich die eine
Platte senkrecht gestellt haben. Ein Holzeinbau ließ sich allerdings nicht nachweisen.
Die Grabgrube zeichnete sich im Profil nicht eindeutig ab, so daß unklar blieb, ob sie die hier schon sehr
schwache und helle nasse Lehmschicht durchschnitt oder diese über das Grab hinwegging. Im Planum bildete die
Grube ein Oval, das schwach in den gewachsenen Boden eingetieft worden war und das Skelett knapp umschloß.
Das Grab lag an der Stelle, an der die Oberfläche des gewachsenen Bodens abzufallen begann.
Eine zweite Hockerbestattung enthielt Hügel B (Grab 5), dort allerdings mit Beigaben, die sie eindeutig nach
Hallstatt D datieren.
Ohne Funde.
Grab 3:
Skelettnachbestattung südöstlich Grab 1. Schon in den oberen Hügelschichten war die rechteckige, 0,80 x 1,80 m
große Grube durch ihre helle Färbung, die sie erkennbar vom Hügellehm abhob, aufgefallen. Sie war annähernd
Nord-Süd orientiert, mit leichter Abweichung der Längsachse zur Nordost-Südwest-Richtung hin und senkrecht
in die Hügelschüttung bis auf die grauschwarze, nasse Schicht gegraben worden, in die sie nur mit der Westwand
leicht einschnitt. Am besten zu erkennen war deshalb auch die Westkante der Grube, während die anderen
Grubenbegrenzungen in der Hügelschüttung durch den geringen Farbkontrast schwer zu sehen waren.
31