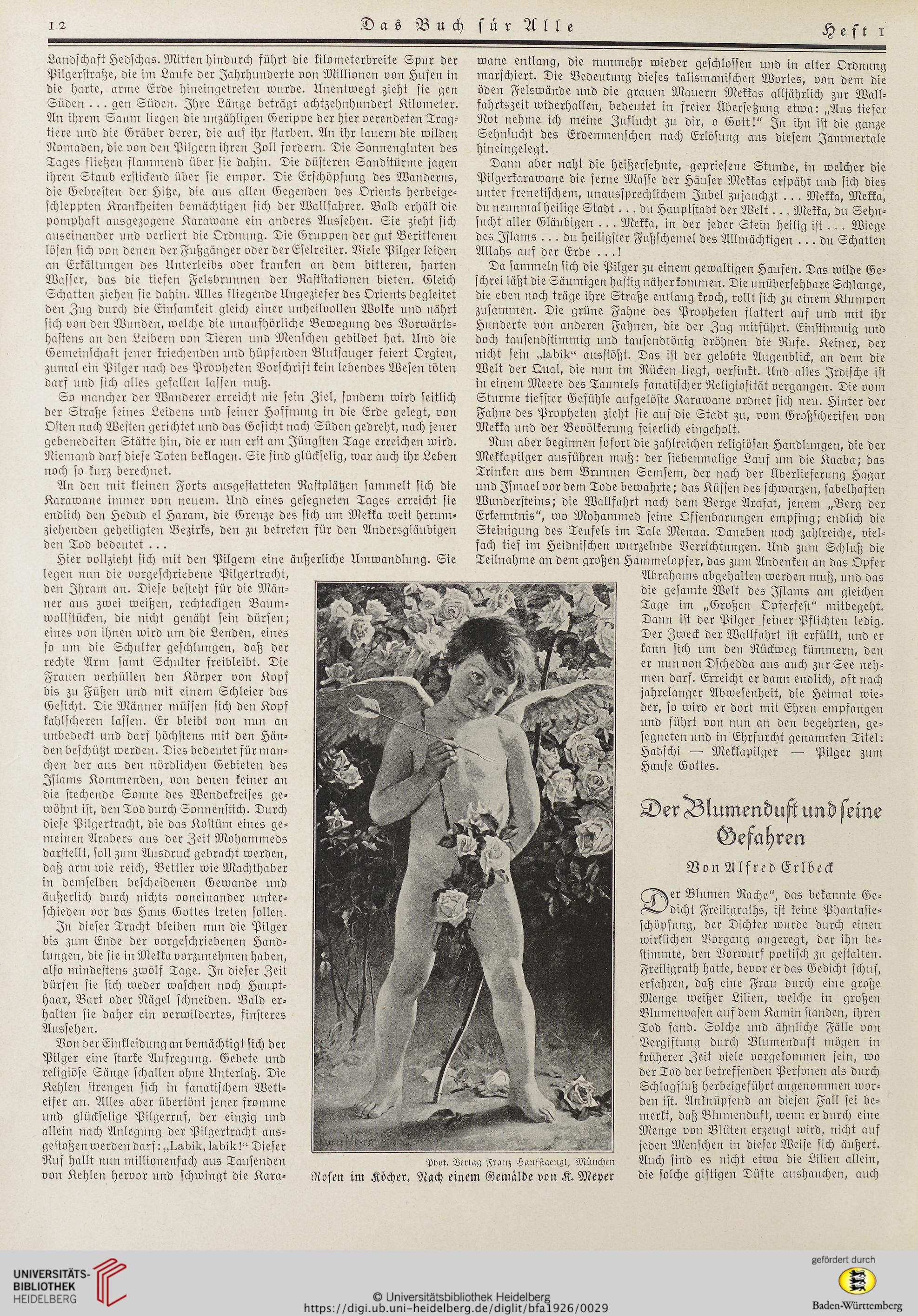1 2 Da s B u < f ür Alle
Hefti 1
Landſchaft Hedſchas. Mitten hindurch führt die kilometerbreite Spur der
Pilgerſtraße, die im Laufe der Jahrhunderte von Millionen von Hufen in
die harte, arme Erde hineingetreten wurde. Unentwegt zieht sie gen
Süden ... gen Süden. Ihre Länge beträgt achtzehnhundert Kilometer.
An ihrem Saum. liegen die unzähligen Gerippe der hier verendeten Trag-
tiere und die Gräber derer, die auf ihr ſtarben. An ihr lauern die wilden
Nomaden, die von den Pilgern ihren Zoll fordern. Die Sonnengluten des
Tages fließen flammend über ſie dahin. Die düſteren Sandſtürme jagen
ihren Staub erſtickend über ſie empor. Die Erſchöpfung des Wanderns,
die Gebreſten der Hitze, die aus allen Gegenden des Orients herbeige-
ſchleppten Krankheiten bemächtigen sich der Wallfahrer. Bald erhält die
pomphaft ausgezogene Karawane ein anderes Aussehen. Sie zieht ſich
auseinander und verliert die Ordnung. Die Gruppen der gut Berittenen
löſen ſich von denen der Fußgänger oder der Eſelreiter. Viele Pilger leiden
an Erkältungen des Unterleibs oder kranken an dem bitteren, harten
Walſſer, das die tiefen Felsbrunnen der Raſtſtationen bieten. Gleich
Schatten ziehen Jie dahin. Alles fliegende Ungeziefer des Orients begleitet
den Zug durch die Einsamkeit gleich einer unheilvollen Wolke und nährt
ſich von den Wunden, welche die unaufhörliche Bewegung des Vorwärts-
haſtens an den Leibern von Tieren und Menſchen gebildet hat. Und die
Gemeinſchaft jener kriechenden und hüpfenden Blutſauger feiert Orgien,
zumal ein Pilger nach des Propheten Vorschrift kein lebendes Wesen töten
darf und ſJich alles gefallen laſſen muß.
So mancher der Wanderer erreicht nie sein Ziel, sondern wird seitlich
der Straße seines Leidens und seiner Hoffnung in die Erde gelegt, von
Osten nach Westen gerichtet und das Gesicht nach Süden gedreht, nach jener
gebenedeiten Stätte hin, die er nun erſt am Jüngſten Tage erreichen wird.
Niemand darf dieſe Toten beklagen. Sie ſind glückselig, war auch ihr Leben
noch so kurz berechnet.
An den mit kleinen Forts ausgeſtatteten Raſtplätzen ſammelt ich die
Karawane immer von neuem. Und eines gesegneten Tages erreicht ſie
endlich den Hedud el Haram, die Grenze des ſich um Mekka weit herum-
ziehenden geheiligten Bezirks, den zu betreten für den Andersgläubigen
den Tod bédeutet . . .
Hier vollzieht ſich mit den Pilgern eine äußerliche Umwandlung. Sie
legen nun die vorgeschriebene Pilgertracht,
den Ihram an. Diese besteht für die Män-
ner aus zwei weißen, rechteckigen Baum-
wollstücken, die nicht genäht ſein dürfen;
eines von ihnen wird um die Lenden, eines
ſo um die Schulter geſchlungen, daß der
rechte Arm samt Schulter freibleibt. Die
Frauen verhüllen den Körper von Kopf
bis zu Füßen und mit einem Schleier das
Gesicht. Die Männer müsſen Jich den Kopf
kahlſcheren laſſen. Er bleibt von nun an
unbedeckt und darf höchſtens mit den Hänun
den beſchützt werden. Dies bedeutet für man-
chen der aus den nördlichen Gebieten des
Iſlams Kommenden, von denen keiner an
die ſtechende Sonne des Wendektreiſes ge-
wöhnt iſt, den Tod durch Sonnenſtich. Durch
dieſe Pilgertracht, die das Koſtüm eines ge-
meinen Arabers aus der Zeit Mohammeds
darſtellt, ſoll zum Ausdruck gebracht werden,
daß arm wie reich, Bettler wie Machthaber
in demſelben beſcheidenen Gewande und
äußerlich durch nichts voneinander unter-
ſchieden vor das Haus Gottes treten sollen.
In dieser Tracht bleiben nun die Pilger
bis zum Ende der vorgeſchriebenen Hand-
lungen, die ſie in Mekka vorzunehmen haben,
alſo mindestens zwölf Tage. In dieser Zeit
dürfen sie ſich weder waſchen noch Haupt-
haar, Bart oder Nägel ſchneiden. Bald er-
halten Jie daher ein verwildertes, finſteres
Aussehen.
Von der Einkleidung an bemächtigt ich der
Pilger eine ſtarke Aufregung. Gebete und
religiöſe Sänge ſchallen ohne Unterlaß. Die
Kehlen strengen ſich in fanatiſchem Wett-
eifer an. Alles aber übertönt jener fromme
und glückſelige Pilgerruf, der einzig und
allein nach Anlegung der Pilgertracht aus-
geſtoßen werden darf: „Labik, labik !“ Dieser
Ruf hallt nun millionenfach aus Tauſenden
von Kehlen hervor und ſchwingt die Kara-
P Verlag Franz Hanfstaengl, München
Rosen im Köcher. Nach einem Gemälde von K. Meper
wane entlang, die nunmehr wieder geschlossen und in alter Ordnung
marſchiert. Die Bedeutung dieses talismanischen Wortes, von dem die
öden Felswände und die grauen Mauern Mekkas alljährlich zur Wall-
fahrtszeit widerhallen, bedeutet in freier Überſeßzung etwa: „Aus tiefer
Not nehme ich meine Zuflucht zu dir, o Gott!" In ihn iſt die ganze
g stadt “tt Erdenmenſchen nach Erlöſung aus diesem Jammertale
ineingelegt. ;
Dann aber naht die heißerſehnte, gepriesene Stunde, in welcher die
Pilgerkarawane die ferne Masse der Häuser Mekkas erſpäht und Jich dies
unter frenetiſchem, unausſprechlichem Jubel zujauchzt . .. Mekka, Mekka,
duneunmalheilige Stadt . . . du Hauptſtadt der Welt .. . Mekka, du Sehn-
ſucht aller Gläubigen . . . Mekka, in der jeder Stein heilig iſt . . . Wiege
des Iſlams . . . du heiligster Fußſchemel des Allmächtigen . . . du Schatten
Allahs auf der Erde . . .! ;
Da ſammeln ſich die Pilger zu einem gewaltigen Haufen. Das wilde Ge-
ſchrei läßt die Säumigen haſtig näher kommen. Die unübersehbare Schlange,
die eben noch träge ihre Straße entlang kroch, rollt ſich zu einem Klumpen
zuſammen. Die grüne Fahne des Propheten flattert auf und mit ihr
Hunderte von anderen Fahnen, die der Zug mitführt. Einstimmig und
doch tauſendſtimmig und tauſendtönig dröhnen die Rufe. Keiner, der
nicht ſein „labik“ ausſtößt. Das iſt der gelobte Augenblick, an dem die
Welt der Qual, die nun im Rücken liegt, verſinkt. Und alles Irdiſche iſt
in einem Meere des Taumels fanatiſcher Religiosität vergangen. Die vom
Sturme tiefſter Gefühle aufgelöſte Karawane ordnet ſich neu. Hinter der
Fahne des Propheten zieht ſie auf die Stadt zu, vom Großſcherifen von
Mekka und der Bevölkerung feierlich eingeholt.
Nun aber beginnen ſofort die zahlreichen religiöſen Handlungen, die der
Mekkapilger ausführen muß: der ſiebenmalige Lauf um die Kaaba; das
Trinken aus dem Brunnen Semſem, der nach der Überlieferung Hagar
und Iſmael vor dem Tode bewahrte; das Küssen des schwarzen, fabelhaften
Wunderſteins; die Wallfahrt nach dem Berge Arafat, jenem „Berg der
Erkenntnis", wo Mohammed ſeine Offenbarungen empfing; endlich die
Steinigung des Teufels im Tale Menaa. Daneben noch zahlreiche, viel-
fach tief im Heidniſchen wurzelnde Verrichtungen. Und zum Schluß die
Teilnahme an dem großen Hammelopfer, das zum Andenken an das Opfer
Abrahams abgehalten werden muß, und das
die geſamte Welt des Iſlams am gleichen
Tage im „Großen Opferfeſt“ mitbegeht.
Dann iſt der Pilger ſeiner Pflichten ledig.
Der Zweck der Wallfahrt iſt erfüllt, und er
kann ſich um den Rückweg kümmern, den
er nun von Dſchedda aus auch zur See neh-
men darf. Erreicht er dann endlich, oft nach
jahrelanger Abwesenheit, die Heimat wie-
der, ſo wird er dort mit Ehren empfangen
und führt von nun an den begehrten, ge-
ſegneten und in Ehrfurcht genannten Titel:
Hadſchi – Mekkapilzker – Pilger zum
Hauſe Gottes.
Der Blumenduſt und ſeine
Gefahren
Von Alfred Erlbeck
er Blumen Rache“, das bekannte Ge-
dicht Jreiligraths, iſt keine Phantaqsie-
ſchöpfung, der Dichter wurde durch einen
wirklichen Vorgang angeregt, der ihn be-
ſtimmte, den Vorwurf poetiſch zu geſtalten.
Freiligrath hatte, bevor er das Gedicht ſchuf,
erfahren, daß eine Frau durch eine große
Menge weißer Lilien, welche in großen
Blumenvaſen auf dem Kamin ſtanden, ihren
Tod fand. Solche und ähnliche Jälle von
Vergiftung durch Blumenduft mögen in
früherer Zeit viele vorgekommen ſein, wo
der Tod der betreffenden Personen als durch
Schlagfluß herbeigeführt angenommen wor-
den iſt. Anknüpfend an diesen Jall ſei be-
merkt, daß Blumenduft, wenn er durch eine
Menge von Blüten erzeugt wird, nicht auf
jeden Menſchen in dieſer Weiſe ſich äußert.
Auch sind es nicht etwa die Lilien allein,
die solche giftigen Düfte aushauchen, auch
Hefti 1
Landſchaft Hedſchas. Mitten hindurch führt die kilometerbreite Spur der
Pilgerſtraße, die im Laufe der Jahrhunderte von Millionen von Hufen in
die harte, arme Erde hineingetreten wurde. Unentwegt zieht sie gen
Süden ... gen Süden. Ihre Länge beträgt achtzehnhundert Kilometer.
An ihrem Saum. liegen die unzähligen Gerippe der hier verendeten Trag-
tiere und die Gräber derer, die auf ihr ſtarben. An ihr lauern die wilden
Nomaden, die von den Pilgern ihren Zoll fordern. Die Sonnengluten des
Tages fließen flammend über ſie dahin. Die düſteren Sandſtürme jagen
ihren Staub erſtickend über ſie empor. Die Erſchöpfung des Wanderns,
die Gebreſten der Hitze, die aus allen Gegenden des Orients herbeige-
ſchleppten Krankheiten bemächtigen sich der Wallfahrer. Bald erhält die
pomphaft ausgezogene Karawane ein anderes Aussehen. Sie zieht ſich
auseinander und verliert die Ordnung. Die Gruppen der gut Berittenen
löſen ſich von denen der Fußgänger oder der Eſelreiter. Viele Pilger leiden
an Erkältungen des Unterleibs oder kranken an dem bitteren, harten
Walſſer, das die tiefen Felsbrunnen der Raſtſtationen bieten. Gleich
Schatten ziehen Jie dahin. Alles fliegende Ungeziefer des Orients begleitet
den Zug durch die Einsamkeit gleich einer unheilvollen Wolke und nährt
ſich von den Wunden, welche die unaufhörliche Bewegung des Vorwärts-
haſtens an den Leibern von Tieren und Menſchen gebildet hat. Und die
Gemeinſchaft jener kriechenden und hüpfenden Blutſauger feiert Orgien,
zumal ein Pilger nach des Propheten Vorschrift kein lebendes Wesen töten
darf und ſJich alles gefallen laſſen muß.
So mancher der Wanderer erreicht nie sein Ziel, sondern wird seitlich
der Straße seines Leidens und seiner Hoffnung in die Erde gelegt, von
Osten nach Westen gerichtet und das Gesicht nach Süden gedreht, nach jener
gebenedeiten Stätte hin, die er nun erſt am Jüngſten Tage erreichen wird.
Niemand darf dieſe Toten beklagen. Sie ſind glückselig, war auch ihr Leben
noch so kurz berechnet.
An den mit kleinen Forts ausgeſtatteten Raſtplätzen ſammelt ich die
Karawane immer von neuem. Und eines gesegneten Tages erreicht ſie
endlich den Hedud el Haram, die Grenze des ſich um Mekka weit herum-
ziehenden geheiligten Bezirks, den zu betreten für den Andersgläubigen
den Tod bédeutet . . .
Hier vollzieht ſich mit den Pilgern eine äußerliche Umwandlung. Sie
legen nun die vorgeschriebene Pilgertracht,
den Ihram an. Diese besteht für die Män-
ner aus zwei weißen, rechteckigen Baum-
wollstücken, die nicht genäht ſein dürfen;
eines von ihnen wird um die Lenden, eines
ſo um die Schulter geſchlungen, daß der
rechte Arm samt Schulter freibleibt. Die
Frauen verhüllen den Körper von Kopf
bis zu Füßen und mit einem Schleier das
Gesicht. Die Männer müsſen Jich den Kopf
kahlſcheren laſſen. Er bleibt von nun an
unbedeckt und darf höchſtens mit den Hänun
den beſchützt werden. Dies bedeutet für man-
chen der aus den nördlichen Gebieten des
Iſlams Kommenden, von denen keiner an
die ſtechende Sonne des Wendektreiſes ge-
wöhnt iſt, den Tod durch Sonnenſtich. Durch
dieſe Pilgertracht, die das Koſtüm eines ge-
meinen Arabers aus der Zeit Mohammeds
darſtellt, ſoll zum Ausdruck gebracht werden,
daß arm wie reich, Bettler wie Machthaber
in demſelben beſcheidenen Gewande und
äußerlich durch nichts voneinander unter-
ſchieden vor das Haus Gottes treten sollen.
In dieser Tracht bleiben nun die Pilger
bis zum Ende der vorgeſchriebenen Hand-
lungen, die ſie in Mekka vorzunehmen haben,
alſo mindestens zwölf Tage. In dieser Zeit
dürfen sie ſich weder waſchen noch Haupt-
haar, Bart oder Nägel ſchneiden. Bald er-
halten Jie daher ein verwildertes, finſteres
Aussehen.
Von der Einkleidung an bemächtigt ich der
Pilger eine ſtarke Aufregung. Gebete und
religiöſe Sänge ſchallen ohne Unterlaß. Die
Kehlen strengen ſich in fanatiſchem Wett-
eifer an. Alles aber übertönt jener fromme
und glückſelige Pilgerruf, der einzig und
allein nach Anlegung der Pilgertracht aus-
geſtoßen werden darf: „Labik, labik !“ Dieser
Ruf hallt nun millionenfach aus Tauſenden
von Kehlen hervor und ſchwingt die Kara-
P Verlag Franz Hanfstaengl, München
Rosen im Köcher. Nach einem Gemälde von K. Meper
wane entlang, die nunmehr wieder geschlossen und in alter Ordnung
marſchiert. Die Bedeutung dieses talismanischen Wortes, von dem die
öden Felswände und die grauen Mauern Mekkas alljährlich zur Wall-
fahrtszeit widerhallen, bedeutet in freier Überſeßzung etwa: „Aus tiefer
Not nehme ich meine Zuflucht zu dir, o Gott!" In ihn iſt die ganze
g stadt “tt Erdenmenſchen nach Erlöſung aus diesem Jammertale
ineingelegt. ;
Dann aber naht die heißerſehnte, gepriesene Stunde, in welcher die
Pilgerkarawane die ferne Masse der Häuser Mekkas erſpäht und Jich dies
unter frenetiſchem, unausſprechlichem Jubel zujauchzt . .. Mekka, Mekka,
duneunmalheilige Stadt . . . du Hauptſtadt der Welt .. . Mekka, du Sehn-
ſucht aller Gläubigen . . . Mekka, in der jeder Stein heilig iſt . . . Wiege
des Iſlams . . . du heiligster Fußſchemel des Allmächtigen . . . du Schatten
Allahs auf der Erde . . .! ;
Da ſammeln ſich die Pilger zu einem gewaltigen Haufen. Das wilde Ge-
ſchrei läßt die Säumigen haſtig näher kommen. Die unübersehbare Schlange,
die eben noch träge ihre Straße entlang kroch, rollt ſich zu einem Klumpen
zuſammen. Die grüne Fahne des Propheten flattert auf und mit ihr
Hunderte von anderen Fahnen, die der Zug mitführt. Einstimmig und
doch tauſendſtimmig und tauſendtönig dröhnen die Rufe. Keiner, der
nicht ſein „labik“ ausſtößt. Das iſt der gelobte Augenblick, an dem die
Welt der Qual, die nun im Rücken liegt, verſinkt. Und alles Irdiſche iſt
in einem Meere des Taumels fanatiſcher Religiosität vergangen. Die vom
Sturme tiefſter Gefühle aufgelöſte Karawane ordnet ſich neu. Hinter der
Fahne des Propheten zieht ſie auf die Stadt zu, vom Großſcherifen von
Mekka und der Bevölkerung feierlich eingeholt.
Nun aber beginnen ſofort die zahlreichen religiöſen Handlungen, die der
Mekkapilger ausführen muß: der ſiebenmalige Lauf um die Kaaba; das
Trinken aus dem Brunnen Semſem, der nach der Überlieferung Hagar
und Iſmael vor dem Tode bewahrte; das Küssen des schwarzen, fabelhaften
Wunderſteins; die Wallfahrt nach dem Berge Arafat, jenem „Berg der
Erkenntnis", wo Mohammed ſeine Offenbarungen empfing; endlich die
Steinigung des Teufels im Tale Menaa. Daneben noch zahlreiche, viel-
fach tief im Heidniſchen wurzelnde Verrichtungen. Und zum Schluß die
Teilnahme an dem großen Hammelopfer, das zum Andenken an das Opfer
Abrahams abgehalten werden muß, und das
die geſamte Welt des Iſlams am gleichen
Tage im „Großen Opferfeſt“ mitbegeht.
Dann iſt der Pilger ſeiner Pflichten ledig.
Der Zweck der Wallfahrt iſt erfüllt, und er
kann ſich um den Rückweg kümmern, den
er nun von Dſchedda aus auch zur See neh-
men darf. Erreicht er dann endlich, oft nach
jahrelanger Abwesenheit, die Heimat wie-
der, ſo wird er dort mit Ehren empfangen
und führt von nun an den begehrten, ge-
ſegneten und in Ehrfurcht genannten Titel:
Hadſchi – Mekkapilzker – Pilger zum
Hauſe Gottes.
Der Blumenduſt und ſeine
Gefahren
Von Alfred Erlbeck
er Blumen Rache“, das bekannte Ge-
dicht Jreiligraths, iſt keine Phantaqsie-
ſchöpfung, der Dichter wurde durch einen
wirklichen Vorgang angeregt, der ihn be-
ſtimmte, den Vorwurf poetiſch zu geſtalten.
Freiligrath hatte, bevor er das Gedicht ſchuf,
erfahren, daß eine Frau durch eine große
Menge weißer Lilien, welche in großen
Blumenvaſen auf dem Kamin ſtanden, ihren
Tod fand. Solche und ähnliche Jälle von
Vergiftung durch Blumenduft mögen in
früherer Zeit viele vorgekommen ſein, wo
der Tod der betreffenden Personen als durch
Schlagfluß herbeigeführt angenommen wor-
den iſt. Anknüpfend an diesen Jall ſei be-
merkt, daß Blumenduft, wenn er durch eine
Menge von Blüten erzeugt wird, nicht auf
jeden Menſchen in dieſer Weiſe ſich äußert.
Auch sind es nicht etwa die Lilien allein,
die solche giftigen Düfte aushauchen, auch