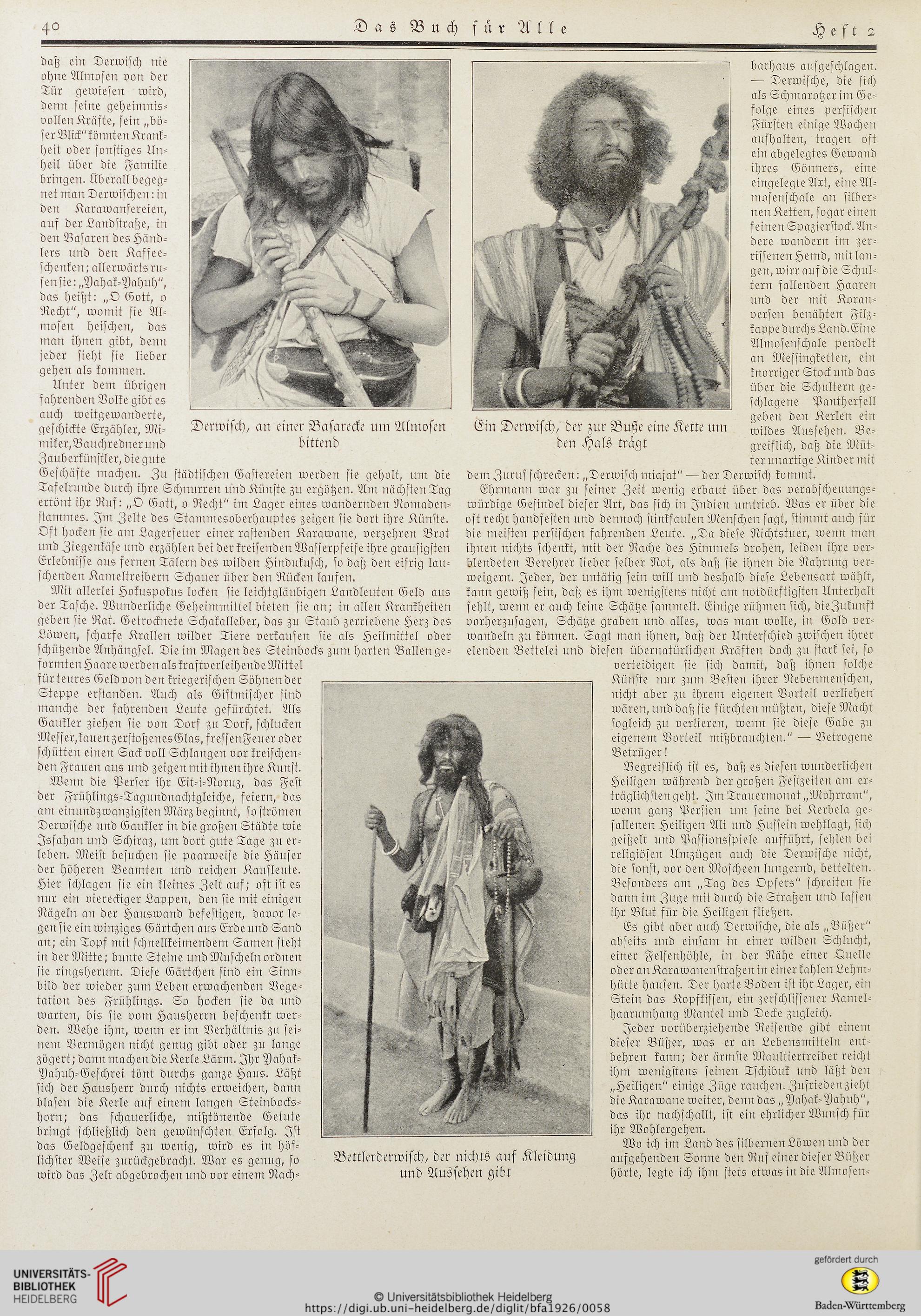40
Da s B u < f ür Alle
j: :
daß ein Derwiſch nie
ohne Almosen von der
Tür gewiesſen wird,
denn deine geheimnis-
vollen Kräfte, sein ,„bö-
ſer Blick“ könnten Krank-
heit oder ſonſtiges Un-
heil über die Familie
bringen. Überall begeg-
net man Derwischen: in
den Karawanſ ereien,
auf der Landſtraße, in
den Basaren des Händ-
lers und den Kaffee-
ſchenken; allerwärts ru-
fenſie: „Yahak-Yahuh",
das heißt: „D Gott, o
Recht“, womit sie Al-
mosen heiſchen, das
man ihnen gibt, denn
jeder ſieht sie lieber
gehen als kommen.
Unter dem übrigen
fahrenden Volke gibt es
auch weitgewanderte,
geſchickte Erzähler, Mi-
miker, Bauchrednerund
Zauberkünſtler, diegute
Geschäfte machen. Zu ſtädtiſchen Gastereien werden sie geholt, um die
Tafelrunde durch ihre Schnurren und Künſte zu ergößen. Am nächſten Tag
ertönt ihr Ruf: „O Gott, o Recht“ im Lager eines wandernden Nomaden-
ſtammes. Im Zelte des Stammesoberhauptes zeigen sie dort ihre Künſte.
Oft hocken ſie am Lagerfeuer einer raſtenden Karawane, verzehren Brot
und Ziegenkäse und erzählen bei der kreiſenden Wasserpfeife ihre grausigsten
Erlebnisse aus fernen Tälern des wilden Hindutuſch, so daß den eifrig lau-
ſchenden Kameltreibern Schauer über den Rücken laufen.
Mit allerlei Hokuspokus locken Jie leichtgläubigen Landleuten Geld aus
der Taſche. Wunderliche Geheimmittel bieten Jie an; in allen Krankheiten
geben sie Rat. Getrocknete Schakalleber, das zu Staub zerriebene Herz des
Löwen, ſcharfe Krallen wilder Tiere verkaufen sie als Heilmittel oder
ſchützende Anhängsel. Die im Magen des Steinbocks zum harten Ballen ge-
formtenHaare werdenalskraftverleihende Mittel
_ fürteures Geldvon den kriegeriſchen Sbhhnender >
Derwiſch, an teu Bsdgiete um Almoſen
itten
barhaus aufgeschlagen.
~ Derwiſche, die Jich
als Schmarotzer im Ge-
folge eines persiſchen
JFürſten einige Wochen
aufhalten, tragen oft
ein abgelegtes Gewand
ihres Gönners, eine
eingelegte Axt, eine Al-
mosenschale an ſilber-
nen Ketten, sogar einen
feinen Spazierstock. An-
dere wandern im zer-
riſſenen Hemd, mitlan-
gen, wirr auf die Schul-
tern fallenden Haaren
und der mit Koran-
verſen benähten Filz-
kappedurchs Land.Eine
Almosenſchale pendelt
an Messingketten, ein
knorriger Stock und das
über die Schultern ge-
ſchlagene Pantherfell
geben den Kerlen ein
wildes Aussehen. Be-
greiflich, daß die Müt-
terunartige Kinder mit
dem Zuruf ſchrecken: „Derwisch miajat"“ ~ der Derwiſch kommt.
Ehrmann war zu seiner Zeit wenig erbaut über das verabſcheuungs-
Ein Derwiſch, der zur Buße eine Kette um
den Hals trägt
würdige Gesindel dieser Art, das sich in Indien umtrieb. Was er über die
oft recht handfeſten und dennoch ſtinkfaulen Menschen sagt, ſtimmt auch für
die meiſten perſiſchen fahrenden Leute. „Da diese Nichtstuer, wenn man
ihnen nichts ſchenkt, mit der Rache des Himmels drohen, leiden ihre ver-
blendeten Verehrer lieber selber Not, als daß sie ihnen die Nahrung ver-
weigern. Jeder, der untätig sein will und deshalb dieſe Lebensart wählt,
kann gewiß sein, daß es ihm wenigstens nicht am notdürftigſten Unterhalt
fehlt, wenn er auch keine Schätze ſammelt. Einige rühmen J ich, die Zukunft
vorherzuſagen, Schätze graben und alles, was man wolle, in Gold ver-
wandeln zu können. Sagt man ihnen, beatz der Unterschied zwiſchen ihrer
elenden Bettelei und diesen übernatürlichen Kräften doch zu ſtark ſei, ſo
verteidigen ſie ſich damit, daß ihnen ſJolche
Künſte nur zum Beſten ihrer Nebenmenſchen,
Steppe erſtanden. Auch als Giftmischer ſind
manche der fahrenden Leute gefürchtet. Als
Gauller ziehen ſie von Dorf zu Dorf, ſchlucken
Messer,kauenzerſtoßenesGlas, freſſenFeuer oder
ſchütten einen Sack voll Schlangen vor kreiſchen-
den Frauen aus und zeigen mit ihnen ihre Kunſt.
Wenn die Perser ihr Eit-i-Noruz, das Feſt
der Frühlings-Tagundnachtgleiche, feiern, das
am einundzwanzigsten März beginnt, so ſtrömen
Derwiſche und Gaukler in die großen Städte wie
Isfahan und Schiraz, um dort gute Tage zu er-
leben. Meiſt beſuchen sie paarweise die Häuſer
der höheren Beamten und reichen Kaufleute.
Hier ſchlagen Jie ein kleines Zelt auf; oft iſt es
nur ein viereckiger Lappen, den ie mit einigen
Nägeln an der Hauswand befestigen, davor le-
genie ein winziges Gärtchen aus Erde und Sand
an; ein Topf mit ſchnellkeimendem Samen ſteht
in der Mitte; bunte Steine und Muſcheln ordnen
ſie ringsherum. Diese Gärtchen sind ein Sinn-
bild der wieder zum Leben erwachenden Vege-
tation des Frühlings. So hocken sie da und
warten, bis ſie vom Hausherrn beſchenkt wer-
den. Wehe ihm, wenn er im Verhältnis zu ſei-
nem Vermögen nicht genug gibt oder zu lange
zögert; dann machen die Kerle Lärm. Ihr Yahak-
Yahuh-Geſchrei tönt durchs ganze Haus. Läſzt
ſich der Hausherr durch nichts erweichen, dann
blaſen die Kerle auf einem langen Steinbocks-
horn; das ſchauerliche, mißtönende Getute
bringt schließlich den gewünſchten Erfolg. Ilſt
das Geldgeſchenk zu wenig, wird es in höf-
lichſter Weise zurückgebracht. War es genug, ſo
wird das Zelt abgebrochen und vor einem Nach-
_ OGetllerderwiſch, der nichts auf Kleidung
und Aussehen gibt
| nicht aber zu ihrem eigenen Vorteil verliehen
wären, und daßsie fürchten müßten, diese Macht
sogleich zu verlieren, wenn Sie diese Gabe zu
eigenem Vorteil mißbrauchten." + Betrogene
Betrüger!
.. Begreiflich iſt es, daß es diesen wunderlichen
. | H öeiligen während der großen Feſtzeiten am er-
| tträglichſtengeht. Im Trauermonat , Mohrram",
| wenn ganz Perſien um ſeine bei Kerbela ge-
fallenen Heiligen Ali und Hussein wehllagt, ſich
geißelt und Passionsspiele aufführt, fehlen bei
| religiöſen Umzügen auch die Derwiſche nicht,
die ſonſt, vor den Moſcheen lungernd, bettelten.
Besonders am ,Tag des Opfers“ ſchreiten Jie
dann im Zuge mit durch die Straßen und laſſen
ihr Blut für die Heiligen fließen.
Es gibt aber auch Derwiſche, die als „Büßer“"
abseits und einsam in einer wilden Schlucht,
einer Felſenhöhle, in der Nähe einer Quelle
oder anKarawanenſtraßenin einer kahlen Lehm-
hütte hauſen. Der harte Boden iſt ihr Lager, ein
Stein das Kopfkissen, ein zerſchliſſener Kamel-
haarumhang Mantel und Decke zugleich.
Jeder vorüberziehende Reiſende gibt einem
dieser Büßer, was er an Lebensmitteln ent-
behren kann; der ärmſte Maultiertreiber reicht
ihm wenigstens seinen Iſchibuk und läßt den
„Heiligen" einige Züge rauchen. Zusſriedenzieht
die Karawane weiter, denn das „ Yahak- Yahuh",
das ihr nachſchallt, iſt ein ehrlicher Wunſch für
ihr Wohlergehen.
Wo ich im Land des ſilbernen Löwen und der
aufgehenden Sonne den Ruf einer dieſer Büßer
hörte, legte ich ihm ſtets etwas in die Almoſen-
Da s B u < f ür Alle
j: :
daß ein Derwiſch nie
ohne Almosen von der
Tür gewiesſen wird,
denn deine geheimnis-
vollen Kräfte, sein ,„bö-
ſer Blick“ könnten Krank-
heit oder ſonſtiges Un-
heil über die Familie
bringen. Überall begeg-
net man Derwischen: in
den Karawanſ ereien,
auf der Landſtraße, in
den Basaren des Händ-
lers und den Kaffee-
ſchenken; allerwärts ru-
fenſie: „Yahak-Yahuh",
das heißt: „D Gott, o
Recht“, womit sie Al-
mosen heiſchen, das
man ihnen gibt, denn
jeder ſieht sie lieber
gehen als kommen.
Unter dem übrigen
fahrenden Volke gibt es
auch weitgewanderte,
geſchickte Erzähler, Mi-
miker, Bauchrednerund
Zauberkünſtler, diegute
Geschäfte machen. Zu ſtädtiſchen Gastereien werden sie geholt, um die
Tafelrunde durch ihre Schnurren und Künſte zu ergößen. Am nächſten Tag
ertönt ihr Ruf: „O Gott, o Recht“ im Lager eines wandernden Nomaden-
ſtammes. Im Zelte des Stammesoberhauptes zeigen sie dort ihre Künſte.
Oft hocken ſie am Lagerfeuer einer raſtenden Karawane, verzehren Brot
und Ziegenkäse und erzählen bei der kreiſenden Wasserpfeife ihre grausigsten
Erlebnisse aus fernen Tälern des wilden Hindutuſch, so daß den eifrig lau-
ſchenden Kameltreibern Schauer über den Rücken laufen.
Mit allerlei Hokuspokus locken Jie leichtgläubigen Landleuten Geld aus
der Taſche. Wunderliche Geheimmittel bieten Jie an; in allen Krankheiten
geben sie Rat. Getrocknete Schakalleber, das zu Staub zerriebene Herz des
Löwen, ſcharfe Krallen wilder Tiere verkaufen sie als Heilmittel oder
ſchützende Anhängsel. Die im Magen des Steinbocks zum harten Ballen ge-
formtenHaare werdenalskraftverleihende Mittel
_ fürteures Geldvon den kriegeriſchen Sbhhnender >
Derwiſch, an teu Bsdgiete um Almoſen
itten
barhaus aufgeschlagen.
~ Derwiſche, die Jich
als Schmarotzer im Ge-
folge eines persiſchen
JFürſten einige Wochen
aufhalten, tragen oft
ein abgelegtes Gewand
ihres Gönners, eine
eingelegte Axt, eine Al-
mosenschale an ſilber-
nen Ketten, sogar einen
feinen Spazierstock. An-
dere wandern im zer-
riſſenen Hemd, mitlan-
gen, wirr auf die Schul-
tern fallenden Haaren
und der mit Koran-
verſen benähten Filz-
kappedurchs Land.Eine
Almosenſchale pendelt
an Messingketten, ein
knorriger Stock und das
über die Schultern ge-
ſchlagene Pantherfell
geben den Kerlen ein
wildes Aussehen. Be-
greiflich, daß die Müt-
terunartige Kinder mit
dem Zuruf ſchrecken: „Derwisch miajat"“ ~ der Derwiſch kommt.
Ehrmann war zu seiner Zeit wenig erbaut über das verabſcheuungs-
Ein Derwiſch, der zur Buße eine Kette um
den Hals trägt
würdige Gesindel dieser Art, das sich in Indien umtrieb. Was er über die
oft recht handfeſten und dennoch ſtinkfaulen Menschen sagt, ſtimmt auch für
die meiſten perſiſchen fahrenden Leute. „Da diese Nichtstuer, wenn man
ihnen nichts ſchenkt, mit der Rache des Himmels drohen, leiden ihre ver-
blendeten Verehrer lieber selber Not, als daß sie ihnen die Nahrung ver-
weigern. Jeder, der untätig sein will und deshalb dieſe Lebensart wählt,
kann gewiß sein, daß es ihm wenigstens nicht am notdürftigſten Unterhalt
fehlt, wenn er auch keine Schätze ſammelt. Einige rühmen J ich, die Zukunft
vorherzuſagen, Schätze graben und alles, was man wolle, in Gold ver-
wandeln zu können. Sagt man ihnen, beatz der Unterschied zwiſchen ihrer
elenden Bettelei und diesen übernatürlichen Kräften doch zu ſtark ſei, ſo
verteidigen ſie ſich damit, daß ihnen ſJolche
Künſte nur zum Beſten ihrer Nebenmenſchen,
Steppe erſtanden. Auch als Giftmischer ſind
manche der fahrenden Leute gefürchtet. Als
Gauller ziehen ſie von Dorf zu Dorf, ſchlucken
Messer,kauenzerſtoßenesGlas, freſſenFeuer oder
ſchütten einen Sack voll Schlangen vor kreiſchen-
den Frauen aus und zeigen mit ihnen ihre Kunſt.
Wenn die Perser ihr Eit-i-Noruz, das Feſt
der Frühlings-Tagundnachtgleiche, feiern, das
am einundzwanzigsten März beginnt, so ſtrömen
Derwiſche und Gaukler in die großen Städte wie
Isfahan und Schiraz, um dort gute Tage zu er-
leben. Meiſt beſuchen sie paarweise die Häuſer
der höheren Beamten und reichen Kaufleute.
Hier ſchlagen Jie ein kleines Zelt auf; oft iſt es
nur ein viereckiger Lappen, den ie mit einigen
Nägeln an der Hauswand befestigen, davor le-
genie ein winziges Gärtchen aus Erde und Sand
an; ein Topf mit ſchnellkeimendem Samen ſteht
in der Mitte; bunte Steine und Muſcheln ordnen
ſie ringsherum. Diese Gärtchen sind ein Sinn-
bild der wieder zum Leben erwachenden Vege-
tation des Frühlings. So hocken sie da und
warten, bis ſie vom Hausherrn beſchenkt wer-
den. Wehe ihm, wenn er im Verhältnis zu ſei-
nem Vermögen nicht genug gibt oder zu lange
zögert; dann machen die Kerle Lärm. Ihr Yahak-
Yahuh-Geſchrei tönt durchs ganze Haus. Läſzt
ſich der Hausherr durch nichts erweichen, dann
blaſen die Kerle auf einem langen Steinbocks-
horn; das ſchauerliche, mißtönende Getute
bringt schließlich den gewünſchten Erfolg. Ilſt
das Geldgeſchenk zu wenig, wird es in höf-
lichſter Weise zurückgebracht. War es genug, ſo
wird das Zelt abgebrochen und vor einem Nach-
_ OGetllerderwiſch, der nichts auf Kleidung
und Aussehen gibt
| nicht aber zu ihrem eigenen Vorteil verliehen
wären, und daßsie fürchten müßten, diese Macht
sogleich zu verlieren, wenn Sie diese Gabe zu
eigenem Vorteil mißbrauchten." + Betrogene
Betrüger!
.. Begreiflich iſt es, daß es diesen wunderlichen
. | H öeiligen während der großen Feſtzeiten am er-
| tträglichſtengeht. Im Trauermonat , Mohrram",
| wenn ganz Perſien um ſeine bei Kerbela ge-
fallenen Heiligen Ali und Hussein wehllagt, ſich
geißelt und Passionsspiele aufführt, fehlen bei
| religiöſen Umzügen auch die Derwiſche nicht,
die ſonſt, vor den Moſcheen lungernd, bettelten.
Besonders am ,Tag des Opfers“ ſchreiten Jie
dann im Zuge mit durch die Straßen und laſſen
ihr Blut für die Heiligen fließen.
Es gibt aber auch Derwiſche, die als „Büßer“"
abseits und einsam in einer wilden Schlucht,
einer Felſenhöhle, in der Nähe einer Quelle
oder anKarawanenſtraßenin einer kahlen Lehm-
hütte hauſen. Der harte Boden iſt ihr Lager, ein
Stein das Kopfkissen, ein zerſchliſſener Kamel-
haarumhang Mantel und Decke zugleich.
Jeder vorüberziehende Reiſende gibt einem
dieser Büßer, was er an Lebensmitteln ent-
behren kann; der ärmſte Maultiertreiber reicht
ihm wenigstens seinen Iſchibuk und läßt den
„Heiligen" einige Züge rauchen. Zusſriedenzieht
die Karawane weiter, denn das „ Yahak- Yahuh",
das ihr nachſchallt, iſt ein ehrlicher Wunſch für
ihr Wohlergehen.
Wo ich im Land des ſilbernen Löwen und der
aufgehenden Sonne den Ruf einer dieſer Büßer
hörte, legte ich ihm ſtets etwas in die Almoſen-