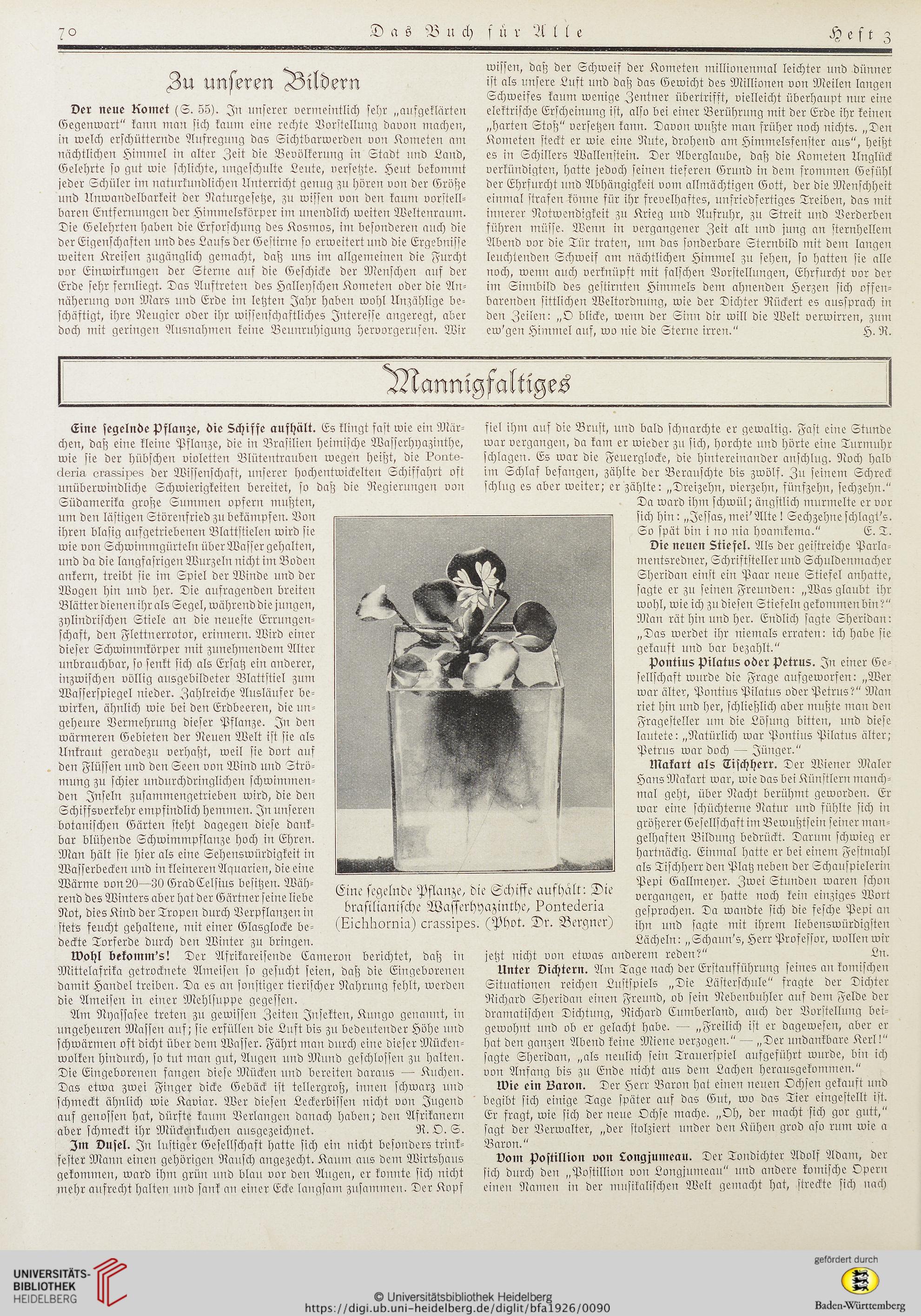§ Da s Buch f ü x A lle
H est z
Zu unseren Bildern
Der neue Komet (S. 55). In unſerer vermeintlich sehr „aufgeklärten
Gegenwart“ kann man ſich kaum eine rechte Vorſtellung davon machen,
in welch erſchütternde Aufregung das Sichtbarwerden von Kometen am
nächtlichen Himmel in alter Zeit die Bevölkerung in Stadt und Land,
Gelehrte so gut wie ſchlichte, ungeſchulte Leute, versetzte. Heut bekommt
jeder Schüler im naturkundlichen Unterricht genug zu hören von der Größe
und Unwandelbarkeit der Naturgesetze, zu wissen von den kaum vorſtell-
baren Entfernungen der Himmelskörper im unendlich weiten Weltenraum.
Die Gelehrten haben die Erforſchung des Kosmos, im besonderen auch die
der Eigenschaften und des Laufs der Gestirne so erweitert und die Ergebnisse
weiten Kreiſen zugänglich gemacht, daß uns im allgemeinen die Furcht
vor Einwirkungen der Sterne auf die Geschicke der Menschen auf der
Erde sehr fernliegt. Das Auftreten des Hallenyſchen Kometen oder die An-
näherung von Mars und Erde im letzten Jahr haben wohl Unzählige be-
ſchäftigt, ihre Neugier oder ihr wissenſchaftliches Interesse angeregt, aber
doch mit geringen Ausnahmen keine Beunruhigung hervorgerufen. Wir
wiſſen, daß der Schweif der Kometen millionenmal leichter und dünner
iſt als unſere Luft und daß das Gewicht des Millionen von Meilen langen
Schweifes kaum wenige Zentner übertrifft, vielleicht überhaupt nur eine
elektriſche Erſcheinung iſt, alſo bei einer Berührung mit der Erde ihr keinen
„harten Stoß" versſeßen kann. Davon wußte man früher noch nichts. „Den
Kometen ſteckt er wie eine Rute, drohend am Himmelsfenſter aus“, heiſzt
es in Schillers Wallenſtein. Der Aberglaube, daß die Kometen Unglück
verkündigten, hatte jedoch seinen tieferen Grund in dem frommen Gefühl
der Ehrfurcht und Abhängigkeit vom allmächtigen Gott, der die Menschheit
einmal slrafen könne für ihr frevelhaftes, unfriedfertiges Treiben, das mit
innerer Notwendigkeit zu Krieg und Aufruhr, zu Streit und Verderben
führen müsse. Wenn in vergangener Zeit alt und jung an ſternhellem
Abend vor die Tür traten, um das sonderbare Sternbild mit dem langen
leuchlenden Schweif am nächtlichen Himmel zu ehen, so hatten ſie alle
noch, wenn auch verknüpft mit salſchen Vorſtellungen, Ehrfurcht vor der
im Sinnbild des gestirnten Himmels dem ahnenden Herzen ſich offen-
barenden Jittlichen Weltordnung, wie der Dichter Rückert es aussſprach in
den Zeilen: „O blicke, wenn der Sinn dir will die Welt verwirren, zum
H. R.
ew'gen Himmiel auf, wo nie die Sterne irren."
|
DWMannsgfaltiges _ .
Eine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält. Es klingt faſt wie ein Mär-
chen, daß eine kleine Pflanze, die in Brasilien heimiſche Wasserhyazinthe,
wie sie der hübſchen violetten Blütentrauben wegen heißt, die Vonte-
deria crassipes der Wissenschaft, unserer hochentwickelten Schiffahrt oft
unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, ſo daß die Regierungen von
Südamerika große Summen opfern mußten,
um den lästigen Störenfried zu bekämpfen. Von
ihren blasig aufgetriebenen Blattſtielen wird Jie
wie von Schwimmgürteln überWaſsser gehalten,
und da die langfaſrigen Wurzeln nicht im Boden
ankern, treibt ſie im Spiel der Winde und der
Wogen hin und her. Die aufragenden breiten
Blätterdienenihrals Segel, währenddie jungen,
zylindriſchen Stiele an die neueſte Errungen-
ſchaft, den Flettnerrotor, erinnern. Wird einer
dieſer Schwimmkörper mit zunehmendem Alter
unbrauchbar, ſo ſenkt ſich als Ersatz ein anderer,
inzwischen völlig ausgebildeter Blattſtiel zum
Waſsserſpiegel nieder. Zahlreiche Ausläufer be-
wirken, ähnlich wie bei den Erdbeeren, die un-
geheure Vermehrung dieſer Pflanze. In den
wärmeren Gebieten der Neuen Welt iſt ſie als
Unkraut geradezu verhaßt, weil sie dort auf
. den Flüssen und den Seen von Wind und Strö-
mung zu schier undurchdringlichen ſchwimmen-
den Inseln zuſammengetrieben wird, die den
Schiffsverkehr empfindlich hemmen. In unseren
botanischen Gärten steht dagegen diese dank-
bar blühende Schwimmpflanze hoch in Ehren.
Man hält Jie hier als eine Sehenswürdigkeit in
Wasserbecken und in kleineren Aquarien, die eine
fiel ihm auf die Bruſt, und bald ſchnarchte er gewaltig. Faſt eine Stunde
war vergangen, da kam er wieder zu oich, horchte und hörte eine Turmuhr
ſchlagen. Es war die Feuerglocke, die hintereinander ansſchlug. Noch halb
im Schlaf befangen, zählte der Berauſchte bis zwölf. Zu seinem Schreck
ſchlug es aber weiter; er zählte: „Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, ſechzehn.“
Da ward ihm ſchwül; ängstlich murmelte er vor
ſich hin: „Jeſsſas, mei’ Alte! Sechzehneſchlagi's.
So spät bin i no nia hoamkema.“ E. T.
Die neuen Stiefel. Als der geiſtreiche Parla-
mentsredner, Schriftſteller und Schuldenmacher
Sheridan einſt ein Paar neue Stiefel anhatte,
ſagte er zu seinen Freunden: „Was glaubt ihr
wohl, wie ich zu dieſen Stiefeln gekommenbin?"
Man rät hin und her. Endlich sagte Sheridan:
„Das werdet ihr niemals erraten: ich habe Jie
gekauft und bar bezahlt."
Pontius Pilatus oder Petrus. In einer Ge-
ſellſchaft wurde die Frage aufgeworfen: „Wer
war älter, Pontius Pilatus oder Petrus?“ Man
riet hin und her, ſchließlich aber mußte man den
Fragesteller um die Löſung bitten, und diese
lautete: „Natürlich war Pontius Pilatus älter;
Petrus war doch + Jünger."
Makart als Tiſchherr. Der Wiener Maler
Hans Makart war, wie das bei Künſtlern manch-
mal geht, über Nacht berühmt geworden. Er
war eine ſchüchterne Natur und fühlte Jich in
größerer Gesellſchaft m Bewußtſein ſeiner man-
gelhaften Bildung bedrückt. Darum ſchwieg er
hartnäckig. Einmal hatte er bei einem Feſtmahl
als Tiſchherr den Platz neben der Schauſpielerin
Wärme von2030 GradCelſius beſizen. Wäh-
rend des Winters aber hat der Gärtnerseineliebe
Not, dies Kind der Tropen durch Verpflanzen in
stets feucht gehaltene, mit einer Glasglocke be-
deckte Torferde durch den Winter zu bringen.
Wohl bekomm’s! Der Akfrikareiſende Cameron berichtet, daß in
Mittelafrika getrocknete Ameiſen Jo geſucht seien, daß die Eingeborenen
damit Handel treiben. Da es an ſonſtiger tieriſcher Nahrung fehlt, werden
die Ameisen in einer Mehlſuppe gegeſſen.
Am Nyaqssasee treten zu gewissen Zeiten Insekten, Kungo genannt, in
ungeheuren Massen auf; sie erfüllen die Luft bis zu bedeutender Höhe und
ſchwärmen oft dicht über dem Wasser. Fährt man durch eine dieſer Mücken-
wolken hindurch, so tut man gut, Augen und Mund geſschlo sen zu halten.
Die Eingeborenen fangen dieſe Mücken und bereiten daraus + Kuchen.
Das etwa zwei Finger dicke Gebäck iſt tellergroß, innen ſchwarz und
ſchmeckt ähnlich wie Kaviar. Wer dieſen Leckerbiſſen nicht von Jugend
auf genoſſen hat, dürfte kaum Verlangen danach haben; den Afrikanern
aber ſchmeckt ihr Mückenkuchen ausgezeichnet. R. O©. S.
Im Duſel. In lustiger Geſsellſchaft hatte ſich ein nicht besonders trink-
feſter Mann einen gehörigen Rauſch angezecht. Kaum aus dem Wirtshaus
gekommen, ward ihm grün und blau vor den Augen, er konnte ſich nicht
mehr aufrecht halten und ſank an einer Ecke langſam zuſammen. Der Kopf
Cine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält: Die
braſilianiſche Wasserhyazinthe, Pontederia
(Eichhornia) crassipes. (Phot. Dr. Bergner)
Pepi Gallmeyer. Zwei Stunden waren ſchon
vergangen, er hatte noch kein einziges Wort
gesprochen. Da wandte Jich die feſche Pepi an
ihn und sagte mit ihrem liebenswürdigſten
Lächeln: „Schaun's, Herr Profeſſor, wollen wir
jetzt nicht von etwas anderem reden?" Ln.
Unter Dichtern. Am Tage nach der Erſtaufführung ſeines an komiſchen
Situationen reichen Luſtſpiels „Die Läſterſchule" fragte der Dichter
Richard Sheridan einen Freund, ob ſein Nebenbuhler auf dem Jelde der
dramatiſchen Dichtung, Richard Cumberland, auch der Vorſtellung bein-
gewohnt und ob er gelacht habe. „Freilich iſt er dagewesen, aber er
hat den ganzen Abend keine Miene verzogen." „Der undankbare Kerl!“
ſagte Sheridan, „als neulich ſein Trauerſpiel aufgeführt wurde, bin ich
von Anfang bis zu Ende nicht aus dem Lachen herausgekommen."
Wie ein Baron. Der Herr Baron hal einen neuen Ochſen gekauft und
begibt sich einige Tage ſpäter auf das Gut, wo das Tier eingeltellt iſt.
Er fragt, wie sich der neue Ochſe mache. „Oh, der macht ſich gor gutt,“
ſagt der Verwalter, „der ſtolziert under den Kühen grod aſo rum wie a
“9!: Postillion von Longjumeau. Der Tondichter Adolf Adam, der
ſich durch den ,„Poſtillion von Longjumeau“ und andere komiſche Opern
einen Namen in der msikaliſchen Welt gemacht hat, [treckte ſich nach
H est z
Zu unseren Bildern
Der neue Komet (S. 55). In unſerer vermeintlich sehr „aufgeklärten
Gegenwart“ kann man ſich kaum eine rechte Vorſtellung davon machen,
in welch erſchütternde Aufregung das Sichtbarwerden von Kometen am
nächtlichen Himmel in alter Zeit die Bevölkerung in Stadt und Land,
Gelehrte so gut wie ſchlichte, ungeſchulte Leute, versetzte. Heut bekommt
jeder Schüler im naturkundlichen Unterricht genug zu hören von der Größe
und Unwandelbarkeit der Naturgesetze, zu wissen von den kaum vorſtell-
baren Entfernungen der Himmelskörper im unendlich weiten Weltenraum.
Die Gelehrten haben die Erforſchung des Kosmos, im besonderen auch die
der Eigenschaften und des Laufs der Gestirne so erweitert und die Ergebnisse
weiten Kreiſen zugänglich gemacht, daß uns im allgemeinen die Furcht
vor Einwirkungen der Sterne auf die Geschicke der Menschen auf der
Erde sehr fernliegt. Das Auftreten des Hallenyſchen Kometen oder die An-
näherung von Mars und Erde im letzten Jahr haben wohl Unzählige be-
ſchäftigt, ihre Neugier oder ihr wissenſchaftliches Interesse angeregt, aber
doch mit geringen Ausnahmen keine Beunruhigung hervorgerufen. Wir
wiſſen, daß der Schweif der Kometen millionenmal leichter und dünner
iſt als unſere Luft und daß das Gewicht des Millionen von Meilen langen
Schweifes kaum wenige Zentner übertrifft, vielleicht überhaupt nur eine
elektriſche Erſcheinung iſt, alſo bei einer Berührung mit der Erde ihr keinen
„harten Stoß" versſeßen kann. Davon wußte man früher noch nichts. „Den
Kometen ſteckt er wie eine Rute, drohend am Himmelsfenſter aus“, heiſzt
es in Schillers Wallenſtein. Der Aberglaube, daß die Kometen Unglück
verkündigten, hatte jedoch seinen tieferen Grund in dem frommen Gefühl
der Ehrfurcht und Abhängigkeit vom allmächtigen Gott, der die Menschheit
einmal slrafen könne für ihr frevelhaftes, unfriedfertiges Treiben, das mit
innerer Notwendigkeit zu Krieg und Aufruhr, zu Streit und Verderben
führen müsse. Wenn in vergangener Zeit alt und jung an ſternhellem
Abend vor die Tür traten, um das sonderbare Sternbild mit dem langen
leuchlenden Schweif am nächtlichen Himmel zu ehen, so hatten ſie alle
noch, wenn auch verknüpft mit salſchen Vorſtellungen, Ehrfurcht vor der
im Sinnbild des gestirnten Himmels dem ahnenden Herzen ſich offen-
barenden Jittlichen Weltordnung, wie der Dichter Rückert es aussſprach in
den Zeilen: „O blicke, wenn der Sinn dir will die Welt verwirren, zum
H. R.
ew'gen Himmiel auf, wo nie die Sterne irren."
|
DWMannsgfaltiges _ .
Eine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält. Es klingt faſt wie ein Mär-
chen, daß eine kleine Pflanze, die in Brasilien heimiſche Wasserhyazinthe,
wie sie der hübſchen violetten Blütentrauben wegen heißt, die Vonte-
deria crassipes der Wissenschaft, unserer hochentwickelten Schiffahrt oft
unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet, ſo daß die Regierungen von
Südamerika große Summen opfern mußten,
um den lästigen Störenfried zu bekämpfen. Von
ihren blasig aufgetriebenen Blattſtielen wird Jie
wie von Schwimmgürteln überWaſsser gehalten,
und da die langfaſrigen Wurzeln nicht im Boden
ankern, treibt ſie im Spiel der Winde und der
Wogen hin und her. Die aufragenden breiten
Blätterdienenihrals Segel, währenddie jungen,
zylindriſchen Stiele an die neueſte Errungen-
ſchaft, den Flettnerrotor, erinnern. Wird einer
dieſer Schwimmkörper mit zunehmendem Alter
unbrauchbar, ſo ſenkt ſich als Ersatz ein anderer,
inzwischen völlig ausgebildeter Blattſtiel zum
Waſsserſpiegel nieder. Zahlreiche Ausläufer be-
wirken, ähnlich wie bei den Erdbeeren, die un-
geheure Vermehrung dieſer Pflanze. In den
wärmeren Gebieten der Neuen Welt iſt ſie als
Unkraut geradezu verhaßt, weil sie dort auf
. den Flüssen und den Seen von Wind und Strö-
mung zu schier undurchdringlichen ſchwimmen-
den Inseln zuſammengetrieben wird, die den
Schiffsverkehr empfindlich hemmen. In unseren
botanischen Gärten steht dagegen diese dank-
bar blühende Schwimmpflanze hoch in Ehren.
Man hält Jie hier als eine Sehenswürdigkeit in
Wasserbecken und in kleineren Aquarien, die eine
fiel ihm auf die Bruſt, und bald ſchnarchte er gewaltig. Faſt eine Stunde
war vergangen, da kam er wieder zu oich, horchte und hörte eine Turmuhr
ſchlagen. Es war die Feuerglocke, die hintereinander ansſchlug. Noch halb
im Schlaf befangen, zählte der Berauſchte bis zwölf. Zu seinem Schreck
ſchlug es aber weiter; er zählte: „Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, ſechzehn.“
Da ward ihm ſchwül; ängstlich murmelte er vor
ſich hin: „Jeſsſas, mei’ Alte! Sechzehneſchlagi's.
So spät bin i no nia hoamkema.“ E. T.
Die neuen Stiefel. Als der geiſtreiche Parla-
mentsredner, Schriftſteller und Schuldenmacher
Sheridan einſt ein Paar neue Stiefel anhatte,
ſagte er zu seinen Freunden: „Was glaubt ihr
wohl, wie ich zu dieſen Stiefeln gekommenbin?"
Man rät hin und her. Endlich sagte Sheridan:
„Das werdet ihr niemals erraten: ich habe Jie
gekauft und bar bezahlt."
Pontius Pilatus oder Petrus. In einer Ge-
ſellſchaft wurde die Frage aufgeworfen: „Wer
war älter, Pontius Pilatus oder Petrus?“ Man
riet hin und her, ſchließlich aber mußte man den
Fragesteller um die Löſung bitten, und diese
lautete: „Natürlich war Pontius Pilatus älter;
Petrus war doch + Jünger."
Makart als Tiſchherr. Der Wiener Maler
Hans Makart war, wie das bei Künſtlern manch-
mal geht, über Nacht berühmt geworden. Er
war eine ſchüchterne Natur und fühlte Jich in
größerer Gesellſchaft m Bewußtſein ſeiner man-
gelhaften Bildung bedrückt. Darum ſchwieg er
hartnäckig. Einmal hatte er bei einem Feſtmahl
als Tiſchherr den Platz neben der Schauſpielerin
Wärme von2030 GradCelſius beſizen. Wäh-
rend des Winters aber hat der Gärtnerseineliebe
Not, dies Kind der Tropen durch Verpflanzen in
stets feucht gehaltene, mit einer Glasglocke be-
deckte Torferde durch den Winter zu bringen.
Wohl bekomm’s! Der Akfrikareiſende Cameron berichtet, daß in
Mittelafrika getrocknete Ameiſen Jo geſucht seien, daß die Eingeborenen
damit Handel treiben. Da es an ſonſtiger tieriſcher Nahrung fehlt, werden
die Ameisen in einer Mehlſuppe gegeſſen.
Am Nyaqssasee treten zu gewissen Zeiten Insekten, Kungo genannt, in
ungeheuren Massen auf; sie erfüllen die Luft bis zu bedeutender Höhe und
ſchwärmen oft dicht über dem Wasser. Fährt man durch eine dieſer Mücken-
wolken hindurch, so tut man gut, Augen und Mund geſschlo sen zu halten.
Die Eingeborenen fangen dieſe Mücken und bereiten daraus + Kuchen.
Das etwa zwei Finger dicke Gebäck iſt tellergroß, innen ſchwarz und
ſchmeckt ähnlich wie Kaviar. Wer dieſen Leckerbiſſen nicht von Jugend
auf genoſſen hat, dürfte kaum Verlangen danach haben; den Afrikanern
aber ſchmeckt ihr Mückenkuchen ausgezeichnet. R. O©. S.
Im Duſel. In lustiger Geſsellſchaft hatte ſich ein nicht besonders trink-
feſter Mann einen gehörigen Rauſch angezecht. Kaum aus dem Wirtshaus
gekommen, ward ihm grün und blau vor den Augen, er konnte ſich nicht
mehr aufrecht halten und ſank an einer Ecke langſam zuſammen. Der Kopf
Cine segelnde Pflanze, die Schiffe aufhält: Die
braſilianiſche Wasserhyazinthe, Pontederia
(Eichhornia) crassipes. (Phot. Dr. Bergner)
Pepi Gallmeyer. Zwei Stunden waren ſchon
vergangen, er hatte noch kein einziges Wort
gesprochen. Da wandte Jich die feſche Pepi an
ihn und sagte mit ihrem liebenswürdigſten
Lächeln: „Schaun's, Herr Profeſſor, wollen wir
jetzt nicht von etwas anderem reden?" Ln.
Unter Dichtern. Am Tage nach der Erſtaufführung ſeines an komiſchen
Situationen reichen Luſtſpiels „Die Läſterſchule" fragte der Dichter
Richard Sheridan einen Freund, ob ſein Nebenbuhler auf dem Jelde der
dramatiſchen Dichtung, Richard Cumberland, auch der Vorſtellung bein-
gewohnt und ob er gelacht habe. „Freilich iſt er dagewesen, aber er
hat den ganzen Abend keine Miene verzogen." „Der undankbare Kerl!“
ſagte Sheridan, „als neulich ſein Trauerſpiel aufgeführt wurde, bin ich
von Anfang bis zu Ende nicht aus dem Lachen herausgekommen."
Wie ein Baron. Der Herr Baron hal einen neuen Ochſen gekauft und
begibt sich einige Tage ſpäter auf das Gut, wo das Tier eingeltellt iſt.
Er fragt, wie sich der neue Ochſe mache. „Oh, der macht ſich gor gutt,“
ſagt der Verwalter, „der ſtolziert under den Kühen grod aſo rum wie a
“9!: Postillion von Longjumeau. Der Tondichter Adolf Adam, der
ſich durch den ,„Poſtillion von Longjumeau“ und andere komiſche Opern
einen Namen in der msikaliſchen Welt gemacht hat, [treckte ſich nach