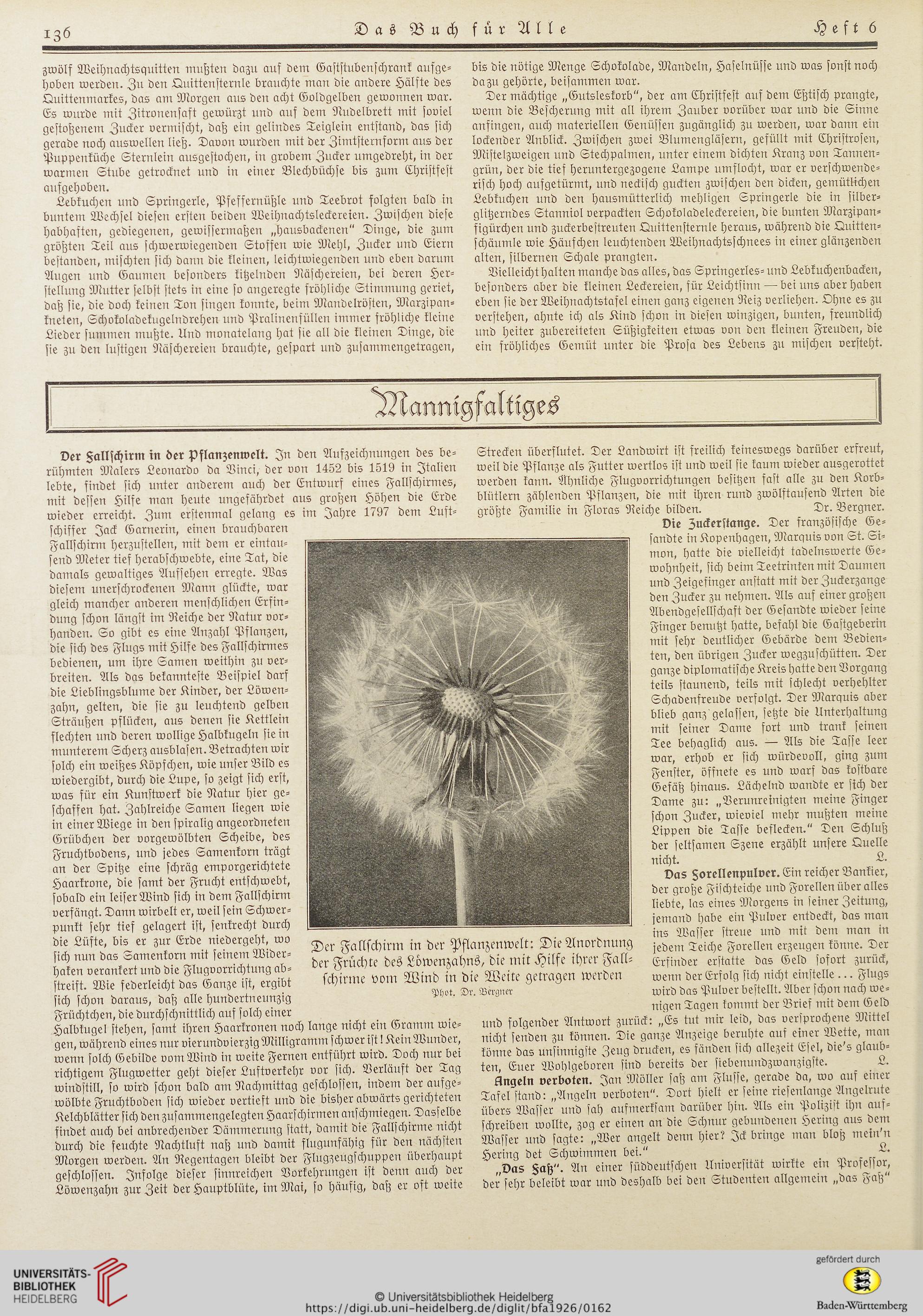I Z6
Da s Buch für Alle
H e ſt 6
zwölf Weihnachtsquitten mußten dazu auf dem Gaſtſtubenſchrank aufge-
hoben werden. Zu den Quittenſternle brauchte man die andere Hälfte des
Quittenmarkes, das am Morgen aus den acht Goldgelben gewonnen war.
Es wurde mit Zitronensaft gewürzt und auf dem Nudelbrett mit ſoviel
gestoßenem Zucker vermiſcht, daß ein gelindes Teiglein entstand, das ſich
gerade noch auswellen ließ. Davon wurden mit der Zimtſternform aus der
Puppenküche Sternlein ausgestochen, in grobem Zucker umgedreht, in der
warmen Stube getrocknet und in einer Blechbüchſe bis zum Chriſtfeſt
aufgehoben.
Lebkuchen und Springerle, Pfeffernüßle und Teebrot folgten bald in
buntem Wechſel dieſen erſten beiden Weihnachtsleckereien. Zwiſchen dieſe
habhaften, gediegenen, gewissermaßen „hausbackenen“ Dinge, die zum
größten Teil aus ſchwerwiegenden Stoffen wie Mehl, Zucker und Eiern
beſtanden, miſchten ſich dann die kleinen, leichtwiegenden und eben darum
Augen und Gaumen beſonders kitßelnden Näſchereien, bei deren Her-
ſtellung Mutter ſelbſt ſtets in eine ſo angeregte fröhliche Stimmung geriet,
daß Jie, die doch keinen Ton ſingen konnte, beim Mandelröſten, Marzipan-
kneten, Schokoladekugelndrehen und Pralinenfüllen immer fröhliche kleine
Lieder ſummen mußte. Und monatelang hat Jie all die kleinen Dinge, die
sie zu den luſtigen Näsſchereien brauchte, geſpart und zuſammengetragen,
bis die nötige Menge Schokolade, Mandeln, Haſelnüſſe und was ſonſt noch
dazu gehörte, beiſammen war.
Der mächtige „Gutsleskorb“, der am Chriſtfeſt auf dem Eßtiſch prangte,
wenn die Bescherung mit all ihrem Zauber vorüber war und die Sinne
anfingen, auch materiellen Genüssen zugänglich zu werden, war dann ein
lockender Anblick. Zwiſchen zwei Blumengläſern, gefüllt mit Chriſtroſen,
Mistelzweigen und Stechpalmen, unter einem dichten Kranz von Tannen-
grün, der die tief heruntergezogene Lampe umflocht, war er verſchwende-
riſch hoch aufgetürmt, und nectiſch guckten zwiſchen den dicken, gemütlichen
Lebkuchen und den hausmütterlich mehligen Springerle die in ſilber-
gliterndes Stanniol verpackten Schokoladeleckereien, die bunten Marzipan-
figürchen und zuckerbeſtreuten Quittenſternle heraus, während die Quitten-
ſchäumle wie Häufchen leuchtenden Weihnachtsſchnees in einer glänzenden
alten, ſilbernen Schale prangten.
Vielleicht halten manche das alles, das Springerles- und Lebkuchenbacken,
besonders aber die kleinen Leckereien, für Leichtſinn ~ bei uns aber haben
eben ſie der Weihnachtstafel einen ganz eigenen Reiz verliehen. Ohne es zu
verſtehen, ahnte ich als Kind ſchon in dieſen winzigen, bunten, freundlich
und heiter zubereiteten Süßigkeiten etwas von den kleinen Freuden, die
ein fröhliches Gemüt unter die Proſa des Lebens zu miſchen versteht.
Mannigfaltiges
Der Fallschirm in der Pflanzenwelt. In den Aufzeichnungen des be-
rühmten Malers Leonardo da Vinci, der von 1452 bis 1519 in Italien
lebte, findet ſich unter anderem auch der Entwurf eines Fallſchirmes,
mit deſſen Hilfe man heute ungefährdet aus großen Höhen die Erde
wieder erreicht. Zum erstenmal gelang es im Jahre 1797 dem Luft-
ſchiffer Jack Garnerin, einen brauchbaren
Fallſchirm herzuſtellen, mit dem er eintau-
send Meter tief herabſchwebte, eine Tat, die
damals gewaltiges Aufsehen erregte. Was
diesem unerschrockenen Mann glückte, war
gleich mancher anderen menschlichen Erfm-. n.
dung schon längst im Reiche der Natur vre-. (
handen. So gibt es eine Anzahl Pflanzen,
die sich des Flugs mit Hilfe des Fallſchirmes
bedienen, um ihre Samen weithin zu ver- ||
breiten. Als das bekannteste Beiſpiel darf
die Lieblingsblume der Kinder, der Löwen-
zahn, gelten, die ſie zu leuchtend gelben
Sträußen pflücken, aus denen Jie Kettlein ||
flechten und deren wollige Halbkugeln Jie in |
munterem Scherz ausblaſen. Betrachten wir ||
solch ein weißes Köpfchen, wie unſer Bild es
wiedergibt, durch die Lupe, .o zeigt ſich erſt,
was für ein Kunſtwerk die Natur hier ge-. |
ſchaffen hat. Zahlreiche Samen liegen wie
in einer Wiege in den ſpiralig angeordneten ;
Grübchen der vorgewölbten Scheibe, des.
Fruchtbodens, und jedes Samenkorn träget_tY]eY„e._.
an der Spitze eine ſchräg emporgerichtee |
Haarkrone, die ſamt der Frucht entſchwebt, :
sobald ein leiſer Wind ſich in dem Fallſchirm ||
verfängt. Dann wirbelt er, weilſein Schwer-
punkt sehr tief gelagert iſt, ſenkrecht durch
die Lüfte, bis er zur Erde niedergeht, wo
sich nun das Samenkorn mit ſeinem Wider-
haken verankert und die Flugvorrichtung ab-
ſtreift. Wie federleicht das Ganze iſt, ergibt
ſich ſchon daraus, daß alle hundertneunzig
Früchtchen, die durchſchnittlich auf ſolch einer ; ;
Halbkugel stehen, ſamt ihren Haarkronen noch lange nicht ein Gramm wie-
gen, während eines nur vierundvierzig Milligramm ſchwer iſt! Kein Wunder,
wenn solch Gebilde vom Wind in weite Fernen entführt wird. Doch nur bei
richtigem Flugwetter geht dieſer Luftverkehr vor ſich. Verläuft der Tag
windstill, ſo wird ſchon bald am Nachmittag geschloſſen, indem der aufge-
wölbte Fruchtboden ſich wieder vertieft und die bisher abwärts gerichteten
Kelchblätter ſich denzuſammengelegten Haarſchirmen anſchmiegen. Dasselbe
findet auch bei anbrechender Dämmerung ſtatt, damit die Fallſchirme nicht
durch die feuchte Nachtluft naß und damit flugunfähig für den nächſten
Morgen werden. An Regentagen bleibt der Flugzeugschuppen überhaupt
geſchloſſen. Infolge dieser ſinnreichen Vorkehrungen iſt denn auch der
Löwenzahn zur Zeit der Hauptblüte, im Mai, ſo häufig, daß er oft weite
Der Fallſchirm in der Pflanzenwelt: Die Anordnung
der Früchte des Löwenzahns, die mit Hilfe ihrer Fall-
ſchirme vom ._sÒ.t rt pie zctte getragen werden
Strecken überflutet. Der Landwirt iſt freilich keineswegs darüber erfreut,
weil die Pflanze als Futter wertlos iſt und weil ſie kaum wieder ausgerottet
werden kann. Ähnliche Flugvorrichtungen beſitzen faſt alle zu den Korb-
blütlern zählenden Pflanzen, die mit ihren rund zwölftauſend Arten die
größte Familie in Floras Reiche bilden. Dr. Bergner.
t Die Zuckerſtange. Der franzöſiſche Ge-
sandte in Kopenhagen, Marquis von St. Si-
mon, hatte die vielleicht tadelnswerte Ge-
wohnheit, ſich beim Teetrinkten mit Daumen
und Zeigefinger anstatt mit der Zuckerzange
den Zucker zu nehmen. Als auf einer großen
Abendgesellſchaft der Gesandte wieder seine
Finger benutzt hatte, befahl die Gaſtgeberin
mit sehr deutlicher Gebärde dem Bedien-
ten, den übrigen Zucker wegzuſchütten. Der
ganze diplomatische Kreis hatte den Vorgang
teils ſtaunend, teils mit ſchlecht verhehlter
Schadenfreude verfolgt. Der Marquis aber
blieb ganz gelassen, ſeßte die Unterhaltung
mit seiner Dame fort und trank ſeinen
Tee behaglich aus. ~ Als die Taſſe leer
war, erhob er ſich würdevoll, ging zum
Fenster, öffnete es und warf das koſtbare
Dame zu: ,„Verunreinigten meine Finger
schon Zucker, wieviel mehr mußten meine
Lippen die Taſſe beflecken." Den Schluß
der seltſamen Szene erzählt unsere Quelle
nicht. L.
Das Forellenpulver. Ein reicher Bantier,
der große Fiſchteiche und Forellenüberalles
. liebte, las eines Morgens in ſeiner Zeitung,
| jemand habe ein Pulver entdeckt, das man
ins Wasser ſtreue und mit dem man in
jedem Teiche Forellen erzeugen könne. Der
Erfinder erſtatte das Geld ſofort zurück,
wenn der Erfolg sich nicht einstelle . .. Flugs
wird das Pulver bestellt. Aber ſchon nach we-
nigen Tagen kommt der Brief mit dem Geld
und folgender Antwort zurück: „Es tut mir leid, das verſprochene Mittel
nicht ſenden zu können. Die ganze Anzeige beruhte auf einer Wette, man
könne das unsinnigste Zeug drucken, es fänden ſich allezeit Eſel, die's glaub-
ten, Euer Wohlgeboren ſind bereits der siebenundzwanzigste. L.
Angeln verboten. Jan Möller saß am Fluſſe, gerade da, wo auf einer
Tafel stand: „Angeln verboten". Dort hielt er ſeine rieſenlange Angelrute
übers Wasser und ſah aufmerkſam darüber hin. Als ein Poliziſt ihn auf-
ſchreiben wollte, zog er einen an die Schnur gebundenen Hering aus dem
Wasser und sagte: „Wer angelt denn hier? Ick bringe man bloß mein'n
Hering det Schwimmen bei." L;
„Das Faß“. An einer ſüddeutſchen Universität wirkte ein Profeſsor,
der sehr beleibt war und deshalb bei den Studenten allgemein „das Faß“
Gefäß hinaus. Lächelnd wandte er ſih deen.
Da s Buch für Alle
H e ſt 6
zwölf Weihnachtsquitten mußten dazu auf dem Gaſtſtubenſchrank aufge-
hoben werden. Zu den Quittenſternle brauchte man die andere Hälfte des
Quittenmarkes, das am Morgen aus den acht Goldgelben gewonnen war.
Es wurde mit Zitronensaft gewürzt und auf dem Nudelbrett mit ſoviel
gestoßenem Zucker vermiſcht, daß ein gelindes Teiglein entstand, das ſich
gerade noch auswellen ließ. Davon wurden mit der Zimtſternform aus der
Puppenküche Sternlein ausgestochen, in grobem Zucker umgedreht, in der
warmen Stube getrocknet und in einer Blechbüchſe bis zum Chriſtfeſt
aufgehoben.
Lebkuchen und Springerle, Pfeffernüßle und Teebrot folgten bald in
buntem Wechſel dieſen erſten beiden Weihnachtsleckereien. Zwiſchen dieſe
habhaften, gediegenen, gewissermaßen „hausbackenen“ Dinge, die zum
größten Teil aus ſchwerwiegenden Stoffen wie Mehl, Zucker und Eiern
beſtanden, miſchten ſich dann die kleinen, leichtwiegenden und eben darum
Augen und Gaumen beſonders kitßelnden Näſchereien, bei deren Her-
ſtellung Mutter ſelbſt ſtets in eine ſo angeregte fröhliche Stimmung geriet,
daß Jie, die doch keinen Ton ſingen konnte, beim Mandelröſten, Marzipan-
kneten, Schokoladekugelndrehen und Pralinenfüllen immer fröhliche kleine
Lieder ſummen mußte. Und monatelang hat Jie all die kleinen Dinge, die
sie zu den luſtigen Näsſchereien brauchte, geſpart und zuſammengetragen,
bis die nötige Menge Schokolade, Mandeln, Haſelnüſſe und was ſonſt noch
dazu gehörte, beiſammen war.
Der mächtige „Gutsleskorb“, der am Chriſtfeſt auf dem Eßtiſch prangte,
wenn die Bescherung mit all ihrem Zauber vorüber war und die Sinne
anfingen, auch materiellen Genüssen zugänglich zu werden, war dann ein
lockender Anblick. Zwiſchen zwei Blumengläſern, gefüllt mit Chriſtroſen,
Mistelzweigen und Stechpalmen, unter einem dichten Kranz von Tannen-
grün, der die tief heruntergezogene Lampe umflocht, war er verſchwende-
riſch hoch aufgetürmt, und nectiſch guckten zwiſchen den dicken, gemütlichen
Lebkuchen und den hausmütterlich mehligen Springerle die in ſilber-
gliterndes Stanniol verpackten Schokoladeleckereien, die bunten Marzipan-
figürchen und zuckerbeſtreuten Quittenſternle heraus, während die Quitten-
ſchäumle wie Häufchen leuchtenden Weihnachtsſchnees in einer glänzenden
alten, ſilbernen Schale prangten.
Vielleicht halten manche das alles, das Springerles- und Lebkuchenbacken,
besonders aber die kleinen Leckereien, für Leichtſinn ~ bei uns aber haben
eben ſie der Weihnachtstafel einen ganz eigenen Reiz verliehen. Ohne es zu
verſtehen, ahnte ich als Kind ſchon in dieſen winzigen, bunten, freundlich
und heiter zubereiteten Süßigkeiten etwas von den kleinen Freuden, die
ein fröhliches Gemüt unter die Proſa des Lebens zu miſchen versteht.
Mannigfaltiges
Der Fallschirm in der Pflanzenwelt. In den Aufzeichnungen des be-
rühmten Malers Leonardo da Vinci, der von 1452 bis 1519 in Italien
lebte, findet ſich unter anderem auch der Entwurf eines Fallſchirmes,
mit deſſen Hilfe man heute ungefährdet aus großen Höhen die Erde
wieder erreicht. Zum erstenmal gelang es im Jahre 1797 dem Luft-
ſchiffer Jack Garnerin, einen brauchbaren
Fallſchirm herzuſtellen, mit dem er eintau-
send Meter tief herabſchwebte, eine Tat, die
damals gewaltiges Aufsehen erregte. Was
diesem unerschrockenen Mann glückte, war
gleich mancher anderen menschlichen Erfm-. n.
dung schon längst im Reiche der Natur vre-. (
handen. So gibt es eine Anzahl Pflanzen,
die sich des Flugs mit Hilfe des Fallſchirmes
bedienen, um ihre Samen weithin zu ver- ||
breiten. Als das bekannteste Beiſpiel darf
die Lieblingsblume der Kinder, der Löwen-
zahn, gelten, die ſie zu leuchtend gelben
Sträußen pflücken, aus denen Jie Kettlein ||
flechten und deren wollige Halbkugeln Jie in |
munterem Scherz ausblaſen. Betrachten wir ||
solch ein weißes Köpfchen, wie unſer Bild es
wiedergibt, durch die Lupe, .o zeigt ſich erſt,
was für ein Kunſtwerk die Natur hier ge-. |
ſchaffen hat. Zahlreiche Samen liegen wie
in einer Wiege in den ſpiralig angeordneten ;
Grübchen der vorgewölbten Scheibe, des.
Fruchtbodens, und jedes Samenkorn träget_tY]eY„e._.
an der Spitze eine ſchräg emporgerichtee |
Haarkrone, die ſamt der Frucht entſchwebt, :
sobald ein leiſer Wind ſich in dem Fallſchirm ||
verfängt. Dann wirbelt er, weilſein Schwer-
punkt sehr tief gelagert iſt, ſenkrecht durch
die Lüfte, bis er zur Erde niedergeht, wo
sich nun das Samenkorn mit ſeinem Wider-
haken verankert und die Flugvorrichtung ab-
ſtreift. Wie federleicht das Ganze iſt, ergibt
ſich ſchon daraus, daß alle hundertneunzig
Früchtchen, die durchſchnittlich auf ſolch einer ; ;
Halbkugel stehen, ſamt ihren Haarkronen noch lange nicht ein Gramm wie-
gen, während eines nur vierundvierzig Milligramm ſchwer iſt! Kein Wunder,
wenn solch Gebilde vom Wind in weite Fernen entführt wird. Doch nur bei
richtigem Flugwetter geht dieſer Luftverkehr vor ſich. Verläuft der Tag
windstill, ſo wird ſchon bald am Nachmittag geschloſſen, indem der aufge-
wölbte Fruchtboden ſich wieder vertieft und die bisher abwärts gerichteten
Kelchblätter ſich denzuſammengelegten Haarſchirmen anſchmiegen. Dasselbe
findet auch bei anbrechender Dämmerung ſtatt, damit die Fallſchirme nicht
durch die feuchte Nachtluft naß und damit flugunfähig für den nächſten
Morgen werden. An Regentagen bleibt der Flugzeugschuppen überhaupt
geſchloſſen. Infolge dieser ſinnreichen Vorkehrungen iſt denn auch der
Löwenzahn zur Zeit der Hauptblüte, im Mai, ſo häufig, daß er oft weite
Der Fallſchirm in der Pflanzenwelt: Die Anordnung
der Früchte des Löwenzahns, die mit Hilfe ihrer Fall-
ſchirme vom ._sÒ.t rt pie zctte getragen werden
Strecken überflutet. Der Landwirt iſt freilich keineswegs darüber erfreut,
weil die Pflanze als Futter wertlos iſt und weil ſie kaum wieder ausgerottet
werden kann. Ähnliche Flugvorrichtungen beſitzen faſt alle zu den Korb-
blütlern zählenden Pflanzen, die mit ihren rund zwölftauſend Arten die
größte Familie in Floras Reiche bilden. Dr. Bergner.
t Die Zuckerſtange. Der franzöſiſche Ge-
sandte in Kopenhagen, Marquis von St. Si-
mon, hatte die vielleicht tadelnswerte Ge-
wohnheit, ſich beim Teetrinkten mit Daumen
und Zeigefinger anstatt mit der Zuckerzange
den Zucker zu nehmen. Als auf einer großen
Abendgesellſchaft der Gesandte wieder seine
Finger benutzt hatte, befahl die Gaſtgeberin
mit sehr deutlicher Gebärde dem Bedien-
ten, den übrigen Zucker wegzuſchütten. Der
ganze diplomatische Kreis hatte den Vorgang
teils ſtaunend, teils mit ſchlecht verhehlter
Schadenfreude verfolgt. Der Marquis aber
blieb ganz gelassen, ſeßte die Unterhaltung
mit seiner Dame fort und trank ſeinen
Tee behaglich aus. ~ Als die Taſſe leer
war, erhob er ſich würdevoll, ging zum
Fenster, öffnete es und warf das koſtbare
Dame zu: ,„Verunreinigten meine Finger
schon Zucker, wieviel mehr mußten meine
Lippen die Taſſe beflecken." Den Schluß
der seltſamen Szene erzählt unsere Quelle
nicht. L.
Das Forellenpulver. Ein reicher Bantier,
der große Fiſchteiche und Forellenüberalles
. liebte, las eines Morgens in ſeiner Zeitung,
| jemand habe ein Pulver entdeckt, das man
ins Wasser ſtreue und mit dem man in
jedem Teiche Forellen erzeugen könne. Der
Erfinder erſtatte das Geld ſofort zurück,
wenn der Erfolg sich nicht einstelle . .. Flugs
wird das Pulver bestellt. Aber ſchon nach we-
nigen Tagen kommt der Brief mit dem Geld
und folgender Antwort zurück: „Es tut mir leid, das verſprochene Mittel
nicht ſenden zu können. Die ganze Anzeige beruhte auf einer Wette, man
könne das unsinnigste Zeug drucken, es fänden ſich allezeit Eſel, die's glaub-
ten, Euer Wohlgeboren ſind bereits der siebenundzwanzigste. L.
Angeln verboten. Jan Möller saß am Fluſſe, gerade da, wo auf einer
Tafel stand: „Angeln verboten". Dort hielt er ſeine rieſenlange Angelrute
übers Wasser und ſah aufmerkſam darüber hin. Als ein Poliziſt ihn auf-
ſchreiben wollte, zog er einen an die Schnur gebundenen Hering aus dem
Wasser und sagte: „Wer angelt denn hier? Ick bringe man bloß mein'n
Hering det Schwimmen bei." L;
„Das Faß“. An einer ſüddeutſchen Universität wirkte ein Profeſsor,
der sehr beleibt war und deshalb bei den Studenten allgemein „das Faß“
Gefäß hinaus. Lächelnd wandte er ſih deen.