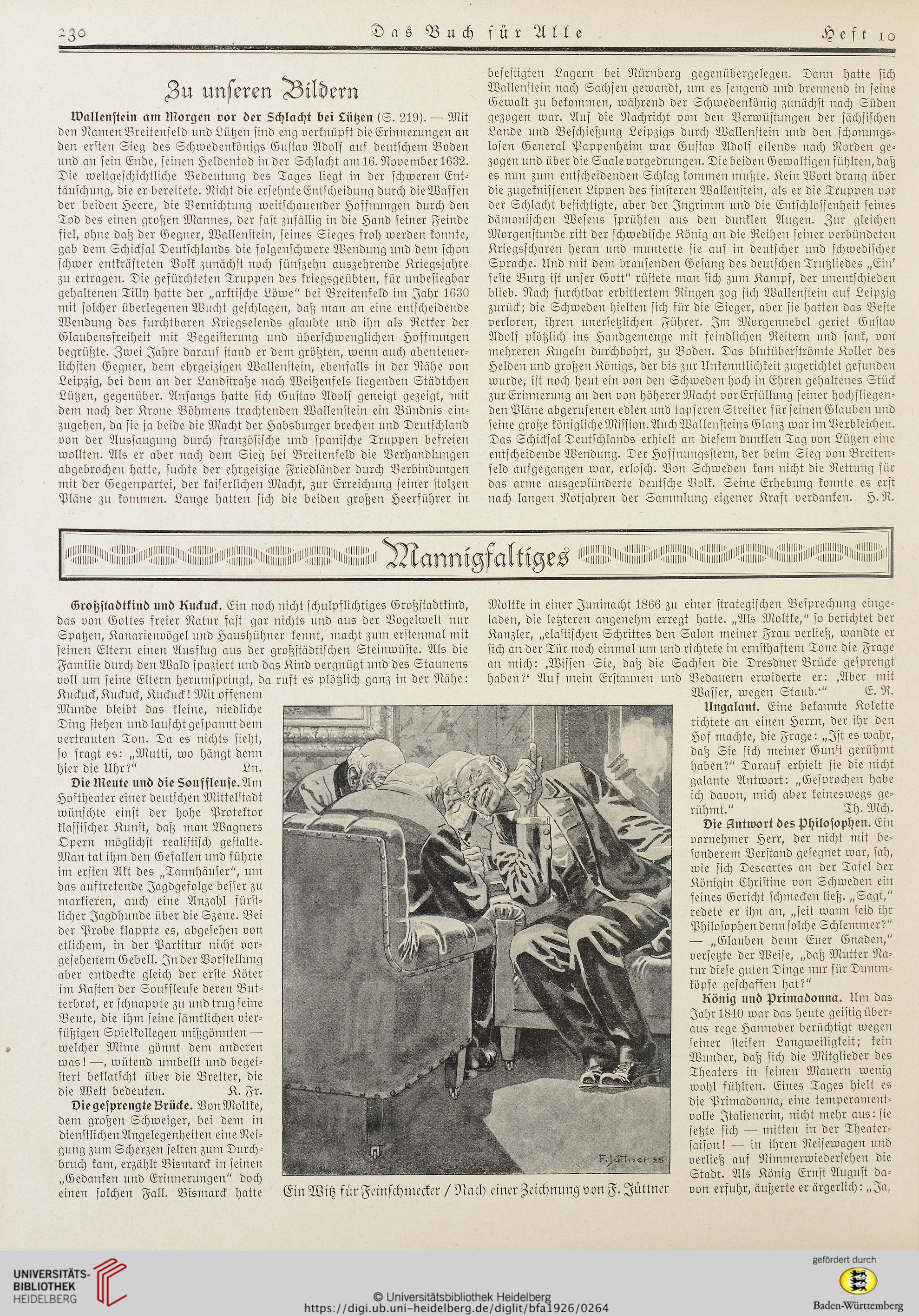Da s B uch für Alle
He f t 10
Zu unseren Bildern
Wallenstein am Morgen vor der Schlacht bei Lützen (S. 219). –~ Mit
den Namen Breitenfeld und Lützen ſind eng verknüpft die Erinnerungen an
den erſten Sieg des Schwedenkönigs Guſtav Adolf auf deutſchem Boden
und an sein Ende, seinen Heldentod in der Schlacht am 16. November 1682.
Die weltgeschichtliche Bedeutung des Tages liegt in der ſchweren Ent-
täuſchung, die er bereitete. Nicht die ersehnte Entſcheidung durch die Waffen
der beiden Heere, die Vernichtung weitſchauender Hoffnungen durch den
Tod des einen großen Mannes, der faſt zufällig in die Hand seiner Feinde
fiel, ohne daß der Gegner, Wallenſtein, seines Sieges froh werden konnte,
gab dem Schicksal Deutſchlands die folgenſchwere Wendung und dem ſchon
ſchwer entkräfteten Volk zunächſt noch fünfzehn auszehrende Kriegsjahre
zu ertragen. Die gefürchteten Truppen des kriegsgeübten, für unbesiegbar
gehaltenen Tilly hatte der ,„arktiſche Löwe“ bei Breitenfeld im Jahr 1630
mit solcher überlegenen Wucht geſchlagen, daß man an eine entſcheidende
Wendung des furchtbaren Kriegselends glaubte und ihn als Retter der
Glaubensfreiheit mit Begeiſterung und überſchwenglichen Hoffnungen
begrüßte. Zwei Jahre darauf ſtand er dem größten, wenn auch abenteuer-
lichſten Gegner, dem ehrgeizigen Wallenstein, ebenfalls in der Nähe von
Leipzig, bei dem an der Landſtraße nach Weißenfels liegenden Städtchen
Lützen, gegenüber. Anfangs hatte sſich Guſtav Adolf geneigt gezeigt, mit
dem nach der Krone Böhmens trachtenden Wallenstein ein Bündnis ein-
zugehen, da sie ja beide die Macht der Habsburger brechen und Deutſchland
von der Aussſaugung durch französiſche und ſpaniſche Truppen befreien
wollten. Als er aber nach dem Sieg bei Breitenfeld die Verhandlungen
abgebrochen hatte, ſuchte der ehrgeizige Friedländer durch Verbindungen
mit der Gegenpartei, der kaiſerlichen Macht, zur Erreichung einer ſtolzen
Pläne zu kommen. Lange hatten sich die beiden großen Heerführer in
befeſtigten Lagern bei Nürnberg gegenübergelegen. Dann hatte ſich
_ HWallenſtein nach Sachſen gewandt, um es ſengend und brennend in ſeine
Gewalt zu bekommen, während der Schwedenkönig zunächſt nach Süden
gezogen war. Auf die Nachricht von den Verwüſtungen der ſächsiſchen
Lande und Beſchießung Leipzigs durch Wallenstein und den ſchonungs-
loſen General Pappenheim war Guſtav Adolf eilends nach Norden ge-
zogen und über die Saale vorgedrungen. Die beiden Gewaltigen fühlten, daß
es nun zum entſcheidenden Schlag kommen mußte. Kein Wort drang über
die zugekniffenen Lippen des finſteren Wallenſtein, als er die Truppen vor
der Schlacht besichtigte, aber der Ingrimm und die Entſchlossenheit seines
dämoniſchen Wesens sſprühten aus den dunklen Augen. Zur gleichen
Morgenſtunde ritt der ſchwediſche König an die Reihen deiner verbündeten
Kriegsſcharen heran und munterte sie auf in deutſcher und ſchwedischer
Sprache. Und mit dem brauſenden Gesang des deutſchen Trutzliedes „Ein’
feſte Burg iſt unser Gott" rüſtete man ſich zum Kampf, der unentſchieden
blieb. Nach furchtbar erbittertem Ringen zog sich Wallenſtein auf Leipzig
zurück; die Schweden hielten Jich für die Sieger, aber ſie hatten das Beſte
verloren, ihren unersetlichen Führer. Im Morgennebel geriet Guſtav
Adolf plötzlich ins Handgemenge mit feindlichen Reitern und sank, von
mehreren Kugeln durchbohrt, zu Boden. Das blutübersſtrömte Koller des
Helden und großen Königs, der bis zur Unkenntlichkeit zugerichtet gefunden
wurde, iſt noch heut ein von den Schweden hoch in Ehren gehaltenes Stück
zur Erinnerung an den von höherer Macht vor Erfüllung seiner hochfliegen-
den Pläne abgerufenen edlen und tapferen Streiter für ſeinen Glauben und
seine große königliche Mission. Auch Wallenſteins Glanz war im Verbleichen.
Das Schicfsal Deutschlands erhielt an dieſem dunklen Tag von Lützen eine
entscheidende Wendung. Der Hoffnungsſtern, der beim Sieg von Breiten-
feld aufgegangen war, erloſch. Von Schweden kam nicht die Rettung für
das arme ausgeplünderte deutſche Volk. Seine Erhebung konnte es erſt
nach langen Notjahren der Sammlung eigener Kraft verdanken. H. R.
mmoaϾmumum.
ilh111 ul.. Mannéigsfaltiges INIT IIFFTTED INIT IFT VSSALTTNIFIFTZI MILLI
Großstadtkind und Kuckuck. Ein noch nicht ſchulpflichtiges Großſtadtkind,
das von Gottes freier Natur faſt gar nichts und aus der Vogelwelt nur
Spatzen, Kanarienvögel und Haushühner kennt, macht zum erſtenmal mit
seinen Eltern einen Ausflug aus der groſßſtädtiſchen Steinwüſte. Als die
Familie durch den Wald spaziert und das Kind vergnügt und des Staunens
voll um seine Eltern herumſpringt, da ruft es plötzlich ganz in der Nähe:
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck! Mit offenem
Munde bleibt das kleine, niedliche
Ding ſtehen undlauſcht gespannt dem
vertrauten Ton. Da es nichts Jieht,
ſo fragt es: „Mutti, wo hängt denn
hier die Uhr ?“" Ln.
Die Meute und die Souffleuſe. Am
Hoftheater einer deutſchen Mittelſtadt
wünſchte einſt der hohe Protektor
klaſſiſcher Kunſt, daß man Wagners
Opern miùöglichſt realiſtiſch geſtalte.
Man tat ihm den Gefallen und führte
im erſten Akt des „Tannhäuser“, um
das auftretende Jagdgefolge besser zu
markieren, auch eine Anzahl fürſt-
licher Jagdhunde über die Szene. Bei
der Probe klappte es, abgeſehen von
etlichem, in der Partitur nicht vor-
geſehenem Gebell. In der Vorſtellung
aber entdeckte gleich der erſte Köter
im Kasten der Souffleuſe deren But-
terbrot, er ſchnappte zu und trug seine
Beute, die ihm ſeine ſämttlichen vier-
füßigen Spielkollegen mißgönnten ~
welcher Mime gönnt dem anderen
was! , wütend umhbellt und begei-
ſtert beklatſcht über die Bretter, die z:
die Welt bedeuten. K. Fr. h;
Diegeſprengte Brücke. VonMoltke,
dem großen Schweiger, bei dem in
dienstlichen Angelegenheiten eine Nei-
gung zum Scherzen selten zum Durch- !
bruch kam, erzählt Bismarck in ſe inn. [HN
„Gedanken und Erinnerungen“ doch
einen solchen Fall. Bismarck hatte
EinWitz für Feinſchmecker / Nach einer Zeichnung von F. Jüttner
Moltke in einer Juninacht 1866 zu einer ſtrategiſchen Beſprechung einge-
laden, die leßzteren angenehm erregt hatte. „Als Moltke,“ so berichtet der
Kanzler, „elastischen Schrittes den Salon meiner Frau verließ, wandte er
sſich an der Tür noch einmal um und richtete in ernſthaftem Tone die Frage
an mich: ,Wissen Sie, daß die Sachſen die Dresdner Brücke geſprengt
haben?‘ Auf mein Erstaunen und Bedauern erwiderte er: @Aber mit
Wasser, wegen Staub.‘ E. R.
Ungalant. Eine bekannte Kokette
richtete an einen Herrn, der ihr den
Hof machte, die Frage: „Iſt es wahr,
daß Sie sich meiner Gunſt gerühmt
haben?“ Darauf erhielt sie die nicht
galante Antwort: „Gesprochen habe
ich davon, mich aber keineswegs ge-
rühmt." Th. Mch.
Die Antwort des Philoſophen. Ein
" vornehmer Herr, der nicht mit be-
J ſonderem Verstand gesegnet war, ſah,
wie sich Descartes an der Tafel der
Königin Chriſtine von Schweden ein
| feines Gericht ſchmecken ließ. „Sagt,“
] redete er ihn an, „ſeit wann Jeid ihr
Philosophen dennJolche Schlemmer?"
) f „Glauben denn Euer Gnaden,“
versetzte der Weiſe, „daß Mutter Na-
| tur dieſe guten Dinge nur für Dumm-
| köpfe geschaffen hat?“
' König und Primadonna. Um das
| Jahr 1840 war das heute geiſtig über-
| aus rege Hannover berüchtigt wegen
seiner steifen Langweiligkeit; kein
| MWunder, daß sich die Mitglieder des
Theaters in seinen Mauern wenig
wohl fühlten. Eines Tages hielt es
| die Primadonna, eine temperament-
| volle Italienerin, nicht mehr aus: ie
| sette ſich + mitten in der Theater-
| ſsaiſon! –~ in ihren Reiſewagen und
verließ auf Nimmerwiederſehen die
Stadt. Als König Ernſt Auguſt da-
von erfuhr, äußerte er ärgerlich: „Ja,
He f t 10
Zu unseren Bildern
Wallenstein am Morgen vor der Schlacht bei Lützen (S. 219). –~ Mit
den Namen Breitenfeld und Lützen ſind eng verknüpft die Erinnerungen an
den erſten Sieg des Schwedenkönigs Guſtav Adolf auf deutſchem Boden
und an sein Ende, seinen Heldentod in der Schlacht am 16. November 1682.
Die weltgeschichtliche Bedeutung des Tages liegt in der ſchweren Ent-
täuſchung, die er bereitete. Nicht die ersehnte Entſcheidung durch die Waffen
der beiden Heere, die Vernichtung weitſchauender Hoffnungen durch den
Tod des einen großen Mannes, der faſt zufällig in die Hand seiner Feinde
fiel, ohne daß der Gegner, Wallenſtein, seines Sieges froh werden konnte,
gab dem Schicksal Deutſchlands die folgenſchwere Wendung und dem ſchon
ſchwer entkräfteten Volk zunächſt noch fünfzehn auszehrende Kriegsjahre
zu ertragen. Die gefürchteten Truppen des kriegsgeübten, für unbesiegbar
gehaltenen Tilly hatte der ,„arktiſche Löwe“ bei Breitenfeld im Jahr 1630
mit solcher überlegenen Wucht geſchlagen, daß man an eine entſcheidende
Wendung des furchtbaren Kriegselends glaubte und ihn als Retter der
Glaubensfreiheit mit Begeiſterung und überſchwenglichen Hoffnungen
begrüßte. Zwei Jahre darauf ſtand er dem größten, wenn auch abenteuer-
lichſten Gegner, dem ehrgeizigen Wallenstein, ebenfalls in der Nähe von
Leipzig, bei dem an der Landſtraße nach Weißenfels liegenden Städtchen
Lützen, gegenüber. Anfangs hatte sſich Guſtav Adolf geneigt gezeigt, mit
dem nach der Krone Böhmens trachtenden Wallenstein ein Bündnis ein-
zugehen, da sie ja beide die Macht der Habsburger brechen und Deutſchland
von der Aussſaugung durch französiſche und ſpaniſche Truppen befreien
wollten. Als er aber nach dem Sieg bei Breitenfeld die Verhandlungen
abgebrochen hatte, ſuchte der ehrgeizige Friedländer durch Verbindungen
mit der Gegenpartei, der kaiſerlichen Macht, zur Erreichung einer ſtolzen
Pläne zu kommen. Lange hatten sich die beiden großen Heerführer in
befeſtigten Lagern bei Nürnberg gegenübergelegen. Dann hatte ſich
_ HWallenſtein nach Sachſen gewandt, um es ſengend und brennend in ſeine
Gewalt zu bekommen, während der Schwedenkönig zunächſt nach Süden
gezogen war. Auf die Nachricht von den Verwüſtungen der ſächsiſchen
Lande und Beſchießung Leipzigs durch Wallenstein und den ſchonungs-
loſen General Pappenheim war Guſtav Adolf eilends nach Norden ge-
zogen und über die Saale vorgedrungen. Die beiden Gewaltigen fühlten, daß
es nun zum entſcheidenden Schlag kommen mußte. Kein Wort drang über
die zugekniffenen Lippen des finſteren Wallenſtein, als er die Truppen vor
der Schlacht besichtigte, aber der Ingrimm und die Entſchlossenheit seines
dämoniſchen Wesens sſprühten aus den dunklen Augen. Zur gleichen
Morgenſtunde ritt der ſchwediſche König an die Reihen deiner verbündeten
Kriegsſcharen heran und munterte sie auf in deutſcher und ſchwedischer
Sprache. Und mit dem brauſenden Gesang des deutſchen Trutzliedes „Ein’
feſte Burg iſt unser Gott" rüſtete man ſich zum Kampf, der unentſchieden
blieb. Nach furchtbar erbittertem Ringen zog sich Wallenſtein auf Leipzig
zurück; die Schweden hielten Jich für die Sieger, aber ſie hatten das Beſte
verloren, ihren unersetlichen Führer. Im Morgennebel geriet Guſtav
Adolf plötzlich ins Handgemenge mit feindlichen Reitern und sank, von
mehreren Kugeln durchbohrt, zu Boden. Das blutübersſtrömte Koller des
Helden und großen Königs, der bis zur Unkenntlichkeit zugerichtet gefunden
wurde, iſt noch heut ein von den Schweden hoch in Ehren gehaltenes Stück
zur Erinnerung an den von höherer Macht vor Erfüllung seiner hochfliegen-
den Pläne abgerufenen edlen und tapferen Streiter für ſeinen Glauben und
seine große königliche Mission. Auch Wallenſteins Glanz war im Verbleichen.
Das Schicfsal Deutschlands erhielt an dieſem dunklen Tag von Lützen eine
entscheidende Wendung. Der Hoffnungsſtern, der beim Sieg von Breiten-
feld aufgegangen war, erloſch. Von Schweden kam nicht die Rettung für
das arme ausgeplünderte deutſche Volk. Seine Erhebung konnte es erſt
nach langen Notjahren der Sammlung eigener Kraft verdanken. H. R.
mmoaϾmumum.
ilh111 ul.. Mannéigsfaltiges INIT IIFFTTED INIT IFT VSSALTTNIFIFTZI MILLI
Großstadtkind und Kuckuck. Ein noch nicht ſchulpflichtiges Großſtadtkind,
das von Gottes freier Natur faſt gar nichts und aus der Vogelwelt nur
Spatzen, Kanarienvögel und Haushühner kennt, macht zum erſtenmal mit
seinen Eltern einen Ausflug aus der groſßſtädtiſchen Steinwüſte. Als die
Familie durch den Wald spaziert und das Kind vergnügt und des Staunens
voll um seine Eltern herumſpringt, da ruft es plötzlich ganz in der Nähe:
Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck! Mit offenem
Munde bleibt das kleine, niedliche
Ding ſtehen undlauſcht gespannt dem
vertrauten Ton. Da es nichts Jieht,
ſo fragt es: „Mutti, wo hängt denn
hier die Uhr ?“" Ln.
Die Meute und die Souffleuſe. Am
Hoftheater einer deutſchen Mittelſtadt
wünſchte einſt der hohe Protektor
klaſſiſcher Kunſt, daß man Wagners
Opern miùöglichſt realiſtiſch geſtalte.
Man tat ihm den Gefallen und führte
im erſten Akt des „Tannhäuser“, um
das auftretende Jagdgefolge besser zu
markieren, auch eine Anzahl fürſt-
licher Jagdhunde über die Szene. Bei
der Probe klappte es, abgeſehen von
etlichem, in der Partitur nicht vor-
geſehenem Gebell. In der Vorſtellung
aber entdeckte gleich der erſte Köter
im Kasten der Souffleuſe deren But-
terbrot, er ſchnappte zu und trug seine
Beute, die ihm ſeine ſämttlichen vier-
füßigen Spielkollegen mißgönnten ~
welcher Mime gönnt dem anderen
was! , wütend umhbellt und begei-
ſtert beklatſcht über die Bretter, die z:
die Welt bedeuten. K. Fr. h;
Diegeſprengte Brücke. VonMoltke,
dem großen Schweiger, bei dem in
dienstlichen Angelegenheiten eine Nei-
gung zum Scherzen selten zum Durch- !
bruch kam, erzählt Bismarck in ſe inn. [HN
„Gedanken und Erinnerungen“ doch
einen solchen Fall. Bismarck hatte
EinWitz für Feinſchmecker / Nach einer Zeichnung von F. Jüttner
Moltke in einer Juninacht 1866 zu einer ſtrategiſchen Beſprechung einge-
laden, die leßzteren angenehm erregt hatte. „Als Moltke,“ so berichtet der
Kanzler, „elastischen Schrittes den Salon meiner Frau verließ, wandte er
sſich an der Tür noch einmal um und richtete in ernſthaftem Tone die Frage
an mich: ,Wissen Sie, daß die Sachſen die Dresdner Brücke geſprengt
haben?‘ Auf mein Erstaunen und Bedauern erwiderte er: @Aber mit
Wasser, wegen Staub.‘ E. R.
Ungalant. Eine bekannte Kokette
richtete an einen Herrn, der ihr den
Hof machte, die Frage: „Iſt es wahr,
daß Sie sich meiner Gunſt gerühmt
haben?“ Darauf erhielt sie die nicht
galante Antwort: „Gesprochen habe
ich davon, mich aber keineswegs ge-
rühmt." Th. Mch.
Die Antwort des Philoſophen. Ein
" vornehmer Herr, der nicht mit be-
J ſonderem Verstand gesegnet war, ſah,
wie sich Descartes an der Tafel der
Königin Chriſtine von Schweden ein
| feines Gericht ſchmecken ließ. „Sagt,“
] redete er ihn an, „ſeit wann Jeid ihr
Philosophen dennJolche Schlemmer?"
) f „Glauben denn Euer Gnaden,“
versetzte der Weiſe, „daß Mutter Na-
| tur dieſe guten Dinge nur für Dumm-
| köpfe geschaffen hat?“
' König und Primadonna. Um das
| Jahr 1840 war das heute geiſtig über-
| aus rege Hannover berüchtigt wegen
seiner steifen Langweiligkeit; kein
| MWunder, daß sich die Mitglieder des
Theaters in seinen Mauern wenig
wohl fühlten. Eines Tages hielt es
| die Primadonna, eine temperament-
| volle Italienerin, nicht mehr aus: ie
| sette ſich + mitten in der Theater-
| ſsaiſon! –~ in ihren Reiſewagen und
verließ auf Nimmerwiederſehen die
Stadt. Als König Ernſt Auguſt da-
von erfuhr, äußerte er ärgerlich: „Ja,