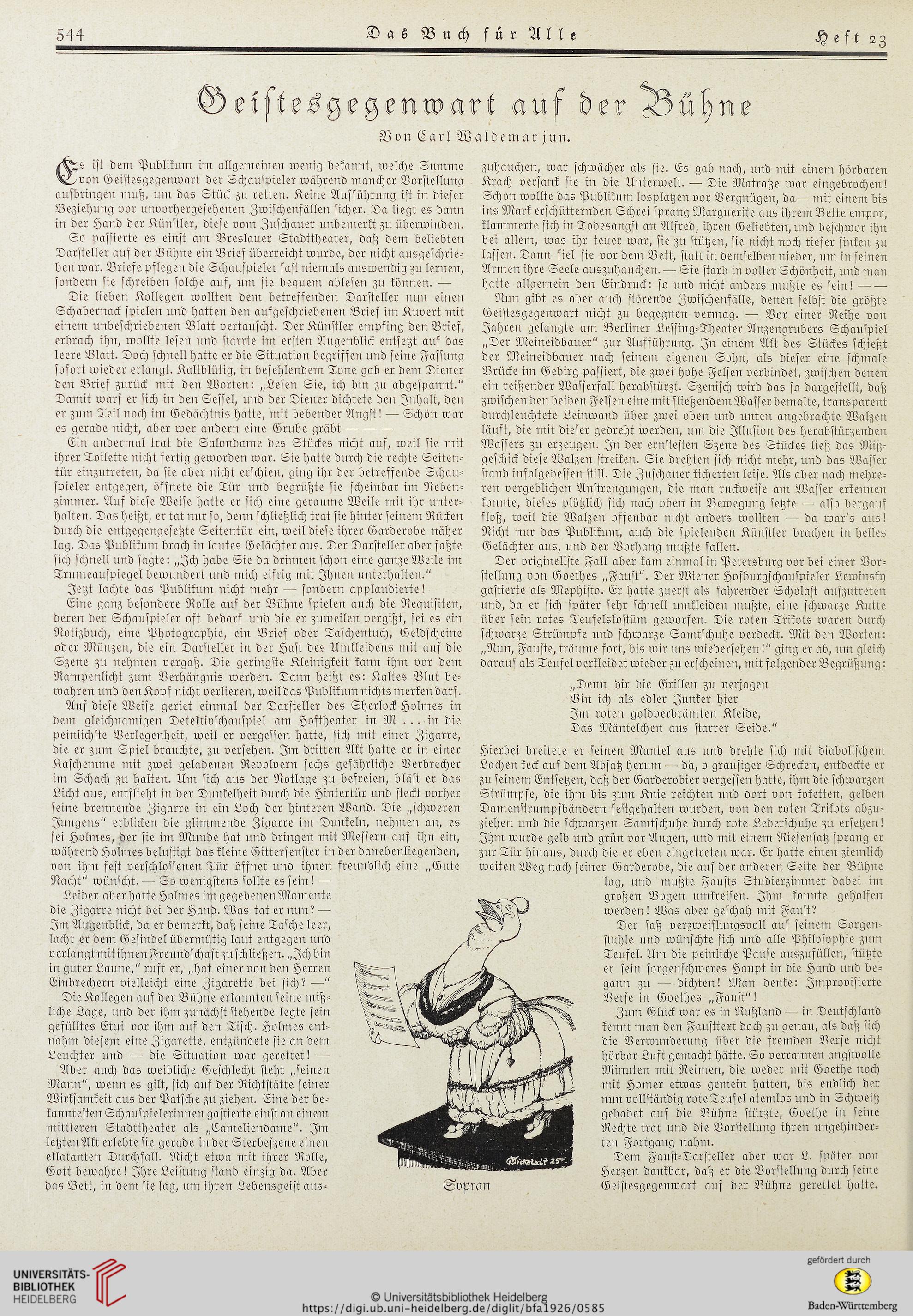544
D o:.s Buch fär Alle
H e ft 23
Geiſtesgesensw art auf der Bühne
Von Carl Waldemar jun.
E iſt dem Publikum im allgemeinen wenig bekannt, welche Summe
von Geiſtesgegenwart der Schauspieler während mancher Vorstellung
aufbringen muß, um das Stück zu retten. Keine Aufführung iſt in dieſer
Beziehung vor unvorhergesſehenen Zwiſchenfällen sicher. Da liegt es dann
in der Hand der Künſtler, dieſe vom Zuſchauer unbemerkt zu überwinden.
So passierte es einſt am Breslauer Stadttheater, daß dem beliebten
Darsteller auf der Bühne ein Brief überreicht wurde, der nicht ausgeschrie-
ben war. Briefe pflegen die Schauſpieler faſt niemals auswendig zu lernen,
ſondern Jie ſchreiben solche auf, um sie bequem ablesen zu können. +
Die lieben Kollegen wollten dem betreffenden Darsteller nun einen
Schabernatk ſpielen und hatten den aufgeschriebenen Brief im Kuvert mit
einem unbeschriebenen Blatt vertauſcht. Der Künſtler empfing den Brief,
erbrach ihn, wollte leſen und starrte im erſten Augenblick entsetzt auf das
leere Blatt. Doch ſchnell hatte er die Situation begriffen und seine Fassung
sofort wieder erlangt. Kaltblütig, in befehlendem Tone gab er dem Diener
den Brief zurück mit den Worten: „Lesen Sie, ich bin zu abgespannt.“
Damit warf er ſich in den Sessel, und der Diener dichtete den Inhalt, den
er zum Teil noch im Gedächtnis hatte, mit bebender Angſt! –~ Schön war
es gerade nicht, aber wer andern eine Grube gräbt .
Ein andermal trat die Salondame des Stückes nicht auf, weil sFie mit
ihrer Toilette nicht fertig geworden war. Sie hatte durch die rechte Seiten-
tür einzutreten, da Jie aber nicht erſchien, ging ihr der betreffende Schau-
ſpieler entgegen, öffnete die Tür und begrüßte sie ſcheinbar im Neben-
zimmer. Auf dieſe Weise hatte er ſich eine geraume Weile mit ihr unter-
halten. Das heißt, er tat nurso, denn ſchließlich tratJie hinter ſeinem Rücken
durch die entgegengesetzte Seitentür ein, weil dieſe ihrer Garderobe näher
lag. Das Publikum brach in lautes Gelächter aus. Der Darſteller aber faßte
sſich ſchnell und ſagte: „Ich habe Sie da drinnen ſchon eine ganze Weile im
Trumeauſpiegel bewundert und mich eifrig mit Ihnen unterhalten.“
Jetzt lachte das Publikum nicht mehr > sondern applaudierte!
Eine ganz besondere Rolle auf der Bühne ſpielen auch die Regquoſiten,
deren der Schauſpieler oft bedarf und die er zuweilen vergißt, sei es eim
Notizbuch, eine Photographie, ein Brief oder Taſchentuch, Geldſcheine
oder Münzen, die ein Darsteller in der Haſt des Umtleidens mit auf die
Szene zu nehmen vergaß. Die geringste Kleinigkeit kann ihm vor dem
Rampenlicht zum Verhängnis werden. Dann heißt es: Kaltes Blut be-
wahren und den Kopf nicht verlieren, weildas Publikummnichts merkendarf.
Auf dieſe Weiſe geriet einmal der Darſteller des Sherlock Holmes in
dem gleichnamigen Detektivſchauſpiel am Hoftheater in M ... in die
peinlichſte Verlegenheit, weil er vergessen hatte, ſich mit einer Zigarre,
die er zum Spiel brauchte, zu verſehen. Im dritten Att hatte er in einer
Kaſchemme mit zwei geladenen Revolvern ſechs gefährliche Verbrecher
im Schach zu halten. Um ſich aus der Notlage zu befreien, bläſt er das
Licht aus, entflieht in der Dunkelheit durch die Hintertür und ſteckt vorher
seine brennende Zigarre in ein Loch der hinteren Wand. Die ,ſchweren
Jungens" erblicken die glimmende Zigarre im Dunkeln, nehmen an, es
_ ſei Holmes, der ſie im Munde hat und dringen mit Messern auf ihn ein,
während Holmes beluſtigt das kleine Gitterfenster in der danebenliegenden,
von ihm feſt verſchloſſenen Tür öffnet und ihnen freundlich eine „Gute
Nacht" wünscht. + So wenigstens sollte es sein! +
Leider aber hatte Holmes im gegebenen Momente
die Zigarre nicht bei der Hand. Was tat ernun? +
Im Augenblick, da er bemerkt, daß ſeine Taſche leer,
lacht er dem Gesindel übermütig laut entgegen und
verlangtmitihnen Freundſchaftzuſchließen. „Ich bin
in guter Laune," ruft er, „hat einer von den Herren
Einbrechern vielleicht eine Zigarette bei sich? ~"
Die Kollegen auf der Bühne erkannten seine miß-
liche Lage, und der ihm zunächst ſtehende legte sein
gefülltes Etui vor ihm auf den Tiſch. Holmes ent-
nahm diesem eine Zigarette, entzündete ſie an dem
Leuchter und > die Situation war gerettet! +
Aber auch das weibliche Geschlecht ſteht ,„ſeinen
Mann“, wenn es gilt, ſich auf der Richtſtätte ſeiner
Wirksamkeit aus der Palsſche zu ziehen. Eine der be-
tannteſten Schauſpielerinnengaſtierte einſtan einem
mittleren Stadttheater als „Cameliendame“. Im
leiten Akt erlebteie gerade in der Sterbeszene einen
eklatanten Durchfall. Nicht etwa mit ihrer Rolle,
Gott bewahre! Ihre Leiſtung ſtand einzig da. Aber
das Bett, in dem ſie lag, um ihren Lebensgeiſt aus-
zuhauchen, war ſchwächer als ſie. Es gab nach, und mit einem hörbaren
Krach verſank sie in die Unterwelt. + Die Matratze war eingebrochen!
Schon wollte das Publikum losplatzen vor Vergnügen, damit einem bis
ins Mark erſchütternden Schrei ſprang Marguerite aus ihrem Bette empor,
klammerte sich in Todesangſt an Alfred, ihren Geliebten, und beschwor ihn
bei allem, was ihr teuer war, Jie zu ſtützen, ſie nicht noch tiefer ſinken zu
lassen. Dani fiel ſie vor dem Bett, ſtatt in demſelben nieder, um in ſeinen
Armen ihre Seele auszuhauchen. Sie ſtarb in voller Schönheit, und man
hatte allgemein den Eindrutk: so und nicht anders mußte es sein
Nun gibt es aber auch ſtörende Zwiſchenfälle, denen ſselbſt die größte
Geiſtesgegenwart nicht zu begegnen vermag. + Vor einer Reihe von
Jahren gelangte am Berliner Lessing-Theater Anzengrubers Schauſpiel
„Der Meineidbauer" zur Aufführung. In einem Att des Stückes ſchießt
der Meineidbauer nach ſeinem eigenen Sohn, als dieser eine ſchmale
Brücke im Gebirg pasſiert, die zwei hohe Felsen verbindet, zwischen denen
ein reißender Wasserfall herabſtürzt. Szeniſch wird das so dargeſtellt, daß
zwiſchen den beiden Felſen eine mit fließendem Wasser bemalte, transparent
durchleuchtete Leinwand über zwei oben und unten angebrachte Walzen
läuft, die mit dieser gedreht werden, um die Illioſion des herabſtürzenden
Waſſsers zu erzeugen. In der ernſteſten Szene des Stückes ließ das Miß-
geſchick dieſe Walzen ſtreiken. Sie drehten Jich nicht mehr, und das Wasser
ſtand infolgedessen ſtill. Die Zuſchauer kicherten leiſe. Als aber nach mehre-
ren vergeblichen Anſtrengungen, die man ruckweiſe am Wasser erkennen
konnte, dieſes plötzlich ſich nach oben in Bewegung sette + alſo bergauf
floß, weil die Walzen offenbar nicht anders wollten + da war's aus!
Nicht nur das Publikum, auch die spielenden Künſtler brachen in helles
Gelächter aus, und der Vorhang mußte fallen.
Der originellſte Fall aber kam einmal in Petersburg vor bei einer Vor-
ſtellung von Goethes „Fauſt“. Der Wiener Hofburgschauſpieler Lewinsky
gastierte als Mephiſto. Er hatte zuerſt als fahrender Scholaſt aufzutreten
und, da er Jich ſpäter sehr ſchnell umkleiden mußte, eine ſchwarze Kutte
über ſein rotes Teufelskoſtüm geworfen. Die roten Trikots waren durch
ſchwarze Strümpfe und ſchwarze Samtsſchuhe verdeckt. Mit den Worten:
„Nun, Fauſte, träume fort, bis wir uns wiedersehen!" ging er ab, um gleich
darauf als Teufel verkleidet wieder zu erſcheinen, mit folgender Begrüßung:
„Denn dir die Grillen zu verjagen
Bin ich als edler Junker hier
Im roten goldverbrämten Rleide,
Das Mäntelchen aus ſtarrer Seide.“
Hierbei breitete er seinen Mantel aus und drehte ſich mit diaboliſchem
Lachen keck auf dem Absſatß herum + da, o grau iger Schrecken, entdeckte er
zu ſeinem Entsetzen, daß der Garderobier vergessen hatte, ihm die ſchwarzen
Strümpfe, die ihm bis zum Knie reichten und dort von koketten, gelben
Damenſtrumpfbändern feſtgehalten wurden, von den roten Trikots abzu-
ziehen und die ſchwarzen Samtſchuhe durch rote Lederſchuhe zu erſeten!
Ihm wurde gelb und grün vor Augen, und mit einem Riesensatz ſprang er
zur Tür hinaus, durch die er eben eingetreten war. Er hatte einen ziemlich
weiten Weg nach ſeiner Garderobe, die auf der anderen Seite der Bühne
lag, und mußte Fauſts Studierzimmer dabei im
großen Bogen umtkreiſen. Ihm konnte geholfen
werden! Was aber geſchah mit Fauſt?
Der saß verzweiflungsvoll auf ſeinem Sorgen-
ſtuhle und wünschte ſich und alle Philosophie zum
Teufel. Um die peinliche Pause auszufüllen, ſtützte
er sein sſorgenſchweres Haupt in die Hand und be-
gann zu . dichten! Man denke: Improvſſierte
Verſe in Goethes „Fauſt"!
Zum Glück war es in Rußland = in Deutſchland
kennt man den Fauſttext doch zu genau, als daß dich
die Verwunderung über die fremden Verse nicht
hörbar Luft gemacht hätte. So verrannen anglſtvolle
Minuten mit Reimen, die weder mit Goethe noch
mit Homer etwas gemein hatten, bis endlich der
nun vollſtändig rote Teufel atemlos und in Schweiß
gebadet auf die Bühne ſtürzte, Goethe in ſeine
Rechte trat und die Vorstellung ihren ungehinder-
ten Fortgang nahm.
Dem Fauſt-Darsſteller aber war L. ſpäter von
Herzen dankbar, daß er die Vorſtellung durch ſeine
Geiſtesgegenwart auf der Bühne gerettet hatte.
D o:.s Buch fär Alle
H e ft 23
Geiſtesgesensw art auf der Bühne
Von Carl Waldemar jun.
E iſt dem Publikum im allgemeinen wenig bekannt, welche Summe
von Geiſtesgegenwart der Schauspieler während mancher Vorstellung
aufbringen muß, um das Stück zu retten. Keine Aufführung iſt in dieſer
Beziehung vor unvorhergesſehenen Zwiſchenfällen sicher. Da liegt es dann
in der Hand der Künſtler, dieſe vom Zuſchauer unbemerkt zu überwinden.
So passierte es einſt am Breslauer Stadttheater, daß dem beliebten
Darsteller auf der Bühne ein Brief überreicht wurde, der nicht ausgeschrie-
ben war. Briefe pflegen die Schauſpieler faſt niemals auswendig zu lernen,
ſondern Jie ſchreiben solche auf, um sie bequem ablesen zu können. +
Die lieben Kollegen wollten dem betreffenden Darsteller nun einen
Schabernatk ſpielen und hatten den aufgeschriebenen Brief im Kuvert mit
einem unbeschriebenen Blatt vertauſcht. Der Künſtler empfing den Brief,
erbrach ihn, wollte leſen und starrte im erſten Augenblick entsetzt auf das
leere Blatt. Doch ſchnell hatte er die Situation begriffen und seine Fassung
sofort wieder erlangt. Kaltblütig, in befehlendem Tone gab er dem Diener
den Brief zurück mit den Worten: „Lesen Sie, ich bin zu abgespannt.“
Damit warf er ſich in den Sessel, und der Diener dichtete den Inhalt, den
er zum Teil noch im Gedächtnis hatte, mit bebender Angſt! –~ Schön war
es gerade nicht, aber wer andern eine Grube gräbt .
Ein andermal trat die Salondame des Stückes nicht auf, weil sFie mit
ihrer Toilette nicht fertig geworden war. Sie hatte durch die rechte Seiten-
tür einzutreten, da Jie aber nicht erſchien, ging ihr der betreffende Schau-
ſpieler entgegen, öffnete die Tür und begrüßte sie ſcheinbar im Neben-
zimmer. Auf dieſe Weise hatte er ſich eine geraume Weile mit ihr unter-
halten. Das heißt, er tat nurso, denn ſchließlich tratJie hinter ſeinem Rücken
durch die entgegengesetzte Seitentür ein, weil dieſe ihrer Garderobe näher
lag. Das Publikum brach in lautes Gelächter aus. Der Darſteller aber faßte
sſich ſchnell und ſagte: „Ich habe Sie da drinnen ſchon eine ganze Weile im
Trumeauſpiegel bewundert und mich eifrig mit Ihnen unterhalten.“
Jetzt lachte das Publikum nicht mehr > sondern applaudierte!
Eine ganz besondere Rolle auf der Bühne ſpielen auch die Regquoſiten,
deren der Schauſpieler oft bedarf und die er zuweilen vergißt, sei es eim
Notizbuch, eine Photographie, ein Brief oder Taſchentuch, Geldſcheine
oder Münzen, die ein Darsteller in der Haſt des Umtleidens mit auf die
Szene zu nehmen vergaß. Die geringste Kleinigkeit kann ihm vor dem
Rampenlicht zum Verhängnis werden. Dann heißt es: Kaltes Blut be-
wahren und den Kopf nicht verlieren, weildas Publikummnichts merkendarf.
Auf dieſe Weiſe geriet einmal der Darſteller des Sherlock Holmes in
dem gleichnamigen Detektivſchauſpiel am Hoftheater in M ... in die
peinlichſte Verlegenheit, weil er vergessen hatte, ſich mit einer Zigarre,
die er zum Spiel brauchte, zu verſehen. Im dritten Att hatte er in einer
Kaſchemme mit zwei geladenen Revolvern ſechs gefährliche Verbrecher
im Schach zu halten. Um ſich aus der Notlage zu befreien, bläſt er das
Licht aus, entflieht in der Dunkelheit durch die Hintertür und ſteckt vorher
seine brennende Zigarre in ein Loch der hinteren Wand. Die ,ſchweren
Jungens" erblicken die glimmende Zigarre im Dunkeln, nehmen an, es
_ ſei Holmes, der ſie im Munde hat und dringen mit Messern auf ihn ein,
während Holmes beluſtigt das kleine Gitterfenster in der danebenliegenden,
von ihm feſt verſchloſſenen Tür öffnet und ihnen freundlich eine „Gute
Nacht" wünscht. + So wenigstens sollte es sein! +
Leider aber hatte Holmes im gegebenen Momente
die Zigarre nicht bei der Hand. Was tat ernun? +
Im Augenblick, da er bemerkt, daß ſeine Taſche leer,
lacht er dem Gesindel übermütig laut entgegen und
verlangtmitihnen Freundſchaftzuſchließen. „Ich bin
in guter Laune," ruft er, „hat einer von den Herren
Einbrechern vielleicht eine Zigarette bei sich? ~"
Die Kollegen auf der Bühne erkannten seine miß-
liche Lage, und der ihm zunächst ſtehende legte sein
gefülltes Etui vor ihm auf den Tiſch. Holmes ent-
nahm diesem eine Zigarette, entzündete ſie an dem
Leuchter und > die Situation war gerettet! +
Aber auch das weibliche Geschlecht ſteht ,„ſeinen
Mann“, wenn es gilt, ſich auf der Richtſtätte ſeiner
Wirksamkeit aus der Palsſche zu ziehen. Eine der be-
tannteſten Schauſpielerinnengaſtierte einſtan einem
mittleren Stadttheater als „Cameliendame“. Im
leiten Akt erlebteie gerade in der Sterbeszene einen
eklatanten Durchfall. Nicht etwa mit ihrer Rolle,
Gott bewahre! Ihre Leiſtung ſtand einzig da. Aber
das Bett, in dem ſie lag, um ihren Lebensgeiſt aus-
zuhauchen, war ſchwächer als ſie. Es gab nach, und mit einem hörbaren
Krach verſank sie in die Unterwelt. + Die Matratze war eingebrochen!
Schon wollte das Publikum losplatzen vor Vergnügen, damit einem bis
ins Mark erſchütternden Schrei ſprang Marguerite aus ihrem Bette empor,
klammerte sich in Todesangſt an Alfred, ihren Geliebten, und beschwor ihn
bei allem, was ihr teuer war, Jie zu ſtützen, ſie nicht noch tiefer ſinken zu
lassen. Dani fiel ſie vor dem Bett, ſtatt in demſelben nieder, um in ſeinen
Armen ihre Seele auszuhauchen. Sie ſtarb in voller Schönheit, und man
hatte allgemein den Eindrutk: so und nicht anders mußte es sein
Nun gibt es aber auch ſtörende Zwiſchenfälle, denen ſselbſt die größte
Geiſtesgegenwart nicht zu begegnen vermag. + Vor einer Reihe von
Jahren gelangte am Berliner Lessing-Theater Anzengrubers Schauſpiel
„Der Meineidbauer" zur Aufführung. In einem Att des Stückes ſchießt
der Meineidbauer nach ſeinem eigenen Sohn, als dieser eine ſchmale
Brücke im Gebirg pasſiert, die zwei hohe Felsen verbindet, zwischen denen
ein reißender Wasserfall herabſtürzt. Szeniſch wird das so dargeſtellt, daß
zwiſchen den beiden Felſen eine mit fließendem Wasser bemalte, transparent
durchleuchtete Leinwand über zwei oben und unten angebrachte Walzen
läuft, die mit dieser gedreht werden, um die Illioſion des herabſtürzenden
Waſſsers zu erzeugen. In der ernſteſten Szene des Stückes ließ das Miß-
geſchick dieſe Walzen ſtreiken. Sie drehten Jich nicht mehr, und das Wasser
ſtand infolgedessen ſtill. Die Zuſchauer kicherten leiſe. Als aber nach mehre-
ren vergeblichen Anſtrengungen, die man ruckweiſe am Wasser erkennen
konnte, dieſes plötzlich ſich nach oben in Bewegung sette + alſo bergauf
floß, weil die Walzen offenbar nicht anders wollten + da war's aus!
Nicht nur das Publikum, auch die spielenden Künſtler brachen in helles
Gelächter aus, und der Vorhang mußte fallen.
Der originellſte Fall aber kam einmal in Petersburg vor bei einer Vor-
ſtellung von Goethes „Fauſt“. Der Wiener Hofburgschauſpieler Lewinsky
gastierte als Mephiſto. Er hatte zuerſt als fahrender Scholaſt aufzutreten
und, da er Jich ſpäter sehr ſchnell umkleiden mußte, eine ſchwarze Kutte
über ſein rotes Teufelskoſtüm geworfen. Die roten Trikots waren durch
ſchwarze Strümpfe und ſchwarze Samtsſchuhe verdeckt. Mit den Worten:
„Nun, Fauſte, träume fort, bis wir uns wiedersehen!" ging er ab, um gleich
darauf als Teufel verkleidet wieder zu erſcheinen, mit folgender Begrüßung:
„Denn dir die Grillen zu verjagen
Bin ich als edler Junker hier
Im roten goldverbrämten Rleide,
Das Mäntelchen aus ſtarrer Seide.“
Hierbei breitete er seinen Mantel aus und drehte ſich mit diaboliſchem
Lachen keck auf dem Absſatß herum + da, o grau iger Schrecken, entdeckte er
zu ſeinem Entsetzen, daß der Garderobier vergessen hatte, ihm die ſchwarzen
Strümpfe, die ihm bis zum Knie reichten und dort von koketten, gelben
Damenſtrumpfbändern feſtgehalten wurden, von den roten Trikots abzu-
ziehen und die ſchwarzen Samtſchuhe durch rote Lederſchuhe zu erſeten!
Ihm wurde gelb und grün vor Augen, und mit einem Riesensatz ſprang er
zur Tür hinaus, durch die er eben eingetreten war. Er hatte einen ziemlich
weiten Weg nach ſeiner Garderobe, die auf der anderen Seite der Bühne
lag, und mußte Fauſts Studierzimmer dabei im
großen Bogen umtkreiſen. Ihm konnte geholfen
werden! Was aber geſchah mit Fauſt?
Der saß verzweiflungsvoll auf ſeinem Sorgen-
ſtuhle und wünschte ſich und alle Philosophie zum
Teufel. Um die peinliche Pause auszufüllen, ſtützte
er sein sſorgenſchweres Haupt in die Hand und be-
gann zu . dichten! Man denke: Improvſſierte
Verſe in Goethes „Fauſt"!
Zum Glück war es in Rußland = in Deutſchland
kennt man den Fauſttext doch zu genau, als daß dich
die Verwunderung über die fremden Verse nicht
hörbar Luft gemacht hätte. So verrannen anglſtvolle
Minuten mit Reimen, die weder mit Goethe noch
mit Homer etwas gemein hatten, bis endlich der
nun vollſtändig rote Teufel atemlos und in Schweiß
gebadet auf die Bühne ſtürzte, Goethe in ſeine
Rechte trat und die Vorstellung ihren ungehinder-
ten Fortgang nahm.
Dem Fauſt-Darsſteller aber war L. ſpäter von
Herzen dankbar, daß er die Vorſtellung durch ſeine
Geiſtesgegenwart auf der Bühne gerettet hatte.