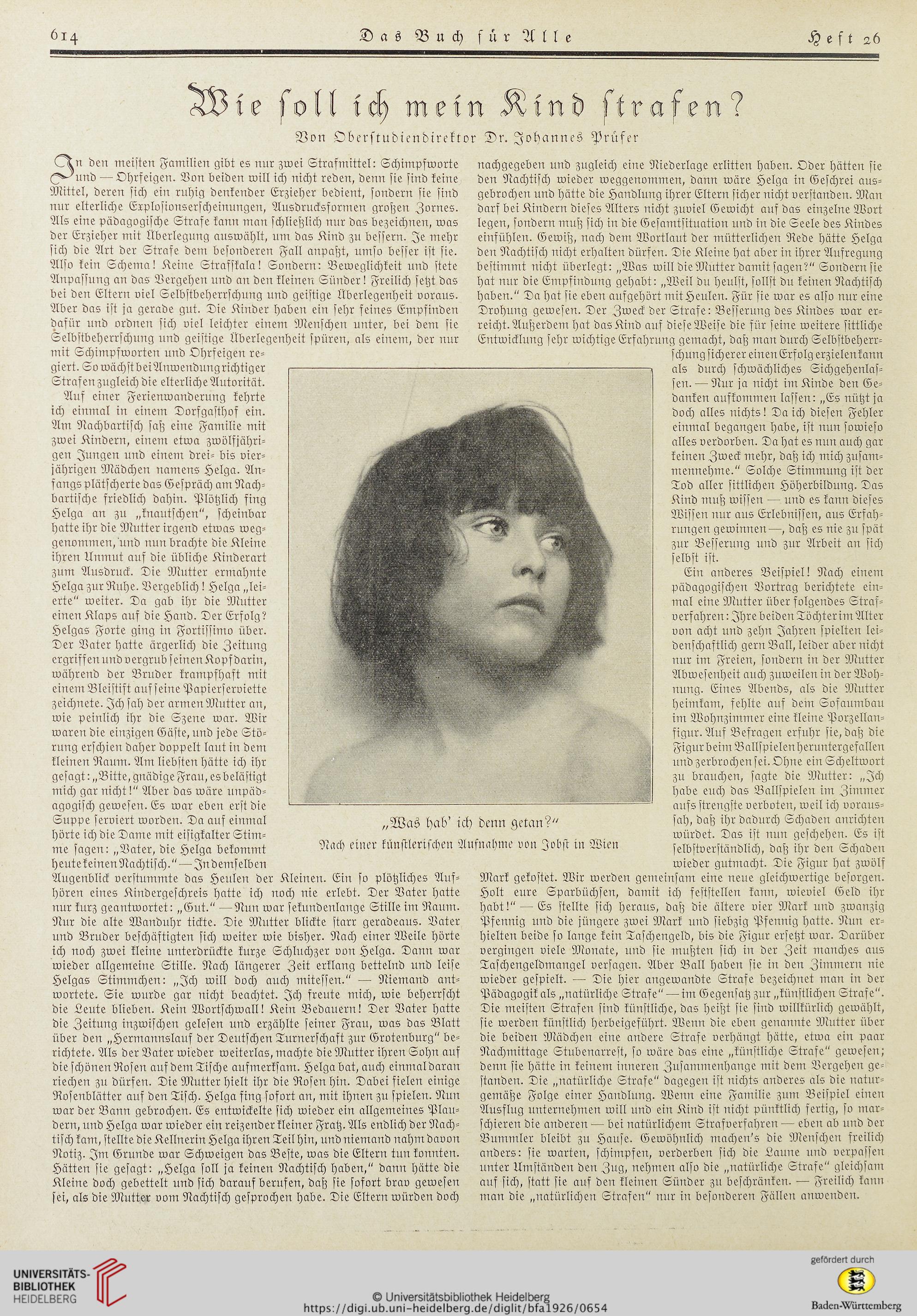614
D a s B u <. f ür Alle
H e ft 26
Wie soll ich mein Kind ſtrafen?
Von Oberstudiendirektor Or. Johannes Prüfer
I den meiſten Familien gibt es nur zwei Strafmittel: Schimpfworte
und ~ Ohrfeigen. Von beiden will ich nicht reden, denn Jie ſind keine
Mittel, deren Jich ein ruhig denkender Erzieher bedient, sondern Jie ſind
nur elterliche Exploſionserſcheinungen, Ausdrucksformen großen Zornes.
Als eine pädagogiſche Strafe kann man ſchließlich nur das bezeichnen, was
der Erzieher mit Überlegung auswählt, um das Kind zu bessern. Je mehr
ſich die Art der Strafe dem besonderen Fall anpaßt, umso besser ist ie.
Alſo kein Schema! Keine Strafskala! Sondern: Beweglichkeit und stete
Anpassung an das Vergehen und an den kleinen Sünder! Freilich ſett das
bei den Eltern viel Selbſtbeherrſchung und geiſtige Überlegenheit voraus.
Aber das iſt ja gerade gut. Die Kinder haben ein sehr feines Empfinden
dafür und ordnen ſich viel leichter einem Menſchen unter, bei dem ie
Selbſtbeherrſchung und geiſtige Überlegenheit spüren, als einem, der nur
mit Schimpfworten und Ohrfeigen re-
giert. So wächſtbei Anwendungrichtiger
nachgegeben und zugleich eine Niederlage erlitten haben. Oder hätten sie
den Nachtiſch wieder weggenommen, dann wäre Helga in Geschrei aus-
gebrochen und hätte die Handlung ihrer Eltern ſicher nicht verſtanden. Man
darf bei Kindern dieses Alters nicht zuviel Gewicht auf das einzelne Wort
legen, ſondern muß ich in die Gesamtsituation und in die Seele des Kindes
einfühlen. Gewiß, nach dem Wortlaut der mütterlichen Rede hätte Helga
den Nachtiſch nicht erhalten dürfen. Die Kleine hat aber in ihrer Aufregung
beſtimmt nicht überlegt: „Was will die Mutter damitsſagen?“ Sondern ie
hat nur die Empfindung gehabt: „Weil du heulſt, ſollſt du keinen Nachtisch
haben." Da hat ie eben aufgehört mit Heulen. Für ie war es alſo nur eine
Drohung gewesen. Der Zweck der Strafe: Besserung des Kindes war er-
reicht. Außerdem hat das Kind auf dieſe Weise die für ſeine weitere Tittliche
Entwicklung ſehr wichtige Erfahrung gemacht, daß man durch Selbstbeherr-
ſchungsicherer einen Erfolg erzielenkann
Strafenzugleich die elterliche Autorität.
Auf einer Ferienwanderung kehrte
ich einmal in einem Dorfgasthof ein.
Am Nachbartiſch saß eine Familie mit
zwei Kindern, einem etwa zwölfjähri-
gen Jungen und einem drei- bis vier-
jährigen Mädchen namens Helga. An-
fangs plätſcherte das Gespräch am Nach-
bartiſche friedlich dahin. Plötzlich fing
Helga an zu q,fknautſchen“, ſcheinbar
hatte ihr die Mutter irgend etwas weg-
genommen, und nun brachte die Kleine
ihren Unmut auf die übliche Kinderart
zum Ausdruck. Die Mutter ermahnte
Helga zur Ruhe. Vergeblich ! Helga , lei-
erte" weiter. Da gab ihr die Mutter
einen Klaps auf die Hand. Der Erfolg?
Helgas Forte ging in Fortissimo über.
Der Vater hatte ärgerlich die Zeitung
ergriffenund vergrubſeinen Kopfdarin,
während der Bruder krampfhaft mit
einem Bleiſtiſt aufseine Papierserviette
zeichnete. Ichſah der armen Mutter an,
wie peinlich ihr die Szene war. Wir
waren die einzigen Gäſte, und jede Stö-
rung erſchien daher doppelt laut in dem
kleinen Raum. Am liebsten hätte ich ihr
geſagt: „Bitte, gnädige Frau, esbeläſtigt
mich gar nicht !" Aber das wäre unpäd-
als durch ſchwächliches Sichgehenlaſ-
| sen. Nurja nicht im Kinde den Ge-
danken aufkommen lassen: „Es nützt ja
doch alles nichts! Da ich dieſen Fehler
einmal begangen habe, iſt nun ſowieso
alles verdorben. Da hat es nun auch gar
keinen Zweck mehr, daß ich mich zusam-
mennehme.“ Solche Stimmung iſt der
Tod aller Jittlichen Höherbildung. Das
Kind muß wissen > und es kann dieses
Wissen nur aus Erlebnissen, aus Erfah-
rungen gewinnen, daß es nie zu ſpät
zur Besserung und zur Arbeit an ſich
sſelbſt iſt.
Ein anderes Beisſpiel! Nach einem
pädagogiſchen Vortrag berichtete ein-
mal eine Mutter über folgendes Straf-
verfahren: Ihre beiden Töchterim Alter
von acht und zehn Jahren ſpielten lei-
denschaftlich gern Ball, leider aber nicht
nur im Freien, sondern in der Mutter
Abwesenheit auch zuweilen in der Woh-
nung. Eines Abends, als die Mutter
heimkam, fehlte auf dem Sofaumbau
im Wohnzimmer eine kleine Porzellan-
figur. Auf Befragen erfuhr Jie, daß die
Figur beim Ballſpielenheruntergefallen
undzerbrochensei. Ohne ein Scheltwort
zu brauchen, sagte die Mutter: „Ich
habe euch das Ballſpielen im Zimmer
agogiſch gewesen. Es war eben erſt die
Suppe serviert worden. Da auf einmal
hörte ich die Dame mit eiſigkalter Stim-
me sagen: „Vater, die Helga bekommt
heutekeinen Nachtiſch." Indem elben
Augenblick verſtummte das Heulen der Kleinen. Ein so plötzliches Auf-
hören eines Kindergeschreis hatte ich noch nie erlebt. Der Vater hatte
nur kurz geantwortet: „Gut." Nun war sekundenlange Stille im Raum.
Nur die alte Wanduhr tickte. Die Mutter blickte ſtarr geradeaus. Vater
und Bruder beschäftigten ſich weiter wie bisher. Nach einer Weile hörte
ich noch zwei kleine unterdrückte kurze Schluchzer von Helga. Dann war
wieder allgemeine Stille. Nach längerer Zeit erklang bettelnd und leiſe
Helgas Stimmchen: „Ich will doch auch miteſſen." –~ Niemand ant-
wortete. Sie wurde gar nicht beachtet. Ich freute mich, wie beherrſcht
die Leute blieben. Kein Wortſchwall! Kein Bedauern! Der Vater hatte
die Zeitung inzwischen gelesen und erzählte seiner Frau, was das Blatt
über den „Hermannslauf der Deutſchen Turnersſchaft zur Grotenburg“ be-
richtete. Als der Vater wieder weiterlas, machte die Mutter ihren Sohn auf
die ſchönen Rosen auf dem Tiſche aufmerksam. Helga bat, auch einmaldaran
riechen zu dürfen. Die Mutter hielt ihr die Rosen hin. Dabei fielen einige
Rosenblätter auf den Tiſch. Helga fing sofort an, mit ihnen zu ſpielen. Nun
war der Bann gebrochen. Es entwickelte ſich wieder ein allgemeines Plau-
dern, und Helga war wieder ein reizender kleiner Fratz. Als endlich der Nach-
tiſch kam, ſtellte die Kellnerin Helga ihren Teil hin, und niemand nahm davon
Notiz. Im Grunde war Schweigen das Beſte, was die Eltern tun konnten.
Hätten sie geſagt: „Helga soll ja keinen Nachtiſch haben,“ dann hätte die
Kleine doch gebettelt und ſich darauf berufen, daß sie ſofort brav gewesen
ſei, als die Mutter vom Nachtisch geſprochen habe. Die Eltern würden doch
„Was hab' ich denn getan?“
Nach einer künſtleriſchen Aufnahme von Jobst in Wien
aufs ſtrengſte verboten, weil ich voraus-
sah, daß ihr dadurch Schaden anrichten
würdet. Das iſt nun geschehen. Es iſt
ſelbſtversſtändlich, daß ihr den Schaden
wieder gutmacht. Die Figur hat zwölf
Mark gekoſtet. Wir werden gemeinsam eine neue gleichwertige beſorgen.
Holt eure Sparbüchſen, damit ich feſtſtellen kann, wieviel Geld ihr
habt!“ ~ Es ſtellte ſich heraus, daß die ältere vier Mark und zwanzig
Pfennig und die jüngere zwei Mark und Tiebzig Pfennig hatte. Nun er-
hielten beide ſo lange kein Taſchengeld, bis die Figur erſett war. Darüber
vergingen viele Monate, und sie mußten sich in der Zeit manches aus
Taſchengeldmangel versagen. Aber Ball haben sie in den Zimmern nie
wieder gesſpielt. + Die hier angewandte Strafe bezeichnet man in der
Pädagogik als „natürliche Strafe" im Gegensatz zur „künſtlichen Strafe".
Die meisten Strafen sind künſtliche, das heißt sie ſind willkürlich gewählt,
ſie werden künſtlich herbeigeführt. Wenn die eben genannte Mutter über
die beiden Mädchen eine andere Strafe verhängt hätte, etwa ein paar
Nachmittage Stubenarreſt, ſo wäre das eine „künſtliche Strafe“ gewesen;
denn sie hätte in keinem inneren Zusammenhange mit dem Vergehen ge-
ſtanden. Die „natürliche Strafe“ dagegen iſt nichts anderes als die natur-
gemäße Folge einer Handlung. Wenn eine Familie zum Beiſpiel einen
Ausflug unternehmen will und ein Kind iſt nicht pünktlich fertig, ſo mar-
ſchieren die anderen > bei natürlichem Strafverfahren + eben ab und der
Bummler bleibt zu Hauſe. Gewöhnlich machen's die Menſchen freilich
anders: sie warten, ſchimpfen, verderben Jich die Laune und verpassen
unter Umständen den Zug, nehmen also die „natürliche Strafe" gleichſam
auf sich, ſtatt sie auf den kleinen Sünder zu beschränken. ~ Freilich kann
man die „natürlichen Strafen“ nur in besonderen Fällen anwenden.
D a s B u <. f ür Alle
H e ft 26
Wie soll ich mein Kind ſtrafen?
Von Oberstudiendirektor Or. Johannes Prüfer
I den meiſten Familien gibt es nur zwei Strafmittel: Schimpfworte
und ~ Ohrfeigen. Von beiden will ich nicht reden, denn Jie ſind keine
Mittel, deren Jich ein ruhig denkender Erzieher bedient, sondern Jie ſind
nur elterliche Exploſionserſcheinungen, Ausdrucksformen großen Zornes.
Als eine pädagogiſche Strafe kann man ſchließlich nur das bezeichnen, was
der Erzieher mit Überlegung auswählt, um das Kind zu bessern. Je mehr
ſich die Art der Strafe dem besonderen Fall anpaßt, umso besser ist ie.
Alſo kein Schema! Keine Strafskala! Sondern: Beweglichkeit und stete
Anpassung an das Vergehen und an den kleinen Sünder! Freilich ſett das
bei den Eltern viel Selbſtbeherrſchung und geiſtige Überlegenheit voraus.
Aber das iſt ja gerade gut. Die Kinder haben ein sehr feines Empfinden
dafür und ordnen ſich viel leichter einem Menſchen unter, bei dem ie
Selbſtbeherrſchung und geiſtige Überlegenheit spüren, als einem, der nur
mit Schimpfworten und Ohrfeigen re-
giert. So wächſtbei Anwendungrichtiger
nachgegeben und zugleich eine Niederlage erlitten haben. Oder hätten sie
den Nachtiſch wieder weggenommen, dann wäre Helga in Geschrei aus-
gebrochen und hätte die Handlung ihrer Eltern ſicher nicht verſtanden. Man
darf bei Kindern dieses Alters nicht zuviel Gewicht auf das einzelne Wort
legen, ſondern muß ich in die Gesamtsituation und in die Seele des Kindes
einfühlen. Gewiß, nach dem Wortlaut der mütterlichen Rede hätte Helga
den Nachtiſch nicht erhalten dürfen. Die Kleine hat aber in ihrer Aufregung
beſtimmt nicht überlegt: „Was will die Mutter damitsſagen?“ Sondern ie
hat nur die Empfindung gehabt: „Weil du heulſt, ſollſt du keinen Nachtisch
haben." Da hat ie eben aufgehört mit Heulen. Für ie war es alſo nur eine
Drohung gewesen. Der Zweck der Strafe: Besserung des Kindes war er-
reicht. Außerdem hat das Kind auf dieſe Weise die für ſeine weitere Tittliche
Entwicklung ſehr wichtige Erfahrung gemacht, daß man durch Selbstbeherr-
ſchungsicherer einen Erfolg erzielenkann
Strafenzugleich die elterliche Autorität.
Auf einer Ferienwanderung kehrte
ich einmal in einem Dorfgasthof ein.
Am Nachbartiſch saß eine Familie mit
zwei Kindern, einem etwa zwölfjähri-
gen Jungen und einem drei- bis vier-
jährigen Mädchen namens Helga. An-
fangs plätſcherte das Gespräch am Nach-
bartiſche friedlich dahin. Plötzlich fing
Helga an zu q,fknautſchen“, ſcheinbar
hatte ihr die Mutter irgend etwas weg-
genommen, und nun brachte die Kleine
ihren Unmut auf die übliche Kinderart
zum Ausdruck. Die Mutter ermahnte
Helga zur Ruhe. Vergeblich ! Helga , lei-
erte" weiter. Da gab ihr die Mutter
einen Klaps auf die Hand. Der Erfolg?
Helgas Forte ging in Fortissimo über.
Der Vater hatte ärgerlich die Zeitung
ergriffenund vergrubſeinen Kopfdarin,
während der Bruder krampfhaft mit
einem Bleiſtiſt aufseine Papierserviette
zeichnete. Ichſah der armen Mutter an,
wie peinlich ihr die Szene war. Wir
waren die einzigen Gäſte, und jede Stö-
rung erſchien daher doppelt laut in dem
kleinen Raum. Am liebsten hätte ich ihr
geſagt: „Bitte, gnädige Frau, esbeläſtigt
mich gar nicht !" Aber das wäre unpäd-
als durch ſchwächliches Sichgehenlaſ-
| sen. Nurja nicht im Kinde den Ge-
danken aufkommen lassen: „Es nützt ja
doch alles nichts! Da ich dieſen Fehler
einmal begangen habe, iſt nun ſowieso
alles verdorben. Da hat es nun auch gar
keinen Zweck mehr, daß ich mich zusam-
mennehme.“ Solche Stimmung iſt der
Tod aller Jittlichen Höherbildung. Das
Kind muß wissen > und es kann dieses
Wissen nur aus Erlebnissen, aus Erfah-
rungen gewinnen, daß es nie zu ſpät
zur Besserung und zur Arbeit an ſich
sſelbſt iſt.
Ein anderes Beisſpiel! Nach einem
pädagogiſchen Vortrag berichtete ein-
mal eine Mutter über folgendes Straf-
verfahren: Ihre beiden Töchterim Alter
von acht und zehn Jahren ſpielten lei-
denschaftlich gern Ball, leider aber nicht
nur im Freien, sondern in der Mutter
Abwesenheit auch zuweilen in der Woh-
nung. Eines Abends, als die Mutter
heimkam, fehlte auf dem Sofaumbau
im Wohnzimmer eine kleine Porzellan-
figur. Auf Befragen erfuhr Jie, daß die
Figur beim Ballſpielenheruntergefallen
undzerbrochensei. Ohne ein Scheltwort
zu brauchen, sagte die Mutter: „Ich
habe euch das Ballſpielen im Zimmer
agogiſch gewesen. Es war eben erſt die
Suppe serviert worden. Da auf einmal
hörte ich die Dame mit eiſigkalter Stim-
me sagen: „Vater, die Helga bekommt
heutekeinen Nachtiſch." Indem elben
Augenblick verſtummte das Heulen der Kleinen. Ein so plötzliches Auf-
hören eines Kindergeschreis hatte ich noch nie erlebt. Der Vater hatte
nur kurz geantwortet: „Gut." Nun war sekundenlange Stille im Raum.
Nur die alte Wanduhr tickte. Die Mutter blickte ſtarr geradeaus. Vater
und Bruder beschäftigten ſich weiter wie bisher. Nach einer Weile hörte
ich noch zwei kleine unterdrückte kurze Schluchzer von Helga. Dann war
wieder allgemeine Stille. Nach längerer Zeit erklang bettelnd und leiſe
Helgas Stimmchen: „Ich will doch auch miteſſen." –~ Niemand ant-
wortete. Sie wurde gar nicht beachtet. Ich freute mich, wie beherrſcht
die Leute blieben. Kein Wortſchwall! Kein Bedauern! Der Vater hatte
die Zeitung inzwischen gelesen und erzählte seiner Frau, was das Blatt
über den „Hermannslauf der Deutſchen Turnersſchaft zur Grotenburg“ be-
richtete. Als der Vater wieder weiterlas, machte die Mutter ihren Sohn auf
die ſchönen Rosen auf dem Tiſche aufmerksam. Helga bat, auch einmaldaran
riechen zu dürfen. Die Mutter hielt ihr die Rosen hin. Dabei fielen einige
Rosenblätter auf den Tiſch. Helga fing sofort an, mit ihnen zu ſpielen. Nun
war der Bann gebrochen. Es entwickelte ſich wieder ein allgemeines Plau-
dern, und Helga war wieder ein reizender kleiner Fratz. Als endlich der Nach-
tiſch kam, ſtellte die Kellnerin Helga ihren Teil hin, und niemand nahm davon
Notiz. Im Grunde war Schweigen das Beſte, was die Eltern tun konnten.
Hätten sie geſagt: „Helga soll ja keinen Nachtiſch haben,“ dann hätte die
Kleine doch gebettelt und ſich darauf berufen, daß sie ſofort brav gewesen
ſei, als die Mutter vom Nachtisch geſprochen habe. Die Eltern würden doch
„Was hab' ich denn getan?“
Nach einer künſtleriſchen Aufnahme von Jobst in Wien
aufs ſtrengſte verboten, weil ich voraus-
sah, daß ihr dadurch Schaden anrichten
würdet. Das iſt nun geschehen. Es iſt
ſelbſtversſtändlich, daß ihr den Schaden
wieder gutmacht. Die Figur hat zwölf
Mark gekoſtet. Wir werden gemeinsam eine neue gleichwertige beſorgen.
Holt eure Sparbüchſen, damit ich feſtſtellen kann, wieviel Geld ihr
habt!“ ~ Es ſtellte ſich heraus, daß die ältere vier Mark und zwanzig
Pfennig und die jüngere zwei Mark und Tiebzig Pfennig hatte. Nun er-
hielten beide ſo lange kein Taſchengeld, bis die Figur erſett war. Darüber
vergingen viele Monate, und sie mußten sich in der Zeit manches aus
Taſchengeldmangel versagen. Aber Ball haben sie in den Zimmern nie
wieder gesſpielt. + Die hier angewandte Strafe bezeichnet man in der
Pädagogik als „natürliche Strafe" im Gegensatz zur „künſtlichen Strafe".
Die meisten Strafen sind künſtliche, das heißt sie ſind willkürlich gewählt,
ſie werden künſtlich herbeigeführt. Wenn die eben genannte Mutter über
die beiden Mädchen eine andere Strafe verhängt hätte, etwa ein paar
Nachmittage Stubenarreſt, ſo wäre das eine „künſtliche Strafe“ gewesen;
denn sie hätte in keinem inneren Zusammenhange mit dem Vergehen ge-
ſtanden. Die „natürliche Strafe“ dagegen iſt nichts anderes als die natur-
gemäße Folge einer Handlung. Wenn eine Familie zum Beiſpiel einen
Ausflug unternehmen will und ein Kind iſt nicht pünktlich fertig, ſo mar-
ſchieren die anderen > bei natürlichem Strafverfahren + eben ab und der
Bummler bleibt zu Hauſe. Gewöhnlich machen's die Menſchen freilich
anders: sie warten, ſchimpfen, verderben Jich die Laune und verpassen
unter Umständen den Zug, nehmen also die „natürliche Strafe" gleichſam
auf sich, ſtatt sie auf den kleinen Sünder zu beschränken. ~ Freilich kann
man die „natürlichen Strafen“ nur in besonderen Fällen anwenden.