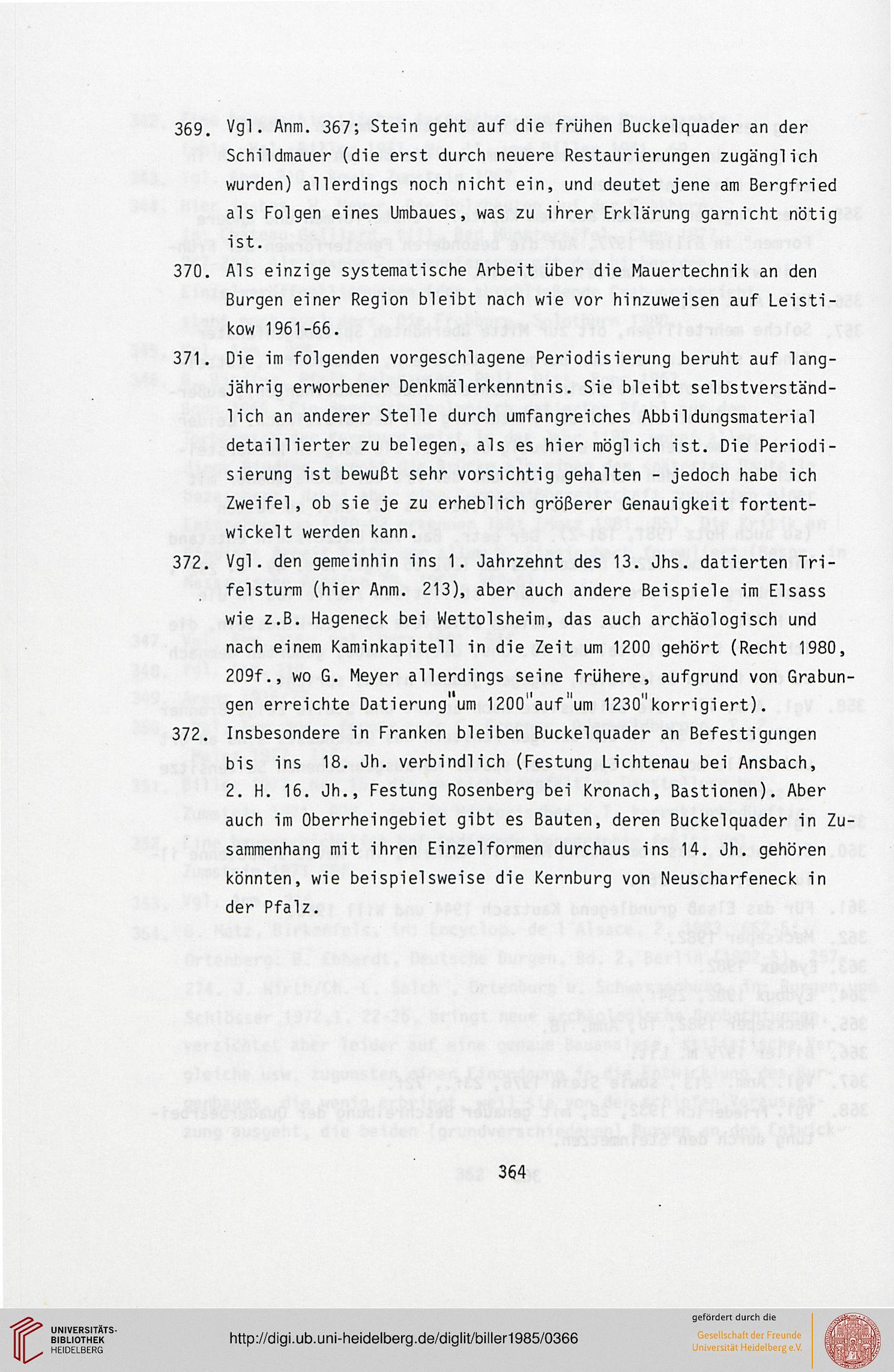369. Vgl. Anm. 367; Stein geht auf die frühen Buckelquader an der
Schildmauer (die erst durch neuere Restaurierungen zugänglich
wurden) allerdings noch nicht ein, und deutet jene am Bergfried
als Folgen eines Umbaues, was zu ihrer Erklärung garnicht nötig
ist.
370. Als einzige systematische Arbeit über die Mauertechnik an den
Burgen einer Region bleibt nach wie vor hinzuweisen auf Leisti-
kow 1961-66.
371. Die im folgenden vorgeschlagene Periodisierung beruht auf lang-
jährig erworbener Denkmälerkenntnis. Sie bleibt selbstverständ-
lich an anderer Stelle durch umfangreiches Abbildungsmaterial
detaillierter zu belegen, als es hier möglich ist. Die Periodi-
sierung ist bewußt sehr vorsichtig gehalten - jedoch habe ich
Zweifel, ob sie je zu erheblich größerer Genauigkeit fortent-
wickelt werden kann.
372. Vgl. den gemeinhin ins 1. Jahrzehnt des 13. Jhs. datierten Tri-
felsturm (hier Anm. 213), aber auch andere Beispiele im Elsass
wie z.B. Hageneck bei Wettolsheim, das auch archäologisch und
nach einem Kaminkapitell in die Zeit um 1200 gehört (Recht 1980,
209f., wo G. Meyer allerdings seine frühere, aufgrund von Grabun-
gen erreichte Datierung um 1200' auf um 1230"korrigiert).
372. Insbesondere in Franken bleiben Buckelquader an Befestigungen
bis ins 18. Jh. verbindlich (Festung Lichtenau bei Ansbach,
2. H. 16. Jh., Festung Rosenberg bei Kronach, Bastionen). Aber
auch im Oberrheingebiet gibt es Bauten, deren Buckelquader in Zu-
sammenhang mit ihren Einzel formen durchaus ins 14. Jh. gehören
könnten, wie beispielsweise die Kernburg von Neuscharfeneck in
der Pfalz.
364
Schildmauer (die erst durch neuere Restaurierungen zugänglich
wurden) allerdings noch nicht ein, und deutet jene am Bergfried
als Folgen eines Umbaues, was zu ihrer Erklärung garnicht nötig
ist.
370. Als einzige systematische Arbeit über die Mauertechnik an den
Burgen einer Region bleibt nach wie vor hinzuweisen auf Leisti-
kow 1961-66.
371. Die im folgenden vorgeschlagene Periodisierung beruht auf lang-
jährig erworbener Denkmälerkenntnis. Sie bleibt selbstverständ-
lich an anderer Stelle durch umfangreiches Abbildungsmaterial
detaillierter zu belegen, als es hier möglich ist. Die Periodi-
sierung ist bewußt sehr vorsichtig gehalten - jedoch habe ich
Zweifel, ob sie je zu erheblich größerer Genauigkeit fortent-
wickelt werden kann.
372. Vgl. den gemeinhin ins 1. Jahrzehnt des 13. Jhs. datierten Tri-
felsturm (hier Anm. 213), aber auch andere Beispiele im Elsass
wie z.B. Hageneck bei Wettolsheim, das auch archäologisch und
nach einem Kaminkapitell in die Zeit um 1200 gehört (Recht 1980,
209f., wo G. Meyer allerdings seine frühere, aufgrund von Grabun-
gen erreichte Datierung um 1200' auf um 1230"korrigiert).
372. Insbesondere in Franken bleiben Buckelquader an Befestigungen
bis ins 18. Jh. verbindlich (Festung Lichtenau bei Ansbach,
2. H. 16. Jh., Festung Rosenberg bei Kronach, Bastionen). Aber
auch im Oberrheingebiet gibt es Bauten, deren Buckelquader in Zu-
sammenhang mit ihren Einzel formen durchaus ins 14. Jh. gehören
könnten, wie beispielsweise die Kernburg von Neuscharfeneck in
der Pfalz.
364