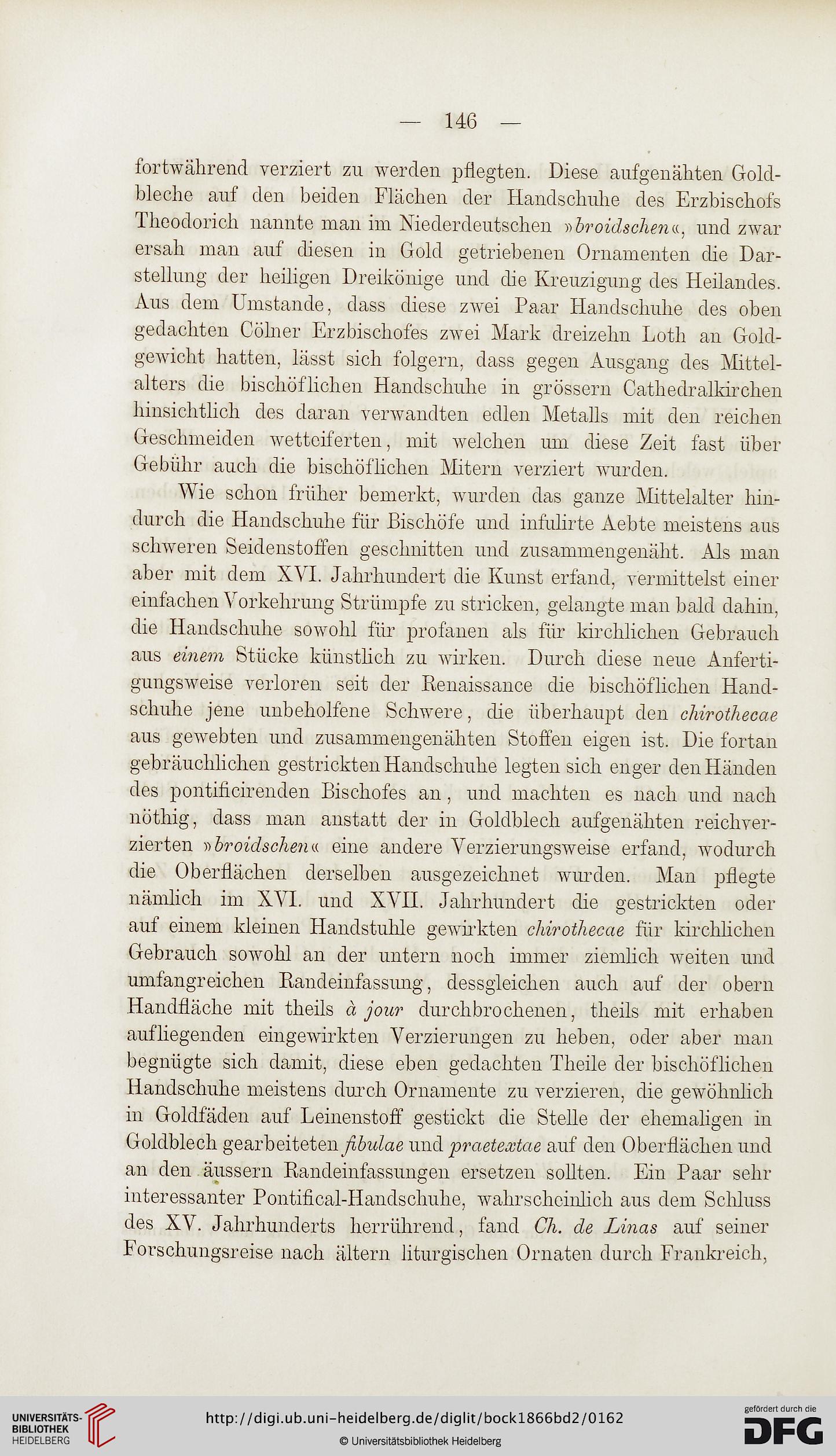146
fortwährend verziert zu werden pflegten. Diese aufgenähten Gold-
bleche auf den beiden Flächen der Handschuhe des Erzbischofs
Thcodorich nannte man im Niederdeutschen )H?'oAAcAg?a(, und zwar
ersah man auf diesen in Gold getriebenen Ornamenten die Dar-
stellung der heiligen Dreikönige und die Kreuzigung des Heilandes.
Aus dem Umstande, dass diese zwei Paar Handschuhe des oben
gedachten Gölner Erzbischofes zwei Mark dreizehn Loth an Gold-
gewicht hatten, lässt sich folgern, dass gegen Ausgang des Mittel-
alters die bischöflichen Handschuhe in grossem Oathedralkirchen
hinsichtlich des daran verwandten edlen Metalls mit den reichen
Geschmeiden wetteiferten, mit welchen um diese Zeit fast über
Gebühr auch die bischöflichen Mitern verziert wurden.
Wie schon früher bemerkt, wurden das ganze Mittelalter hin-
durch die Handschuhe für Bischöfe und infulirte Aebte meistens aus
schweren Seidenstoffen geschnitten und zusammengenäht. Als man
aber mit dem XVE Jahrhundert die Kunst erfand, vermittelst einer
einfachen Vorkehrung Strümpfe zu stricken, gelangte man bald dahin,
die Handschuhe sowohl für profanen als für kirchlichen Gebrauch
aus gfag?u Stücke künstlich zu wirken. Durch diese neue Anferti-
gungsweise verloren seit der Renaissance die bischöflichen Hand-
schuhe jene unbeholfene Schwere, die überhaupt den cAb"(üAgcag
aus gewebten und zusammengenähten Stoffen eigen ist. Die fortan
gebräuchlichen gestrickten Handschuhe legten sich enger den Händen
des pontificirenden Bischofes an, und machten es nach und nach
nöthig, dass man anstatt der in Goldblech aufgenähten reichver-
zierten H&rm&cAmK eine andere Verzierungsweise erfand, wodurch
die Oberflächen derselben ausgezeichnet wurden. Man pflegte
nämlich im XVE und XVIE Jahrhundert die gestrickten oder
auf einem kleinen Handstuhle gewirkten cAM-otAgcag für kirchlichen
Gebrauch sowohl an der untern noch immer ziemlich weiten und
umfangreichen Randeinfassung', dessgleichen auch auf der obern
Handfläche mit theils a^'oar durchbrochenen, theils mit erhaben
aufliegenden eingewirkten Verzierungen zu heben, oder aber man
begnügte sich damit, diese eben gedachten Theile der bischöflichen
Handschuhe meistens durch Ornamente zu verzieren, die gewöhnlich
in Goldfäden auf Leinenstoff gestickt die Stelle der ehemaligen in
Goldblech gearbeiteten /t^dag und pragtg^^ag auf den Oberflächen und
an den äussern Randeinfassungen ersetzen sollten. Ein Paar sehr
interessanter Pontifical-Handschuhe, wahrscheinlich aus dem Schluss
des XV. Jahrhunderts herrührend, fand CA. dg Amas auf seiner
Forschungsreise nach ältern liturgischen Ornaten durch Frankreich,
fortwährend verziert zu werden pflegten. Diese aufgenähten Gold-
bleche auf den beiden Flächen der Handschuhe des Erzbischofs
Thcodorich nannte man im Niederdeutschen )H?'oAAcAg?a(, und zwar
ersah man auf diesen in Gold getriebenen Ornamenten die Dar-
stellung der heiligen Dreikönige und die Kreuzigung des Heilandes.
Aus dem Umstande, dass diese zwei Paar Handschuhe des oben
gedachten Gölner Erzbischofes zwei Mark dreizehn Loth an Gold-
gewicht hatten, lässt sich folgern, dass gegen Ausgang des Mittel-
alters die bischöflichen Handschuhe in grossem Oathedralkirchen
hinsichtlich des daran verwandten edlen Metalls mit den reichen
Geschmeiden wetteiferten, mit welchen um diese Zeit fast über
Gebühr auch die bischöflichen Mitern verziert wurden.
Wie schon früher bemerkt, wurden das ganze Mittelalter hin-
durch die Handschuhe für Bischöfe und infulirte Aebte meistens aus
schweren Seidenstoffen geschnitten und zusammengenäht. Als man
aber mit dem XVE Jahrhundert die Kunst erfand, vermittelst einer
einfachen Vorkehrung Strümpfe zu stricken, gelangte man bald dahin,
die Handschuhe sowohl für profanen als für kirchlichen Gebrauch
aus gfag?u Stücke künstlich zu wirken. Durch diese neue Anferti-
gungsweise verloren seit der Renaissance die bischöflichen Hand-
schuhe jene unbeholfene Schwere, die überhaupt den cAb"(üAgcag
aus gewebten und zusammengenähten Stoffen eigen ist. Die fortan
gebräuchlichen gestrickten Handschuhe legten sich enger den Händen
des pontificirenden Bischofes an, und machten es nach und nach
nöthig, dass man anstatt der in Goldblech aufgenähten reichver-
zierten H&rm&cAmK eine andere Verzierungsweise erfand, wodurch
die Oberflächen derselben ausgezeichnet wurden. Man pflegte
nämlich im XVE und XVIE Jahrhundert die gestrickten oder
auf einem kleinen Handstuhle gewirkten cAM-otAgcag für kirchlichen
Gebrauch sowohl an der untern noch immer ziemlich weiten und
umfangreichen Randeinfassung', dessgleichen auch auf der obern
Handfläche mit theils a^'oar durchbrochenen, theils mit erhaben
aufliegenden eingewirkten Verzierungen zu heben, oder aber man
begnügte sich damit, diese eben gedachten Theile der bischöflichen
Handschuhe meistens durch Ornamente zu verzieren, die gewöhnlich
in Goldfäden auf Leinenstoff gestickt die Stelle der ehemaligen in
Goldblech gearbeiteten /t^dag und pragtg^^ag auf den Oberflächen und
an den äussern Randeinfassungen ersetzen sollten. Ein Paar sehr
interessanter Pontifical-Handschuhe, wahrscheinlich aus dem Schluss
des XV. Jahrhunderts herrührend, fand CA. dg Amas auf seiner
Forschungsreise nach ältern liturgischen Ornaten durch Frankreich,