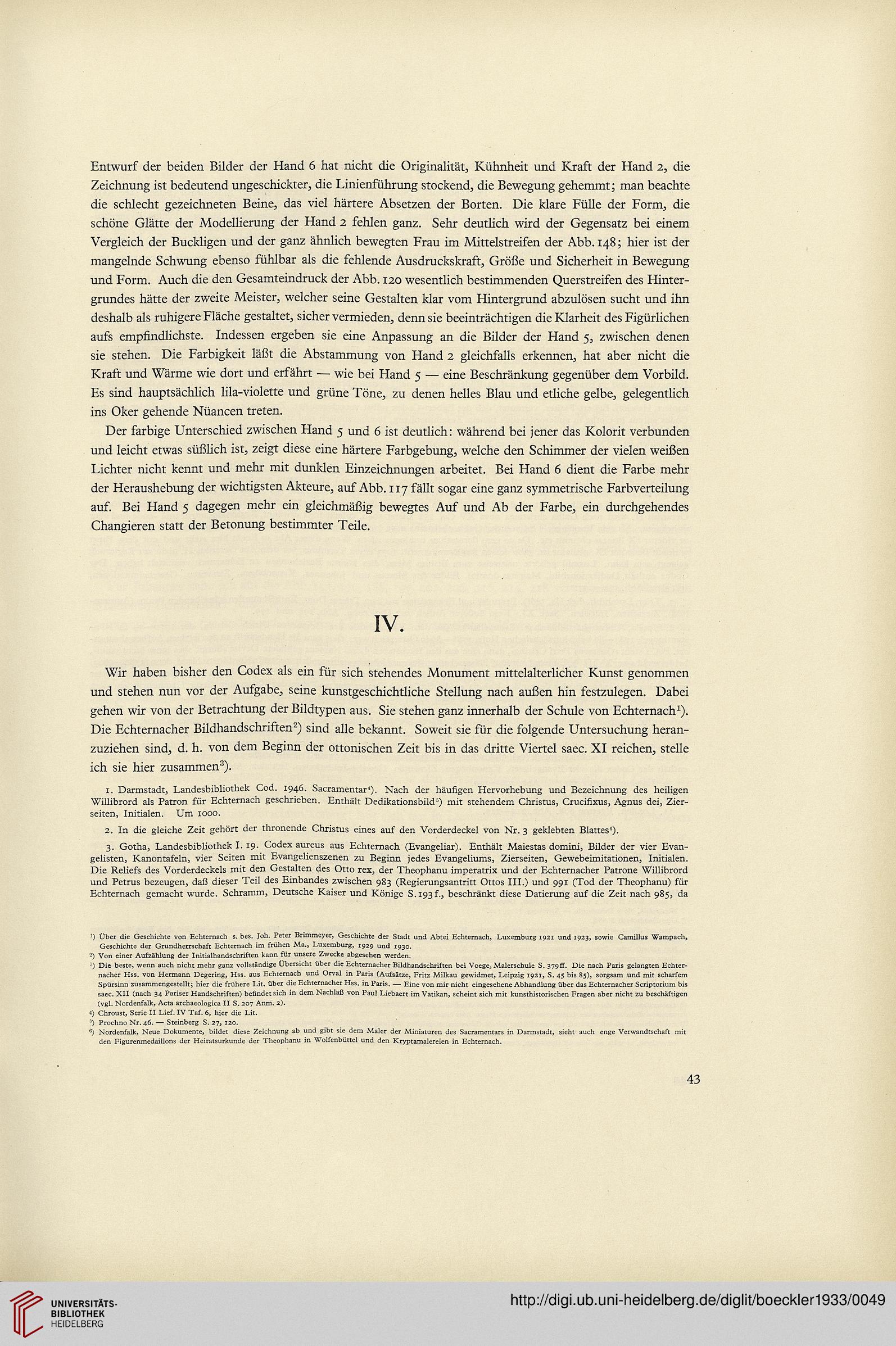Entwurf der beiden Bilder der Hand 6 hat nicht die Originalität, Kühnheit und Kraft der Hand 2, die
Zeichnung ist bedeutend ungeschickter, die Linienführung stockend, die Bewegung gehemmt; man beachte
die schlecht gezeichneten Beine, das viel härtere Absetzen der Borten. Die klare Fülle der Form, die
schöne Glätte der Modellierung der Hand 2 fehlen ganz. Sehr deutlich wird der Gegensatz bei einem
Vergleich der Buckligen und der ganz ähnlich bewegten Frau im Mittelstreifen der Abb. 148; hier ist der
mangelnde Schwung ebenso fühlbar als die fehlende Ausdruckskraft, Größe und Sicherheit in Bewegung
und Form. Auch die den Gesamteindruck der Abb. 120 wesentlich bestimmenden Querstreifen des Hinter-
grundes hätte der zweite Meister, welcher seine Gestalten klar vom Hintergrund abzulösen sucht und ihn
deshalb als ruhigere Fläche gestaltet, sicher vermieden, denn sie beeinträchtigen die Klarheit des Figürlichen
aufs empfindlichste. Indessen ergeben sie eine Anpassung an die Bilder der Hand 5, zwischen denen
sie stehen. Die Farbigkeit läßt die Abstammung von Hand 2 gleichfalls erkennen, hat aber nicht die
Kraft und Wärme wie dort und erfährt — wie bei Hand 5 — eine Beschränkung gegenüber dem Vorbild.
Es sind hauptsächlich lila-violette und grüne Töne, zu denen helles Blau und etliche gelbe, gelegentlich
ins Oker gehende Nüancen treten.
Der farbige Unterschied zwischen Hand 5 und 6 ist deutlich: während bei jener das Kolorit verbunden
und leicht etwas süßlich ist, zeigt diese eine härtere Farbgebung, welche den Schimmer der vielen weißen
Lichter nicht kennt und mehr mit dunklen Einzeichnungen arbeitet. Bei Hand 6 dient die Farbe mehr
der Heraushebung der wichtigsten Akteure, auf Abb. 117 fällt sogar eine ganz symmetrische Farbverteilung
auf. Bei Hand 5 dagegen mehr ein gleichmäßig bewegtes Auf und Ab der Farbe, ein durchgehendes
Changieren statt der Betonung bestimmter Teile.
IV.
Wir haben bisher den Codex als ein für sich stehendes Monument mittelalterlicher Kunst genommen
und stehen nun vor der Aufgabe, seine kunstgeschichtliche Stellung nach außen hin festzulegen. Dabei
gehen wir von der Betrachtung der Bildtypen aus. Sie stehen ganz innerhalb der Schule von Echternach 1).
Die Echternacher Bildhandschriften 2) sind alle bekannt. Soweit sie für die folgende Untersuchung heran-
zuziehen sind, d. h. von dem Beginn der ottonischen Zeit bis in das dritte Viertel saec. XI reichen, stelle
ich sie hier zusammen 3).
1. Darmstadt, Landesbibliothek Cod. 1946. Sacramentar 4). Nach der häufigen Hervorhebung und Bezeichnung des heiligen
Willibrord als Patron für Echternach geschrieben. Enthält Dedikationsbild •■) mit stehendem Christus, Crucifixus, Agnus dei, Zier-
seiten, Initialen. Um 1000.
2. In die gleiche Zeit gehört der thronende Christus eines auf den Vorderdeckel von Nr. 3 geklebten Blattes').
3. Gotha, Landesbibliothek I. 19. Codex aureus aus Echternach (Evangeliar). Enthält Maiestas domini, Bilder der vier Evan-
gelisten, Kanontafeln, vier Seiten mit Evangelienszenen zu Beginn jedes Evangeliums, Zierseiten, Gewebeimitationen, Initialen.
Die Reliefs des Vorderdeckels mit den Gestalten des Otto rex, der Theophanu imperatrix und der Echternacher Patrone Willibrord
und Petrus bezeugen, daß dieser Teil des Einbandes zwischen 983 (Regierungsantritt Ottos III.) und 991 (Tod der Theophanu) für
Echternach gemacht wurde. Schramm, Deutsche Kaiser und Könige S.i93f., beschränkt diese Datierung auf die Zeit nach 985, da
') Über die Geschichte von Echternach s. bes. Joh. Peter Brimmeyer, Geschichte der Stadt und Abtei Echternach, Luxemburg 1921 und 1923, sowie Camillus Wampach,
Geschichte der Grundherrschaft Echternach im frühen Ma., Luxemburg, 1929 und 1930.
2) Von einer Aufzählung der Initialhandschriften kann für unsere Zwecke abgesehen werden.
3) Die beste, wenn auch nicht mehr ganz vollständige Übersicht über die Echternacher Bildhandschriften bei Voege, Malerschule S. 379ff. Die nach Paris gelangten Echter-
nacher Hss. von Hermann Degering, Hss. aus Echternach und Orval in Paris (Aufsätze, Fritz Milkau gewidmet, Leipzig 1921, S. 45 bis 85), sorgsam und mit scharfem
Spürsinn zusammengestellt; hier die frühere Lit. über die Echternacher Hss. in Paris. — Eine von mir nicht eingesehene Abhandlung über das Echternacher Scriptorium bis
saec. XII (nach 34 Pariser Handschriften) befindet sich in dem Nachlaß von Paul Liebaert im Vatikan, scheint sich mit kunsthistorischen Fragen aber nicht zu beschäftigen
(vgl. Nordenfalk, Acta archaeologica II S. 207 Anm. 2).
4) Chroust, Serie II Lief. IV Taf. 6, hier die Lit.
5) Prochno Nr. 46- — Steinberg S. 27, 120.
6) Nordenfalk, Neue Dokumente, bildet diese Zeichnung ab und gibt sie dem Maler der Miniaturen des Sacramentars in Darmstadt, sieht auch enge Verwandtschaft mit
den Figurenmedaillons der Heiratsurkunde der Theophanu in Wolfenbüttel und den Kryptamalereien in Echternach.
43
Zeichnung ist bedeutend ungeschickter, die Linienführung stockend, die Bewegung gehemmt; man beachte
die schlecht gezeichneten Beine, das viel härtere Absetzen der Borten. Die klare Fülle der Form, die
schöne Glätte der Modellierung der Hand 2 fehlen ganz. Sehr deutlich wird der Gegensatz bei einem
Vergleich der Buckligen und der ganz ähnlich bewegten Frau im Mittelstreifen der Abb. 148; hier ist der
mangelnde Schwung ebenso fühlbar als die fehlende Ausdruckskraft, Größe und Sicherheit in Bewegung
und Form. Auch die den Gesamteindruck der Abb. 120 wesentlich bestimmenden Querstreifen des Hinter-
grundes hätte der zweite Meister, welcher seine Gestalten klar vom Hintergrund abzulösen sucht und ihn
deshalb als ruhigere Fläche gestaltet, sicher vermieden, denn sie beeinträchtigen die Klarheit des Figürlichen
aufs empfindlichste. Indessen ergeben sie eine Anpassung an die Bilder der Hand 5, zwischen denen
sie stehen. Die Farbigkeit läßt die Abstammung von Hand 2 gleichfalls erkennen, hat aber nicht die
Kraft und Wärme wie dort und erfährt — wie bei Hand 5 — eine Beschränkung gegenüber dem Vorbild.
Es sind hauptsächlich lila-violette und grüne Töne, zu denen helles Blau und etliche gelbe, gelegentlich
ins Oker gehende Nüancen treten.
Der farbige Unterschied zwischen Hand 5 und 6 ist deutlich: während bei jener das Kolorit verbunden
und leicht etwas süßlich ist, zeigt diese eine härtere Farbgebung, welche den Schimmer der vielen weißen
Lichter nicht kennt und mehr mit dunklen Einzeichnungen arbeitet. Bei Hand 6 dient die Farbe mehr
der Heraushebung der wichtigsten Akteure, auf Abb. 117 fällt sogar eine ganz symmetrische Farbverteilung
auf. Bei Hand 5 dagegen mehr ein gleichmäßig bewegtes Auf und Ab der Farbe, ein durchgehendes
Changieren statt der Betonung bestimmter Teile.
IV.
Wir haben bisher den Codex als ein für sich stehendes Monument mittelalterlicher Kunst genommen
und stehen nun vor der Aufgabe, seine kunstgeschichtliche Stellung nach außen hin festzulegen. Dabei
gehen wir von der Betrachtung der Bildtypen aus. Sie stehen ganz innerhalb der Schule von Echternach 1).
Die Echternacher Bildhandschriften 2) sind alle bekannt. Soweit sie für die folgende Untersuchung heran-
zuziehen sind, d. h. von dem Beginn der ottonischen Zeit bis in das dritte Viertel saec. XI reichen, stelle
ich sie hier zusammen 3).
1. Darmstadt, Landesbibliothek Cod. 1946. Sacramentar 4). Nach der häufigen Hervorhebung und Bezeichnung des heiligen
Willibrord als Patron für Echternach geschrieben. Enthält Dedikationsbild •■) mit stehendem Christus, Crucifixus, Agnus dei, Zier-
seiten, Initialen. Um 1000.
2. In die gleiche Zeit gehört der thronende Christus eines auf den Vorderdeckel von Nr. 3 geklebten Blattes').
3. Gotha, Landesbibliothek I. 19. Codex aureus aus Echternach (Evangeliar). Enthält Maiestas domini, Bilder der vier Evan-
gelisten, Kanontafeln, vier Seiten mit Evangelienszenen zu Beginn jedes Evangeliums, Zierseiten, Gewebeimitationen, Initialen.
Die Reliefs des Vorderdeckels mit den Gestalten des Otto rex, der Theophanu imperatrix und der Echternacher Patrone Willibrord
und Petrus bezeugen, daß dieser Teil des Einbandes zwischen 983 (Regierungsantritt Ottos III.) und 991 (Tod der Theophanu) für
Echternach gemacht wurde. Schramm, Deutsche Kaiser und Könige S.i93f., beschränkt diese Datierung auf die Zeit nach 985, da
') Über die Geschichte von Echternach s. bes. Joh. Peter Brimmeyer, Geschichte der Stadt und Abtei Echternach, Luxemburg 1921 und 1923, sowie Camillus Wampach,
Geschichte der Grundherrschaft Echternach im frühen Ma., Luxemburg, 1929 und 1930.
2) Von einer Aufzählung der Initialhandschriften kann für unsere Zwecke abgesehen werden.
3) Die beste, wenn auch nicht mehr ganz vollständige Übersicht über die Echternacher Bildhandschriften bei Voege, Malerschule S. 379ff. Die nach Paris gelangten Echter-
nacher Hss. von Hermann Degering, Hss. aus Echternach und Orval in Paris (Aufsätze, Fritz Milkau gewidmet, Leipzig 1921, S. 45 bis 85), sorgsam und mit scharfem
Spürsinn zusammengestellt; hier die frühere Lit. über die Echternacher Hss. in Paris. — Eine von mir nicht eingesehene Abhandlung über das Echternacher Scriptorium bis
saec. XII (nach 34 Pariser Handschriften) befindet sich in dem Nachlaß von Paul Liebaert im Vatikan, scheint sich mit kunsthistorischen Fragen aber nicht zu beschäftigen
(vgl. Nordenfalk, Acta archaeologica II S. 207 Anm. 2).
4) Chroust, Serie II Lief. IV Taf. 6, hier die Lit.
5) Prochno Nr. 46- — Steinberg S. 27, 120.
6) Nordenfalk, Neue Dokumente, bildet diese Zeichnung ab und gibt sie dem Maler der Miniaturen des Sacramentars in Darmstadt, sieht auch enge Verwandtschaft mit
den Figurenmedaillons der Heiratsurkunde der Theophanu in Wolfenbüttel und den Kryptamalereien in Echternach.
43