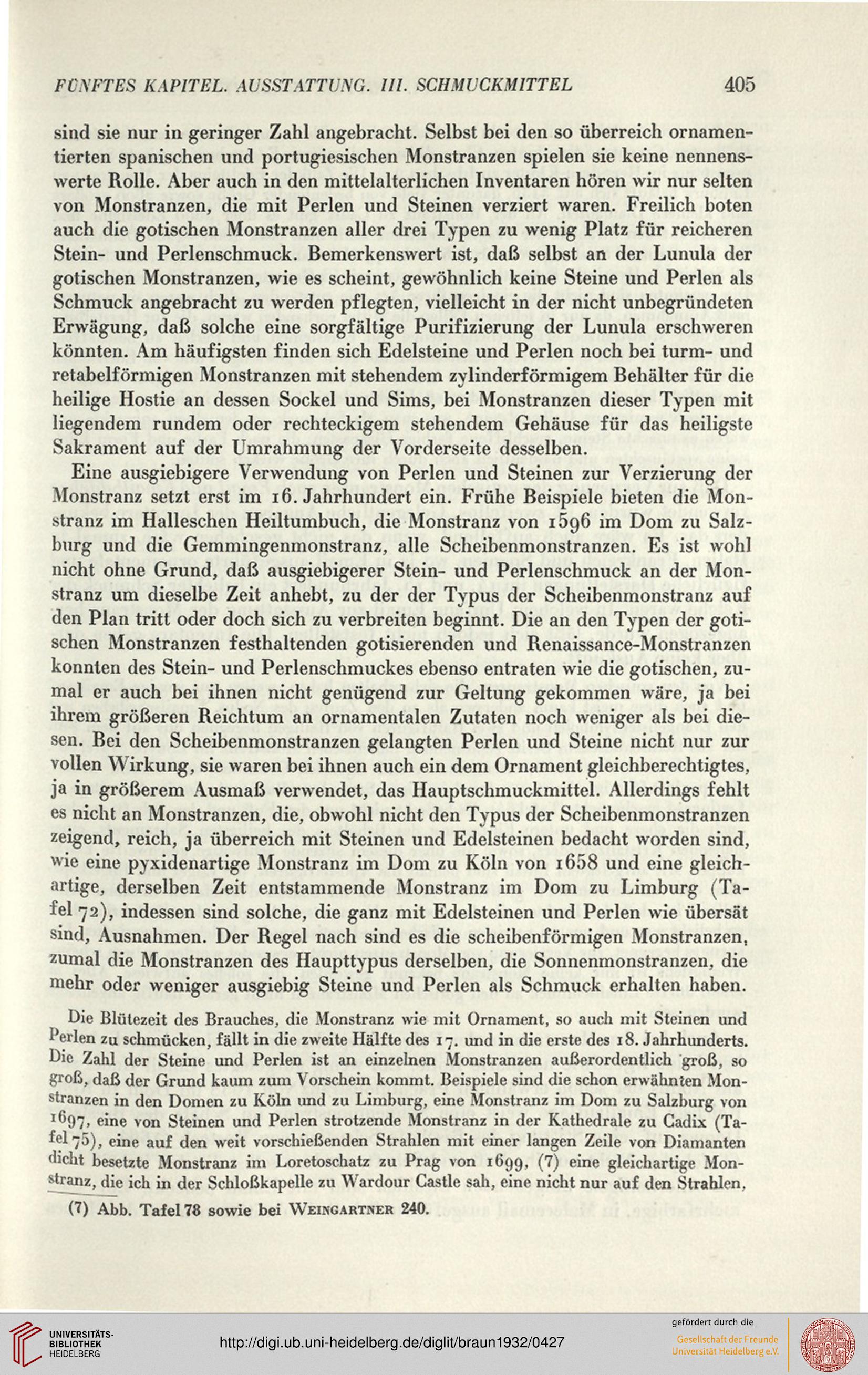FÜNFTES KAPITEL. AUSSTATTUNG. III. SCHMUCKMITTEL 405
sind sie nur in geringer Zahl angebracht. Selbst bei den so überreich ornamen-
tierten spanischen und portugiesischen Monstranzen spielen sie keine nennens-
werte Rolle. Aber auch in den mittelalterlichen Inventaren hören wir nur selten
von Monstranzen, die mit Perlen und Steinen verziert waren. Freilich boten
auch die gotischen Monstranzen aller drei Typen zu wenig Platz für reicheren
Stein- und Perlenschmuck. Bemerkenswert ist, daß selbst an der Lumila der
gotischen Monstranzen, wie es scheint, gewöhnlich keine Steine und Perlen als
Schmuck angebracht zu werden pflegten, vielleicht in der nicht unbegründeten
Erwägung, daß solche eine sorgfältige Purifizierung der Lunula erschweren
könnten. Am häufigsten finden sich Edelsteine und Perlen noch bei türm- und
retabelförmigen Monstranzen mit stehendem zylinderförmigem Behälter für die
heilige Hostie an dessen Sockel und Sims, bei Monstranzen dieser Typen mit
liegendem rundem oder rechteckigem stehendem Gehäuse für das heiligste
Sakrament auf der Umrahmung der Vorderseite desselben.
Eine ausgiebigere Verwendung von Perlen und Steinen zur Verzierung der
Monstranz setzt erst im 16. Jahrhundert ein. Frühe Beispiele bieten die Mon-
stranz im Halleschen Heiltumbuch, die Monstranz von 1596 im Dom zu Salz-
burg und die Gemmingenmonstranz, alle Scheibenmonstranzen. Es ist wohl
nicht ohne Grund, daß ausgiebigerer Stein- und Perlenschmuck an der Mon-
stranz um dieselbe Zeit anhebt, zu der der Typus der Scheibenmonstranz auf
den Plan tritt oder doch sich zu verbreiten beginnt. Die an den Typen der goti-
schen Monstranzen festhaltenden gotisierenden und Renaissance-Monstranzen
konnten des Stein- und Perlenschmuckes ebenso entraten wie die gotischen, zu-
mal er auch bei ihnen nicht genügend zur Geltung gekommen wäre, ja bei
ihrem größeren Reichtum an ornamentalen Zutaten noch weniger als bei die-
sen. Bei den Scheibenmonstranzen gelangten Perlen und Steine nicht nur zur
vollen Wirkung, sie waren bei ihnen auch ein dem Ornament gleichberechtigtes,
ja in größerem Ausmaß verwendet, das Hauptschmuckmittel. Allerdings fehlt
es nicht an Monstranzen, die, obwohl nicht den Typus der Scheibenmonstranzen
zeigend, reich, ja überreich mit Steinen und Edelsteinen bedacht worden sind,
wie eine pyxidenartige Monstranz im Dom zu Köln von i658 und eine gleich-
artige, derselben Zeit entstammende Monstranz im Dom zu Limburg (Ta-
fel 72), indessen sind solche, die ganz mit Edelsteinen und Perlen wie übersät
sind, Ausnahmen. Der Regel nach sind es die scheibenförmigen Monstranzen,
zumal die Monstranzen des Haupttypus derselben, die Sonnenmonstranzen, die
mehr oder weniger ausgiebig Steine und Perlen als Schmuck erhalten haben.
Die Blütezeit des Brauches, die Monstranz wie mit Ornament, so auch mit Steinen und
Perlen zu schmücken, fällt in die zweite Hälfte des 17. und in die erste des 18. Jahrhunderts.
Die Zahl der Steine und Perlen ist an einzelnen Monstranzen außerordentlich groß, so
groß, daß der Grund kaum zum Vorschein kommt. Beispiele sind die schon erwähnten Mon-
stranzen in den Domen zu Köln und zu Limburg, eine Monstranz im Dom zu Salzburg von
I097> eine von Steinen und Perlen strotzende Monstranz in der Kathedrale zu Cadix (Ta-
&I75), eine auf den weit vorschießenden Strahlen mit einer langen Zeile von Diamanten
<hcht besetzte Monstranz im Loretoschatz zu Prag von 1699, (7) eine gleichartige Mon-
stranz, die ich in der Schloßkapelle zu Wardour Castle sah, eine nicht nur auf den Strahlen,
(7) Abb. Tafel 78 sowie bei Weingartner 240.
sind sie nur in geringer Zahl angebracht. Selbst bei den so überreich ornamen-
tierten spanischen und portugiesischen Monstranzen spielen sie keine nennens-
werte Rolle. Aber auch in den mittelalterlichen Inventaren hören wir nur selten
von Monstranzen, die mit Perlen und Steinen verziert waren. Freilich boten
auch die gotischen Monstranzen aller drei Typen zu wenig Platz für reicheren
Stein- und Perlenschmuck. Bemerkenswert ist, daß selbst an der Lumila der
gotischen Monstranzen, wie es scheint, gewöhnlich keine Steine und Perlen als
Schmuck angebracht zu werden pflegten, vielleicht in der nicht unbegründeten
Erwägung, daß solche eine sorgfältige Purifizierung der Lunula erschweren
könnten. Am häufigsten finden sich Edelsteine und Perlen noch bei türm- und
retabelförmigen Monstranzen mit stehendem zylinderförmigem Behälter für die
heilige Hostie an dessen Sockel und Sims, bei Monstranzen dieser Typen mit
liegendem rundem oder rechteckigem stehendem Gehäuse für das heiligste
Sakrament auf der Umrahmung der Vorderseite desselben.
Eine ausgiebigere Verwendung von Perlen und Steinen zur Verzierung der
Monstranz setzt erst im 16. Jahrhundert ein. Frühe Beispiele bieten die Mon-
stranz im Halleschen Heiltumbuch, die Monstranz von 1596 im Dom zu Salz-
burg und die Gemmingenmonstranz, alle Scheibenmonstranzen. Es ist wohl
nicht ohne Grund, daß ausgiebigerer Stein- und Perlenschmuck an der Mon-
stranz um dieselbe Zeit anhebt, zu der der Typus der Scheibenmonstranz auf
den Plan tritt oder doch sich zu verbreiten beginnt. Die an den Typen der goti-
schen Monstranzen festhaltenden gotisierenden und Renaissance-Monstranzen
konnten des Stein- und Perlenschmuckes ebenso entraten wie die gotischen, zu-
mal er auch bei ihnen nicht genügend zur Geltung gekommen wäre, ja bei
ihrem größeren Reichtum an ornamentalen Zutaten noch weniger als bei die-
sen. Bei den Scheibenmonstranzen gelangten Perlen und Steine nicht nur zur
vollen Wirkung, sie waren bei ihnen auch ein dem Ornament gleichberechtigtes,
ja in größerem Ausmaß verwendet, das Hauptschmuckmittel. Allerdings fehlt
es nicht an Monstranzen, die, obwohl nicht den Typus der Scheibenmonstranzen
zeigend, reich, ja überreich mit Steinen und Edelsteinen bedacht worden sind,
wie eine pyxidenartige Monstranz im Dom zu Köln von i658 und eine gleich-
artige, derselben Zeit entstammende Monstranz im Dom zu Limburg (Ta-
fel 72), indessen sind solche, die ganz mit Edelsteinen und Perlen wie übersät
sind, Ausnahmen. Der Regel nach sind es die scheibenförmigen Monstranzen,
zumal die Monstranzen des Haupttypus derselben, die Sonnenmonstranzen, die
mehr oder weniger ausgiebig Steine und Perlen als Schmuck erhalten haben.
Die Blütezeit des Brauches, die Monstranz wie mit Ornament, so auch mit Steinen und
Perlen zu schmücken, fällt in die zweite Hälfte des 17. und in die erste des 18. Jahrhunderts.
Die Zahl der Steine und Perlen ist an einzelnen Monstranzen außerordentlich groß, so
groß, daß der Grund kaum zum Vorschein kommt. Beispiele sind die schon erwähnten Mon-
stranzen in den Domen zu Köln und zu Limburg, eine Monstranz im Dom zu Salzburg von
I097> eine von Steinen und Perlen strotzende Monstranz in der Kathedrale zu Cadix (Ta-
&I75), eine auf den weit vorschießenden Strahlen mit einer langen Zeile von Diamanten
<hcht besetzte Monstranz im Loretoschatz zu Prag von 1699, (7) eine gleichartige Mon-
stranz, die ich in der Schloßkapelle zu Wardour Castle sah, eine nicht nur auf den Strahlen,
(7) Abb. Tafel 78 sowie bei Weingartner 240.