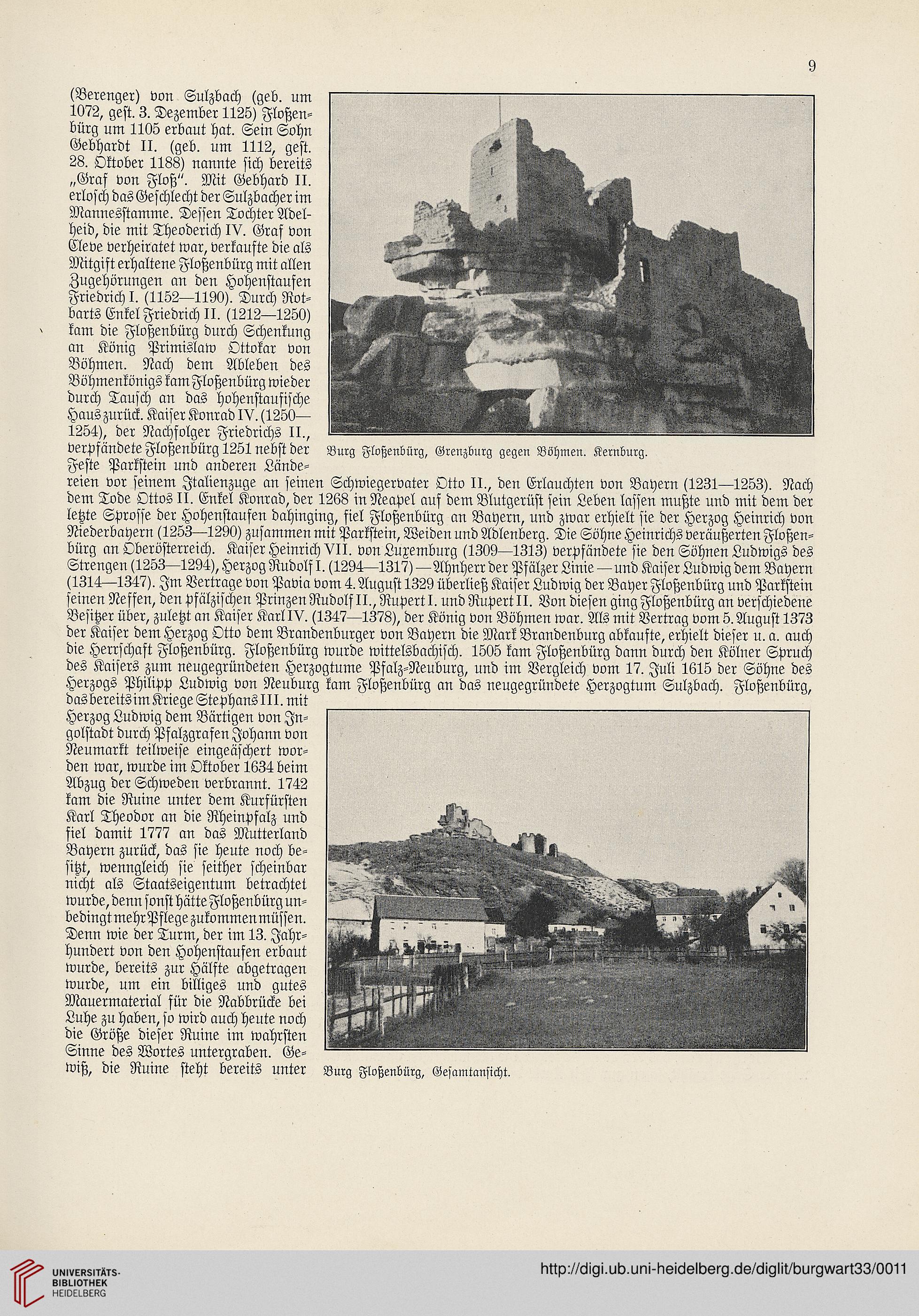9
(Verenger) von Sulzbach (geb. um
1072, gest. 3. Dezember 1125) Floßen-
bürg um 1105 erbaut hat. Sein Sohn
Gebhardt II. (geb. um 1112, gest.
28. Oktober 1188) nannte sich bereits
„Graf von Floß". Mit Gebhard II.
erlosch das Geschlecht der Sulzbacher im
Mannesstamme. Dessen Tochter Adel-
heid, die mit Theoderich IV. Graf von
Cleve verheiratet war, verkaufte die als
Mitgift erhaltene Floßenbürg mit allen
Zugehörungen an den Hohenstaufen
Friedrich I. (1152—1190). Durch Rot-
barts Enkel Friedrich II. (1212—1250)
kam die Floßenbürg durch Schenkung
an König Primislaw Ottokar von
Böhmen. Nach dem Ableben des
Böhmenkönigs kam Floßenbürg wieder
durch Tausch an das hohenstaufische
Haus zurück. Kaiser Konrad I V. (1250—
1254), der Nachfolger Friedrichs II.,
verpfändete Floßenbürg 1251 nebst der Burg Floßenbürg, Grenzburg gegen Böhmen. Kernbnrg.
Feste Parkstein und anderen Lände-
reien vor seinem Jtalienzuge an seinen Schwiegervater Otto II., den Erlauchten von Bayern (1231—1253). Nach
dem Tode Ottos II. Enkel Konrad, der 1268 in Neapel auf dem Blutgerüst sein Leben lassen mußte und mit dem der
letzte Sprosse der Hohenstaufen dahinging, fiel Floßenbürg an Bayern, und zwar erhielt sie der Herzog Heinrich von
Niederbayern (1253—1290) zusammen mit Parkstein, Weiden und Adlenberg. Die Söhne Heinrichs veräußerten Floßen-
bürg an Oberösterreich. Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (1309—1313) verpfändete sie den Söhnen Ludwigs des
Strengen (1253—1294), Herzog Rudolf I. (1294—1317) —Ahnherr der Pfälzer Linie—und Kaiser Ludwig dem Bayern
(1314—1347). Im Vertrage von Pavia vom 4. August 1329 überließ Kaiser Ludwig der Bayer Floßenbürg und Parkstein
seinen Neffen, den pfälzischen Prinzen Rudolf II., Rupert I. und Rupert II. Von diesen ging Floßenbürg an verschiedene
Besitzer über, zuletzt an Kaiser Karl I V. (1347—1378), der König von Böhmen war. Als mit Vertrag vom 5. August 1373
der Kaiser dem Herzog Otto dem Brandenburger von Bayern die Mark Brandenburg abkaufte, erhielt dieser u. a. auch
die Herrschaft Floßenbürg. Floßenbürg wurde wittelsbachisch. 1505 kam Floßenbürg dann durch den Kölner Spruch
des Kaisers zum neugegründeten Herzogtums Pfalz-Neuburg, und im Vergleich vom 17. Juli 1615 der Söhne des
Herzogs Philipp Ludwig von Neuburg kam Floßenbürg an das neugegründete Herzogtum Sulzbach. Floßenbürg,
das bereitsim Kriege Stephans III. mit
Herzog Ludwig dem Bärtigen von In-
golstadt durch Pfalzgrafen Johann von
Neumarkt teilweise eingeäschert wor-
den war, wurde im Oktober 1634 beim
Abzug der Schweden verbrannt. 1742
kam die Ruine unter dem Kurfürsten
Karl Theodor an die Rheinpfalz und
fiel damit 1777 an das Mutterland
Bayern zurück, das sie heute noch be-
sitzt, wenngleich sie seither scheinbar
nicht als Staatseigentum betrachtet
wurde, denn sonst hätte Floßenbürg un-
bedingt mehr Pflege zukommen müssen.
Denn wie der Turm, der im 13. Jahr-
hundert von den Hohenstaufen erbaut
wurde, bereits zur Hälfte abgetragen
wurde, um ein billiges und gutes
Mauermaterial für die Nabbrücke bei
Luhe zu haben, so wird auch heute noch
die Größe dieser Ruine im wahrsten
Sinne des Wortes untergraben. Ge-
wiß, die Ruine steht bereits unter Burg Floßenbürg, Gesamtansicht.
(Verenger) von Sulzbach (geb. um
1072, gest. 3. Dezember 1125) Floßen-
bürg um 1105 erbaut hat. Sein Sohn
Gebhardt II. (geb. um 1112, gest.
28. Oktober 1188) nannte sich bereits
„Graf von Floß". Mit Gebhard II.
erlosch das Geschlecht der Sulzbacher im
Mannesstamme. Dessen Tochter Adel-
heid, die mit Theoderich IV. Graf von
Cleve verheiratet war, verkaufte die als
Mitgift erhaltene Floßenbürg mit allen
Zugehörungen an den Hohenstaufen
Friedrich I. (1152—1190). Durch Rot-
barts Enkel Friedrich II. (1212—1250)
kam die Floßenbürg durch Schenkung
an König Primislaw Ottokar von
Böhmen. Nach dem Ableben des
Böhmenkönigs kam Floßenbürg wieder
durch Tausch an das hohenstaufische
Haus zurück. Kaiser Konrad I V. (1250—
1254), der Nachfolger Friedrichs II.,
verpfändete Floßenbürg 1251 nebst der Burg Floßenbürg, Grenzburg gegen Böhmen. Kernbnrg.
Feste Parkstein und anderen Lände-
reien vor seinem Jtalienzuge an seinen Schwiegervater Otto II., den Erlauchten von Bayern (1231—1253). Nach
dem Tode Ottos II. Enkel Konrad, der 1268 in Neapel auf dem Blutgerüst sein Leben lassen mußte und mit dem der
letzte Sprosse der Hohenstaufen dahinging, fiel Floßenbürg an Bayern, und zwar erhielt sie der Herzog Heinrich von
Niederbayern (1253—1290) zusammen mit Parkstein, Weiden und Adlenberg. Die Söhne Heinrichs veräußerten Floßen-
bürg an Oberösterreich. Kaiser Heinrich VII. von Luxemburg (1309—1313) verpfändete sie den Söhnen Ludwigs des
Strengen (1253—1294), Herzog Rudolf I. (1294—1317) —Ahnherr der Pfälzer Linie—und Kaiser Ludwig dem Bayern
(1314—1347). Im Vertrage von Pavia vom 4. August 1329 überließ Kaiser Ludwig der Bayer Floßenbürg und Parkstein
seinen Neffen, den pfälzischen Prinzen Rudolf II., Rupert I. und Rupert II. Von diesen ging Floßenbürg an verschiedene
Besitzer über, zuletzt an Kaiser Karl I V. (1347—1378), der König von Böhmen war. Als mit Vertrag vom 5. August 1373
der Kaiser dem Herzog Otto dem Brandenburger von Bayern die Mark Brandenburg abkaufte, erhielt dieser u. a. auch
die Herrschaft Floßenbürg. Floßenbürg wurde wittelsbachisch. 1505 kam Floßenbürg dann durch den Kölner Spruch
des Kaisers zum neugegründeten Herzogtums Pfalz-Neuburg, und im Vergleich vom 17. Juli 1615 der Söhne des
Herzogs Philipp Ludwig von Neuburg kam Floßenbürg an das neugegründete Herzogtum Sulzbach. Floßenbürg,
das bereitsim Kriege Stephans III. mit
Herzog Ludwig dem Bärtigen von In-
golstadt durch Pfalzgrafen Johann von
Neumarkt teilweise eingeäschert wor-
den war, wurde im Oktober 1634 beim
Abzug der Schweden verbrannt. 1742
kam die Ruine unter dem Kurfürsten
Karl Theodor an die Rheinpfalz und
fiel damit 1777 an das Mutterland
Bayern zurück, das sie heute noch be-
sitzt, wenngleich sie seither scheinbar
nicht als Staatseigentum betrachtet
wurde, denn sonst hätte Floßenbürg un-
bedingt mehr Pflege zukommen müssen.
Denn wie der Turm, der im 13. Jahr-
hundert von den Hohenstaufen erbaut
wurde, bereits zur Hälfte abgetragen
wurde, um ein billiges und gutes
Mauermaterial für die Nabbrücke bei
Luhe zu haben, so wird auch heute noch
die Größe dieser Ruine im wahrsten
Sinne des Wortes untergraben. Ge-
wiß, die Ruine steht bereits unter Burg Floßenbürg, Gesamtansicht.