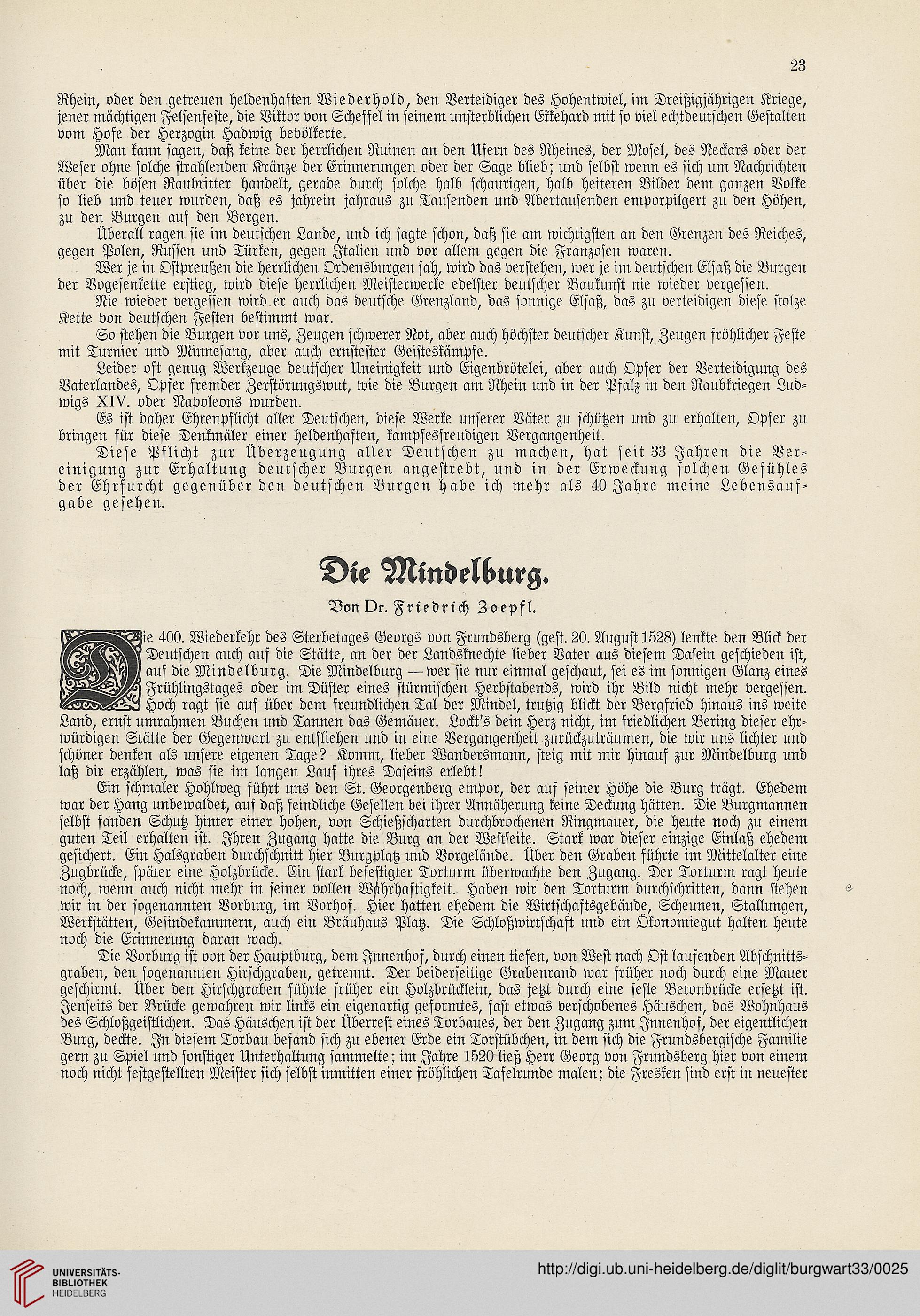23
Rhein, oder den getreuen heldenhaften Wiederhold, den Verteidiger des Hohentwiel, im Dreißigjährigen Kriege,
jener mächtigen Felsenfeste, die Viktor von Scheffel in seinem unsterblichen Ekkehard mit so viel echtdeutschen Gestalten
vom Hofe der Herzogin Hadwig bevölkerte.
Man kann sagen, daß keine der herrlichen Ruinen an den Ufern des Rheines, der Mosel, des Neckars oder der
Weser ohne solche strahlenden Kränze der Erinnerungen oder der Sage blieb; und selbst wenn es sich um Nachrichten
über die bösen Raubritter handelt, gerade durch solche halb schaurigen, halb heiteren Bilder dem ganzen Volke
so lieb und teuer wurden, daß es jahrein jahraus zu Tausenden und Abertansenden emporpilgert zu den Höhen,
zu den Burgen auf den Bergen.
Überall ragen sie im deutschen Lande, und ich sagte schon, daß sie am wichtigsten an den Grenzen des Reiches,
gegen Polen, Russen und Türken, gegen Italien und vor allem gegen die Franzosen waren.
Wer je in Ostpreußen die herrlichen Ordensburgen sah, wird das verstehen, wer je im deutschen Elsaß die Burgen
der Vogesenkette erstieg, wird diese herrlichen Meisterwerke edelster deutscher Baukunst nie wieder vergessen.
Nie wieder vergessen wird er auch das deutsche Grenzland, das sonnige Elsaß, das zu verteidigen diese stolze
Kette von deutschen Festen bestimmt war.
So stehen die Burgen vor uns, Zeugen schwerer Not, aber auch höchster deutscher Kunst, Zeugen fröhlicher Feste
mit Turnier und Minnesang, aber auch ernstester Geisteskämpfe.
Leider oft genug Werkzeuge deutscher Uneinigkeit und Eigenbrötelei, aber auch Opfer der Verteidigung des
Vaterlandes, Opfer fremder Zerstörungswut, wie die Burgen am Rhein und in der Pfalz in den Raubkriegen Lud-
wigs XIV. oder Napoleons wurden.
Es ist daher Ehrenpflicht aller Deutschen, diese Werke unserer Väter zu schützen und zu erhalten, Opfer zu
bringen für diese Denkmäler einer heldenhaften, kampfesfreudigen Vergangenheit.
Diese Pflicht zur Überzeugung aller Deutschen zu machen, hat seit 33 Jahren die Ver-
einigung zur Erhaltung deutscher Burgen angestrebt, und in der Erweckung solchen Gefühles
der Ehrfurcht gegenüber den deutschen Burgen habe ich mehr als 40 Jahre meine Lebensauf-
gabe gesehen.
Die Mindelburg.
Von Or. Friedrich Zoepfl.
ie 400. Wiederkehr des Sterbetages Georgs von Frundsberg (gest. 20. August 1528) lenkte den Blick der
Deutschen auch auf die Stätte, an der der Landsknechte lieber Vater aus diesem Dasein geschieden ist,
auf die Mindelburg. Die Mindelburg —wer sie nur einmal geschaut, sei es im sonnigen Glanz eines
Frühlingstages oder im Düster eines stürmischen Herbstabends, wird ihr Bild nicht mehr vergessen.
Hoch ragt sie auf über dem freundlichen Tal der Mindest trutzig blickt der Bergfried hinaus ins weite
Land, ernst umrahmen Buchen und Tannen das Gemäuer. Lockt's dein Herz nicht, im friedlichen Bering dieser ehr-
würdigen Stätte der Gegenwart zu entfliehen und in eine Vergangenheit zurückzuträumen, die wir uns lichter und
schöner denken als unsere eigenen Tage? Komm, lieber Wandersmann, steig mit mir hinauf zur Mindelburg und
laß dir erzählen, was sie im langen Lauf ihres Daseins erlebt!
Ein schmaler Hohlweg führt uns den St. Georgenberg empor, der auf seiner Höhe die Burg trügt. Ehedem
war der Hang unbewaldet, auf daß feindliche Gesellen bei ihrer Annäherung keine Deckung hätten. Die Burgmannen
selbst fanden Schutz hinter einer hohen, von Schießscharten durchbrochenen Ringmauer, die heute noch zu einem
guten Teil erhalten ist. Ihren Zugang hatte die Burg an der Westseite. Stark war dieser einzige Einlaß ehedem
gesichert. Ein Halsgraben durchschnitt hier Burgplatz und Vorgelände. Über den Graben führte im Mittelalter eine
Zugbrücke, später eine Holzbrücke. Ein stark befestigter Torturm überwachte den Zugang. Der Torturm ragt heute
noch, wenn auch nicht mehr in seiner vollen Wahrhaftigkeit. Haben wir den Torturm durchschritten, dann stehen
wir in der sogenannten Vorburg, im Vorhof. Hier hatten ehedem die Wirtschaftsgebäude, Scheunen, Stallungen,
Werkstätten, Gesindekammern, auch ein Bräuhaus Platz. Die Schloßwirtschaft und ein Okonomiegut halten heute
noch die Erinnerung daran wach.
Die Borburg ist von der Hauptburg, dem Jnnenhof, durch einen tiefen, von West nach Ost laufenden Abschnitts-
graben, den sogenannten Hirschgraben, getrennt. Der beiderseitige Grabenrand war früher noch durch eine Mauer
geschirmt. Über den Hirschgraben führte früher ein Holzbrücklein, das jetzt durch eine feste Betonbrücke ersetzt ist.
Jenseits der Brücke gewahren wir links ein eigenartig geformtes, fast etwas verschobenes Häuschen, das Wohnhaus
des Schloßgeistlichen. Das Häuschen ist der Überrest eines Torbaues, der den Zugang zum Jnnenhof, der eigentlichen
Burg, deckte. In diesem Torbau befand sich zu ebener Erde ein Torstübchen, in dem sich die Frundsbergische Familie
gern zu Spiel und sonstiger Unterhaltung sammelte; im Jahre 1520 ließ Herr Georg von Frundsberg hier von einem
noch nicht festgestellten Meister sich selbst inmitten einer fröhlichen Tafelrunde malen; die Fresken sind erst in neuester
Rhein, oder den getreuen heldenhaften Wiederhold, den Verteidiger des Hohentwiel, im Dreißigjährigen Kriege,
jener mächtigen Felsenfeste, die Viktor von Scheffel in seinem unsterblichen Ekkehard mit so viel echtdeutschen Gestalten
vom Hofe der Herzogin Hadwig bevölkerte.
Man kann sagen, daß keine der herrlichen Ruinen an den Ufern des Rheines, der Mosel, des Neckars oder der
Weser ohne solche strahlenden Kränze der Erinnerungen oder der Sage blieb; und selbst wenn es sich um Nachrichten
über die bösen Raubritter handelt, gerade durch solche halb schaurigen, halb heiteren Bilder dem ganzen Volke
so lieb und teuer wurden, daß es jahrein jahraus zu Tausenden und Abertansenden emporpilgert zu den Höhen,
zu den Burgen auf den Bergen.
Überall ragen sie im deutschen Lande, und ich sagte schon, daß sie am wichtigsten an den Grenzen des Reiches,
gegen Polen, Russen und Türken, gegen Italien und vor allem gegen die Franzosen waren.
Wer je in Ostpreußen die herrlichen Ordensburgen sah, wird das verstehen, wer je im deutschen Elsaß die Burgen
der Vogesenkette erstieg, wird diese herrlichen Meisterwerke edelster deutscher Baukunst nie wieder vergessen.
Nie wieder vergessen wird er auch das deutsche Grenzland, das sonnige Elsaß, das zu verteidigen diese stolze
Kette von deutschen Festen bestimmt war.
So stehen die Burgen vor uns, Zeugen schwerer Not, aber auch höchster deutscher Kunst, Zeugen fröhlicher Feste
mit Turnier und Minnesang, aber auch ernstester Geisteskämpfe.
Leider oft genug Werkzeuge deutscher Uneinigkeit und Eigenbrötelei, aber auch Opfer der Verteidigung des
Vaterlandes, Opfer fremder Zerstörungswut, wie die Burgen am Rhein und in der Pfalz in den Raubkriegen Lud-
wigs XIV. oder Napoleons wurden.
Es ist daher Ehrenpflicht aller Deutschen, diese Werke unserer Väter zu schützen und zu erhalten, Opfer zu
bringen für diese Denkmäler einer heldenhaften, kampfesfreudigen Vergangenheit.
Diese Pflicht zur Überzeugung aller Deutschen zu machen, hat seit 33 Jahren die Ver-
einigung zur Erhaltung deutscher Burgen angestrebt, und in der Erweckung solchen Gefühles
der Ehrfurcht gegenüber den deutschen Burgen habe ich mehr als 40 Jahre meine Lebensauf-
gabe gesehen.
Die Mindelburg.
Von Or. Friedrich Zoepfl.
ie 400. Wiederkehr des Sterbetages Georgs von Frundsberg (gest. 20. August 1528) lenkte den Blick der
Deutschen auch auf die Stätte, an der der Landsknechte lieber Vater aus diesem Dasein geschieden ist,
auf die Mindelburg. Die Mindelburg —wer sie nur einmal geschaut, sei es im sonnigen Glanz eines
Frühlingstages oder im Düster eines stürmischen Herbstabends, wird ihr Bild nicht mehr vergessen.
Hoch ragt sie auf über dem freundlichen Tal der Mindest trutzig blickt der Bergfried hinaus ins weite
Land, ernst umrahmen Buchen und Tannen das Gemäuer. Lockt's dein Herz nicht, im friedlichen Bering dieser ehr-
würdigen Stätte der Gegenwart zu entfliehen und in eine Vergangenheit zurückzuträumen, die wir uns lichter und
schöner denken als unsere eigenen Tage? Komm, lieber Wandersmann, steig mit mir hinauf zur Mindelburg und
laß dir erzählen, was sie im langen Lauf ihres Daseins erlebt!
Ein schmaler Hohlweg führt uns den St. Georgenberg empor, der auf seiner Höhe die Burg trügt. Ehedem
war der Hang unbewaldet, auf daß feindliche Gesellen bei ihrer Annäherung keine Deckung hätten. Die Burgmannen
selbst fanden Schutz hinter einer hohen, von Schießscharten durchbrochenen Ringmauer, die heute noch zu einem
guten Teil erhalten ist. Ihren Zugang hatte die Burg an der Westseite. Stark war dieser einzige Einlaß ehedem
gesichert. Ein Halsgraben durchschnitt hier Burgplatz und Vorgelände. Über den Graben führte im Mittelalter eine
Zugbrücke, später eine Holzbrücke. Ein stark befestigter Torturm überwachte den Zugang. Der Torturm ragt heute
noch, wenn auch nicht mehr in seiner vollen Wahrhaftigkeit. Haben wir den Torturm durchschritten, dann stehen
wir in der sogenannten Vorburg, im Vorhof. Hier hatten ehedem die Wirtschaftsgebäude, Scheunen, Stallungen,
Werkstätten, Gesindekammern, auch ein Bräuhaus Platz. Die Schloßwirtschaft und ein Okonomiegut halten heute
noch die Erinnerung daran wach.
Die Borburg ist von der Hauptburg, dem Jnnenhof, durch einen tiefen, von West nach Ost laufenden Abschnitts-
graben, den sogenannten Hirschgraben, getrennt. Der beiderseitige Grabenrand war früher noch durch eine Mauer
geschirmt. Über den Hirschgraben führte früher ein Holzbrücklein, das jetzt durch eine feste Betonbrücke ersetzt ist.
Jenseits der Brücke gewahren wir links ein eigenartig geformtes, fast etwas verschobenes Häuschen, das Wohnhaus
des Schloßgeistlichen. Das Häuschen ist der Überrest eines Torbaues, der den Zugang zum Jnnenhof, der eigentlichen
Burg, deckte. In diesem Torbau befand sich zu ebener Erde ein Torstübchen, in dem sich die Frundsbergische Familie
gern zu Spiel und sonstiger Unterhaltung sammelte; im Jahre 1520 ließ Herr Georg von Frundsberg hier von einem
noch nicht festgestellten Meister sich selbst inmitten einer fröhlichen Tafelrunde malen; die Fresken sind erst in neuester