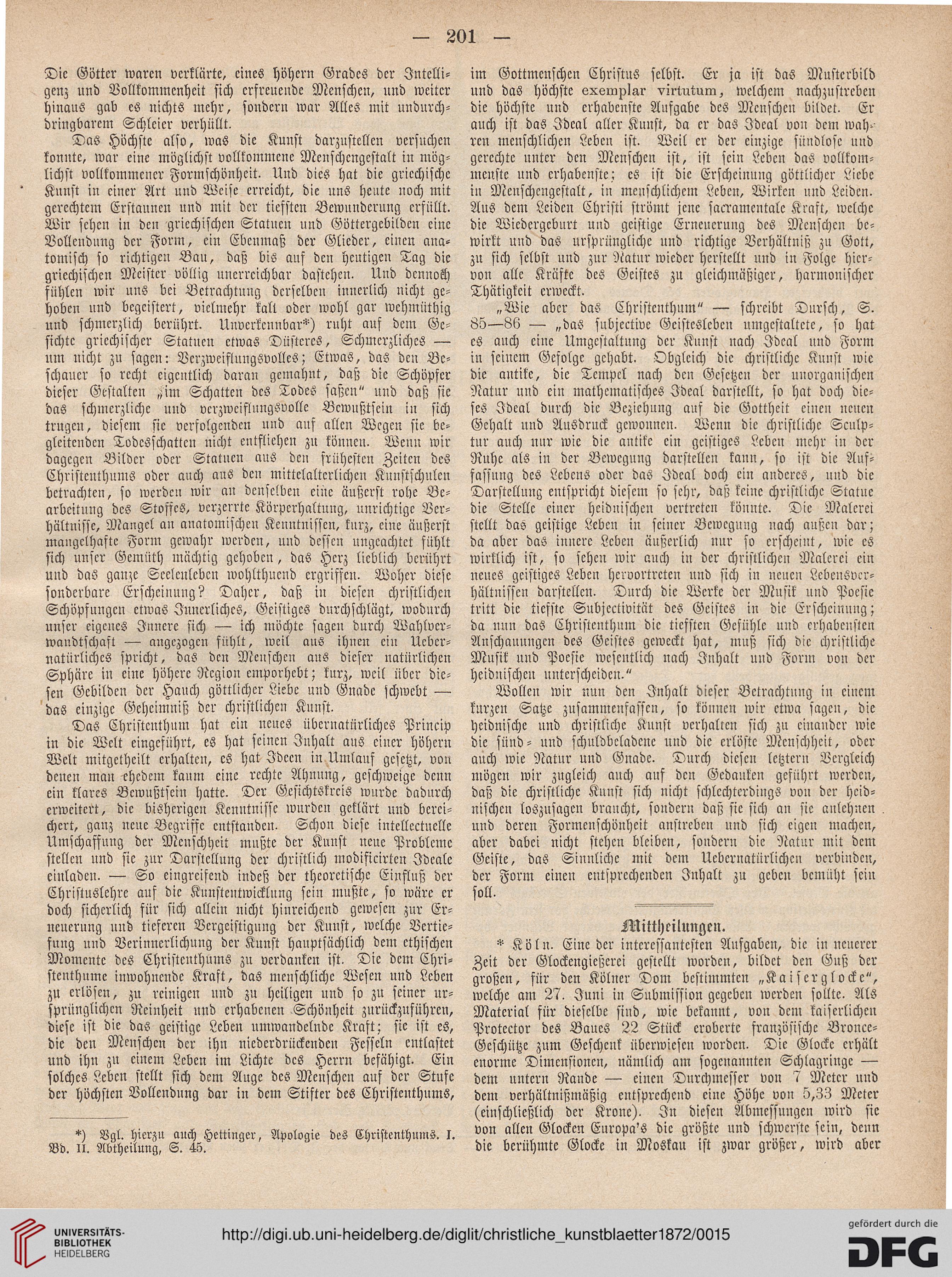— 201 —
im Gottmenſchen Chriſtus ſelbſt. Er ja iſt das Muſterbild
und das höchſte exemplar virtutum, welchem nachzuſtreben
die höchſte und erhabenſte Aufgabe des Menſchen bildet. Er
auch iſt das Jdeal aller Kunſt, da er das Jdeal von dem wah-
ren menſchlichen Leben iſt. Weil er der einzige ſündloſe und
gerechte unter den Menſchen iſt, iſt ſein Leben das vollkom-
menſte und erhabenſte; es iſt die Erſcheinung göttlicher Liebe
in Menſchengeſtalt, in menſchlichem Leben, Wirken und Leiden.
Aus dem Leiden Chriſti ſtrömt jene ſacramentale Kraft, welche
die Wiedergeburt und geiſtige Erneuerung des Menſchen be-
wirkt und das urſprüngliche und richtige Verhältniß zu Gott,
zu ſich ſelbſt und zur Natur wieder herſtellt und in Folge hier-
von alle Kräfte des Geiſtes zu gleichmäßiger, harmoniſcher
Thätigkeit erweckt.
,Wie aber das Chriſtenthum' — ſchreibt Durſch, S.
85-86 — ,, das ſubjective Geiſtesleben umgeſtaltete, ſo hat
es auch eine Umgeſtaltung der Kunſt nach Jdeal und Form
in ſeinem Gefolge gehabt. Obgleich die chriſtliche Kunſt wie
die antike, die Tempel nach den Geſetzen der unorganiſchen
Natur und ein mathematiſches Jdeal darſtellt, ſo hat doch die-
ſes Jdeal durch die Beziehung auf die Gottheit einen neuen
Gehalt und Ausdruck gewonnen. Wenn die chriſtliche Sculp-
tur auch nur wie die antike ein geiſtiges Leben mehr in der
Ruhe als in der Bewegung darſtellen kann, ſo iſt die Auf-
faſſung des Lebens oder das Jdeal doch ein anderes, und die
Darſtellung entſpricht dieſem ſo ſehr, daß keine chriſtliche Statue
die Stelle einer heidniſchen vertreten könnte. Die Malerei
ſtellt das geiſtige Leben in ſeiner Bewegung nach außen dar;
da aber das innere Leben äußerlich nur ſo erſcheint, wie es
wirklich iſt, ſo ſehen wir auch in der chriſtlichen Malerei ein
neues geiſtiges Leben hervortreten und ſich in neuen Lebensver-
hältniſſen darſtellen. Durch die Werke der Muſik und Poeſie
tritt die tiefſte Subjectivität des Geiſtes in die Erſcheinung;
da nun das Chriſtenthum die tiefſten Gefühle und erhabenſten
Anſchauungen des Geiſtes geweckt hat, muß ſich die chriſtliche
Muſik und Poeſie weſentlich nach Jnhalt und Form von der
heidniſchen unterſcheiden.''
Wollen wir nun den Jnhalt dieſer Betrachtung in einem
kurzen Satze zuſammenfaſſen, ſo können wir etwa ſagen, die
heidniſche und chriſtliche Kunſt verhalten ſich zu einander wie
die ſünd- und ſchuldbeladene und die erlöſte Menſchheit, oder
auch wie Natur und Gnade. Durch dieſen letztern Vergleich
mögen wir zugleich auch auf den Gedauken geführt werden,
daß die chriſtliche Kunſt ſich nicht ſchlechterdings von der heid-
niſchen loszuſagen braucht, ſondern daß ſie ſich an ſie anlehnen
und deren Formenſchönheit anſtreben und ſich eigen machen,
aber dabei nicht ſtehen bleiben, ſondern die Natur mit dem
Geiſte, das Sinnliche mit dem Uebernatürlichen verbinden,
der Form einen entſprechenden Jnhalt zu geben bemüht ſein
ſoll.
Die Götter waren verklärte, eines höhern Grades der Jntelli-
genz und Vollkommenheit ſich erfreuende Menſchen, und weiter
hinaus gab es nichts mehr, ſondern war Alles mit undurch-
dringbarem Schleier verhüllt.
Das Höchſte alſo, was die Kunſt darzuſtellen verſuchen
konnte, war eine möglichſt vollkommene Menſchengeſtalt in mög-
lichſt vollkommener Formſchönheit. Und dies hat die griechiſche
Kunſt in einer Art und Weiſe erreicht, die uns heute noch mit
gerechtem Erſtaunen und mit der tiefſten Bewunderung erfüllt.
Wir ſehen in den griechiſchen Statuen und Göttergebilden eine
Vollendung der Form, ein Ebenmaß der Glieder, einen ana-
tomiſch ſo richtigen Bau, daß bis auf den heutigen Tag die
griechiſchen Meiſter völlig unerreichbar daſtehen. Und dennoch
fühlen wir uns bei Betrachtung derſelben innerlich nicht ge-
hoben und begeiſtert, vielmehr kalt oder wohl gar wehmüthig
und ſchmerzlich berührt. Unverkennbar') ruht auf dem Ge-
ſichte griechiſcher Statuen etwas Düſteres, Schmerzliches —
um nicht zu ſagen: Verzweiflungsvolles; Etwas, das den Be-
ſchauer ſo recht eigentlich daran gemahnt, daß die Schöpfer
dieſer Geſtalten im Schatten des Todes ſaßen'' und daß ſie
das ſchmerzliche und verzweiflungsvolle Bewußtſein in ſich
trugen, dieſem ſie verfolgenden und auf allen Wegen ſie be-
gleitenden Todesſchatten nicht entfliehen zu können. Wenn wir
dagegen Bilder oder Statuen aus den früheſten Zeiten des
Chriſtenthums oder auch aus den mittelalterlichen Kunſtſchulen
betrachten, ſo werden wir an denſelben eine äußerſt rohe Be-
arbeitung des Stoffes, verzerrte Körperhaltung, unrichtige Ver-
hältniſſe, Mangel an anatomiſchen Kenntniſſen, kurz, eine äußerſt
mangelhafte Form gewahr werden, und deſſen ungeachtet fühlt
ſich unſer Gemüth mächtig gehoben, das Herz lieblich berührt
und das ganze Seelenleben wohlthuend ergriffen. Woher dieſe
ſonderbare Erſcheinung? Daher, daß in dieſen chriſtlichen
Schöpfungen etwas Jnnerliches, Geiſtiges durchſchlägt, wodurch
unſer eigenes Jnnere ſich — ich möchte ſagen durch Wahlver-
wandtſchaft — angezogen fühlt, weil aus ihnen ein Ueber-
natürliches ſpricht, das den Meuſchen aus dieſer natürlichen
Sphäre in eine höhere Region emporhebt; kurz, weil über die-
ſen Gebilden der Hauch göttlicher Liebe und Gnade ſchwebt —
das einzige Geheimniß der chriſtlichen Kunſt.
Das Chriſtenthum hat ein neues übernatürliches Princip
in die Welt eingeführt, es hat ſeinen Jnhalt aus einer höhern
Welt mitgetheilt erhalten, es hat Jdeen in Umlauf geſetzt, von
denen man ehedem kaum eine rechte Ahnung, geſchweige denn
ein klares Bewußtſein hatte. Der Geſichtskreis wurde dadurch
erweitert, die bisherigen Kenntniſſe wurden geklärt und berei-
chert, ganz neue Begriffe entſtanden. Schon dieſe intellectuelle
Umſchaffung der Menſchheit mußte der Kunſt neue Probleme
ſtellen und ſie zur Darſtellung der chriſtlich modificirten Jdeale
einladen. — So eingreifend indeß der theoretiſche Einfluß der
Chriſtuslehre auf die Kunſtentwicklung ſein mußte, ſo wäre er
doch ſicherlich für ſich allein nicht hinreichend geweſen zur Er-
neuerung und tieferen Vergeiſtigung der Kunſt, welche Vertie-
fung und Verinnerlichung der Kunſt hauptſächlich dem ethiſchen
Momente des Chriſtenthums zu verdanken iſt. Die dem Chri-
ſtenthume inwohnende Kraft, das menſchliche Weſen und Leben
zu erlöſen, zu reinigen und zu heiligen und ſo zu ſeiner ur-
ſprünglichen Reinheit und erhabenen Schönheit zurückzuführen,
dieſe iſt die das geiſtige Leben umwandelnde Kraft; ſie iſt es,
die den Menſchen der ihn niederdrückenden Feſſeln entlaſtet
und ihn zu einem Leben im Lichte des Herrn befähigt. Ein
ſolches Leben ſtellt ſich dem Auge des Menſchen auf der Stufe
der höchſten Vollendung dar in dem Stifter des Chriſtenthums,
Mittheilungen
* Köln. Eine der intereſſanteſten Aufgaben, die in neuerer
Zeit der Glockengießerei geſtellt worden, bildet den Guß der
großen, für den Kölner Dom beſtimmten ,,Kaiſerglocke'',
welche am 27. Juni in Submiſſion gegeben werden ſollte. Als
Material für dieſelbe ſind, wie bekannt, von dem kaiſerlichen
Protector des Baues 22 Stück eroberte franzöſiſche Bronce-
Geſchütze zum Geſchenk überwieſen worden. Die Glocke erhält
enorme Dimenſionen, nämlich am ſogenannten Schlagringe —
dem untern Rande — einen Durchmeſſer von 7Meter und
dem verhältnißmäßig entſprechend eine Höhe von 5,33 Meter
(einſchließlich der Krone). Jn dieſen Abmeſſungen wird ſie
von allen Glocken Europa's die größte und ſchwerſte ſein, denn
die berühmte Glocke in Moskau iſt zwar größer, wird aber
*) Vgl. hierzu auch Hettinger, Apologie des Chriſtenthums. J.
Bd. IJ. Abtheilung, S. 45.
im Gottmenſchen Chriſtus ſelbſt. Er ja iſt das Muſterbild
und das höchſte exemplar virtutum, welchem nachzuſtreben
die höchſte und erhabenſte Aufgabe des Menſchen bildet. Er
auch iſt das Jdeal aller Kunſt, da er das Jdeal von dem wah-
ren menſchlichen Leben iſt. Weil er der einzige ſündloſe und
gerechte unter den Menſchen iſt, iſt ſein Leben das vollkom-
menſte und erhabenſte; es iſt die Erſcheinung göttlicher Liebe
in Menſchengeſtalt, in menſchlichem Leben, Wirken und Leiden.
Aus dem Leiden Chriſti ſtrömt jene ſacramentale Kraft, welche
die Wiedergeburt und geiſtige Erneuerung des Menſchen be-
wirkt und das urſprüngliche und richtige Verhältniß zu Gott,
zu ſich ſelbſt und zur Natur wieder herſtellt und in Folge hier-
von alle Kräfte des Geiſtes zu gleichmäßiger, harmoniſcher
Thätigkeit erweckt.
,Wie aber das Chriſtenthum' — ſchreibt Durſch, S.
85-86 — ,, das ſubjective Geiſtesleben umgeſtaltete, ſo hat
es auch eine Umgeſtaltung der Kunſt nach Jdeal und Form
in ſeinem Gefolge gehabt. Obgleich die chriſtliche Kunſt wie
die antike, die Tempel nach den Geſetzen der unorganiſchen
Natur und ein mathematiſches Jdeal darſtellt, ſo hat doch die-
ſes Jdeal durch die Beziehung auf die Gottheit einen neuen
Gehalt und Ausdruck gewonnen. Wenn die chriſtliche Sculp-
tur auch nur wie die antike ein geiſtiges Leben mehr in der
Ruhe als in der Bewegung darſtellen kann, ſo iſt die Auf-
faſſung des Lebens oder das Jdeal doch ein anderes, und die
Darſtellung entſpricht dieſem ſo ſehr, daß keine chriſtliche Statue
die Stelle einer heidniſchen vertreten könnte. Die Malerei
ſtellt das geiſtige Leben in ſeiner Bewegung nach außen dar;
da aber das innere Leben äußerlich nur ſo erſcheint, wie es
wirklich iſt, ſo ſehen wir auch in der chriſtlichen Malerei ein
neues geiſtiges Leben hervortreten und ſich in neuen Lebensver-
hältniſſen darſtellen. Durch die Werke der Muſik und Poeſie
tritt die tiefſte Subjectivität des Geiſtes in die Erſcheinung;
da nun das Chriſtenthum die tiefſten Gefühle und erhabenſten
Anſchauungen des Geiſtes geweckt hat, muß ſich die chriſtliche
Muſik und Poeſie weſentlich nach Jnhalt und Form von der
heidniſchen unterſcheiden.''
Wollen wir nun den Jnhalt dieſer Betrachtung in einem
kurzen Satze zuſammenfaſſen, ſo können wir etwa ſagen, die
heidniſche und chriſtliche Kunſt verhalten ſich zu einander wie
die ſünd- und ſchuldbeladene und die erlöſte Menſchheit, oder
auch wie Natur und Gnade. Durch dieſen letztern Vergleich
mögen wir zugleich auch auf den Gedauken geführt werden,
daß die chriſtliche Kunſt ſich nicht ſchlechterdings von der heid-
niſchen loszuſagen braucht, ſondern daß ſie ſich an ſie anlehnen
und deren Formenſchönheit anſtreben und ſich eigen machen,
aber dabei nicht ſtehen bleiben, ſondern die Natur mit dem
Geiſte, das Sinnliche mit dem Uebernatürlichen verbinden,
der Form einen entſprechenden Jnhalt zu geben bemüht ſein
ſoll.
Die Götter waren verklärte, eines höhern Grades der Jntelli-
genz und Vollkommenheit ſich erfreuende Menſchen, und weiter
hinaus gab es nichts mehr, ſondern war Alles mit undurch-
dringbarem Schleier verhüllt.
Das Höchſte alſo, was die Kunſt darzuſtellen verſuchen
konnte, war eine möglichſt vollkommene Menſchengeſtalt in mög-
lichſt vollkommener Formſchönheit. Und dies hat die griechiſche
Kunſt in einer Art und Weiſe erreicht, die uns heute noch mit
gerechtem Erſtaunen und mit der tiefſten Bewunderung erfüllt.
Wir ſehen in den griechiſchen Statuen und Göttergebilden eine
Vollendung der Form, ein Ebenmaß der Glieder, einen ana-
tomiſch ſo richtigen Bau, daß bis auf den heutigen Tag die
griechiſchen Meiſter völlig unerreichbar daſtehen. Und dennoch
fühlen wir uns bei Betrachtung derſelben innerlich nicht ge-
hoben und begeiſtert, vielmehr kalt oder wohl gar wehmüthig
und ſchmerzlich berührt. Unverkennbar') ruht auf dem Ge-
ſichte griechiſcher Statuen etwas Düſteres, Schmerzliches —
um nicht zu ſagen: Verzweiflungsvolles; Etwas, das den Be-
ſchauer ſo recht eigentlich daran gemahnt, daß die Schöpfer
dieſer Geſtalten im Schatten des Todes ſaßen'' und daß ſie
das ſchmerzliche und verzweiflungsvolle Bewußtſein in ſich
trugen, dieſem ſie verfolgenden und auf allen Wegen ſie be-
gleitenden Todesſchatten nicht entfliehen zu können. Wenn wir
dagegen Bilder oder Statuen aus den früheſten Zeiten des
Chriſtenthums oder auch aus den mittelalterlichen Kunſtſchulen
betrachten, ſo werden wir an denſelben eine äußerſt rohe Be-
arbeitung des Stoffes, verzerrte Körperhaltung, unrichtige Ver-
hältniſſe, Mangel an anatomiſchen Kenntniſſen, kurz, eine äußerſt
mangelhafte Form gewahr werden, und deſſen ungeachtet fühlt
ſich unſer Gemüth mächtig gehoben, das Herz lieblich berührt
und das ganze Seelenleben wohlthuend ergriffen. Woher dieſe
ſonderbare Erſcheinung? Daher, daß in dieſen chriſtlichen
Schöpfungen etwas Jnnerliches, Geiſtiges durchſchlägt, wodurch
unſer eigenes Jnnere ſich — ich möchte ſagen durch Wahlver-
wandtſchaft — angezogen fühlt, weil aus ihnen ein Ueber-
natürliches ſpricht, das den Meuſchen aus dieſer natürlichen
Sphäre in eine höhere Region emporhebt; kurz, weil über die-
ſen Gebilden der Hauch göttlicher Liebe und Gnade ſchwebt —
das einzige Geheimniß der chriſtlichen Kunſt.
Das Chriſtenthum hat ein neues übernatürliches Princip
in die Welt eingeführt, es hat ſeinen Jnhalt aus einer höhern
Welt mitgetheilt erhalten, es hat Jdeen in Umlauf geſetzt, von
denen man ehedem kaum eine rechte Ahnung, geſchweige denn
ein klares Bewußtſein hatte. Der Geſichtskreis wurde dadurch
erweitert, die bisherigen Kenntniſſe wurden geklärt und berei-
chert, ganz neue Begriffe entſtanden. Schon dieſe intellectuelle
Umſchaffung der Menſchheit mußte der Kunſt neue Probleme
ſtellen und ſie zur Darſtellung der chriſtlich modificirten Jdeale
einladen. — So eingreifend indeß der theoretiſche Einfluß der
Chriſtuslehre auf die Kunſtentwicklung ſein mußte, ſo wäre er
doch ſicherlich für ſich allein nicht hinreichend geweſen zur Er-
neuerung und tieferen Vergeiſtigung der Kunſt, welche Vertie-
fung und Verinnerlichung der Kunſt hauptſächlich dem ethiſchen
Momente des Chriſtenthums zu verdanken iſt. Die dem Chri-
ſtenthume inwohnende Kraft, das menſchliche Weſen und Leben
zu erlöſen, zu reinigen und zu heiligen und ſo zu ſeiner ur-
ſprünglichen Reinheit und erhabenen Schönheit zurückzuführen,
dieſe iſt die das geiſtige Leben umwandelnde Kraft; ſie iſt es,
die den Menſchen der ihn niederdrückenden Feſſeln entlaſtet
und ihn zu einem Leben im Lichte des Herrn befähigt. Ein
ſolches Leben ſtellt ſich dem Auge des Menſchen auf der Stufe
der höchſten Vollendung dar in dem Stifter des Chriſtenthums,
Mittheilungen
* Köln. Eine der intereſſanteſten Aufgaben, die in neuerer
Zeit der Glockengießerei geſtellt worden, bildet den Guß der
großen, für den Kölner Dom beſtimmten ,,Kaiſerglocke'',
welche am 27. Juni in Submiſſion gegeben werden ſollte. Als
Material für dieſelbe ſind, wie bekannt, von dem kaiſerlichen
Protector des Baues 22 Stück eroberte franzöſiſche Bronce-
Geſchütze zum Geſchenk überwieſen worden. Die Glocke erhält
enorme Dimenſionen, nämlich am ſogenannten Schlagringe —
dem untern Rande — einen Durchmeſſer von 7Meter und
dem verhältnißmäßig entſprechend eine Höhe von 5,33 Meter
(einſchließlich der Krone). Jn dieſen Abmeſſungen wird ſie
von allen Glocken Europa's die größte und ſchwerſte ſein, denn
die berühmte Glocke in Moskau iſt zwar größer, wird aber
*) Vgl. hierzu auch Hettinger, Apologie des Chriſtenthums. J.
Bd. IJ. Abtheilung, S. 45.