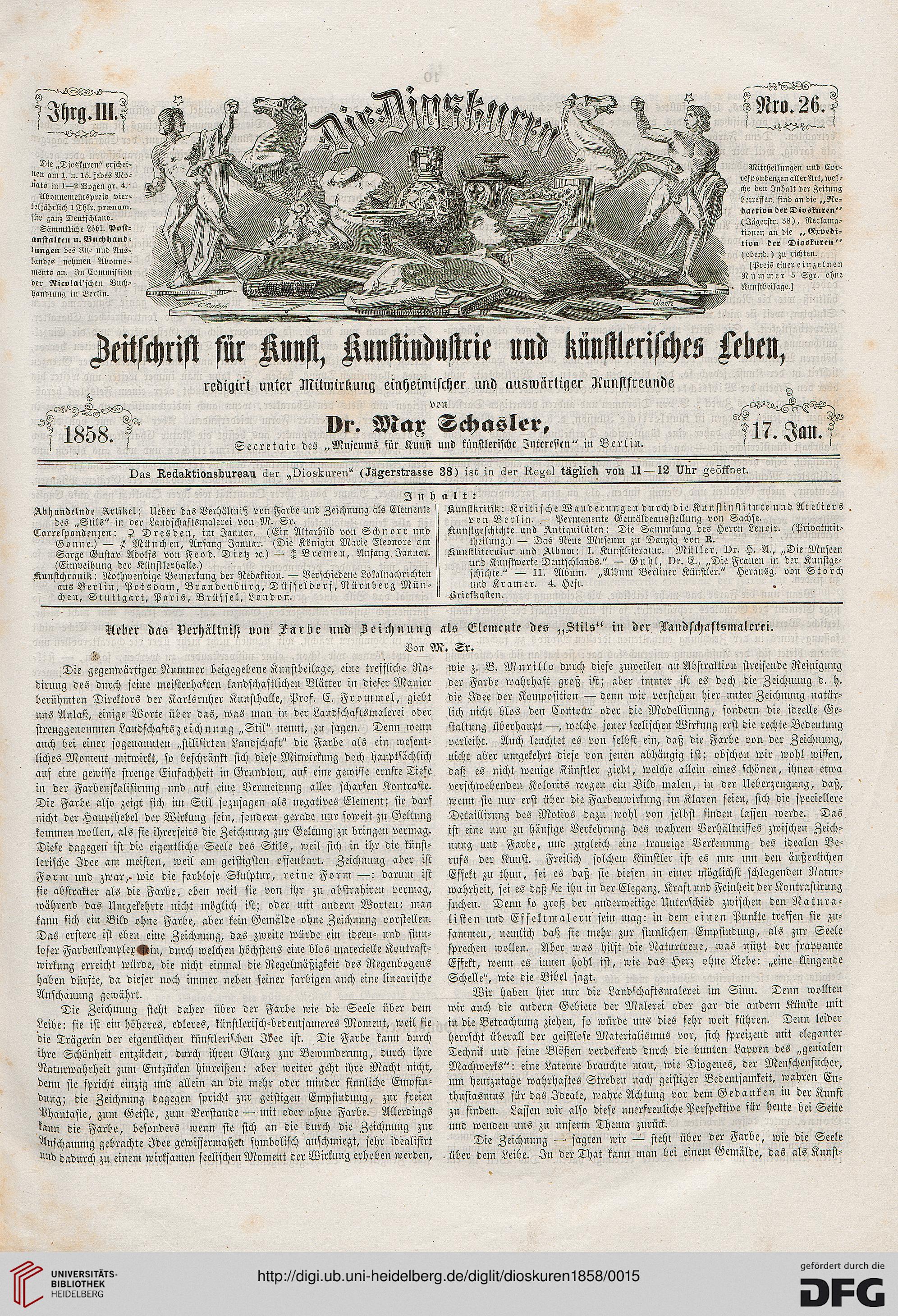Die „Dioskuren" erschei-
nen am 1. u. 15. jedes Mo-
nats in 1—2 Bogen gr. 4.'
Abonnementspreis vier-
teljährlich i Thlr. xrWnum.
für ganz Deutschland.
Sämmtliche Löbl. Poft-
anstalten u. Buchhand-
lungen des In- und Aus-
landes nehmen Abonne -
ments an. In Commission
der Nicolai'schen Buch-
handlung in Berlin.
t
(8
Nro. 26.1
Mittheilungen und Cor-
respondenzen aller Art, wel-
che den Inhalt der Zeitung
betreffen, sind an die „Ne-
dactiou der Dioskuren^^
( Jägerstr. 38), Reclama-
tionen an die „Expedi-
tion der Dioskuren"
(ebcnd.) zu richten.
sPrejs einer einzelnen
N u m m e r 5 Sgr. ohne
Knnstbeilage.j
Zkitschrist für Kunst, Kuustindustrik un- künstlerisches Leben,
] 1858.
reingiti unter DTtitroirfutng einheimischer und ausmiirtiger Kunstfreunde
von
Dr. Max SchasLer,
Secretair dcs „Museums für Kunst und künstlerische Interessen" in Berlin.
Vas Reckaktionsdnrean der „Dioskuren“ (Jägerstrasse 38) ist in der Regel täglich von 11 — 12 Uhr geöffnet.
3 it h
Abhandeinde Artikel: lieber das Verhältuiß von Farbe und Zeichnung als Elemente
des „Stils" in der Landschaftsmalerei von M. Sr.
Corrrlpondenxen: Z Dresden, im Januar. (Ein Altarbild von Schnorr und
Gönne.) — Münch en, Anfang Januar. (Die Königin Marie Eleonore am
Sarge Gustav Adolfs von Feod. Dietz re.) — * Bremen, Anfang.Januar.
(Einweihung der Künstlerhalle.)
Kunstchronik: Rothwendige Bemerkung der Redaktion. — Verschiedene Lokalnachrichtcn
aus Berlin, Potsdam, Brandenburg, Düsseldorf, Nürnberg Mün-
chen, Stuttgart, Paris, Brüssel, London.
Kunstkritik: Kritische Wanderungen durch die Knnstinstitnte und Ateliers .
von Berlin. — Permanente Gemäldeausstellung von L-achse.
Kunstgeschichte und Antiquitäten: Die Sammlung des Herrn Lenoir. (Privatmit-
theilnng.) — Das Neue Museum zu Danzig von R.
Kunstlitcralur und Albuin: I. Kunstliteratnr. Müller, Oe. H. A., „Die Museen
und Kunstwerke Deutschlands." — Guhl, Dr. E., „Die Frauen in der Kunstge-
schichte." — II. Album. „Album Berliner Künstler." Herausg. von Storch
und Kramer. 4. Heft.
Briefkasten.
Ueber das Verhältnis; van Farbe und Zeichnung als Elemente des „Stils" in der Fandschaftsmalcrei.
Von M« Tr.
Die gegenwärtiger Nummer beigegebene Kunstbeilage, eine treffliche Ra-
dirnng des durch seine meisterhaften landschaftlichen Blätter in dieser Manier
berühmten Direktors der Karlsruher Kunsthalle, Prof. C. Frommel, giebt
uns Anlaß, einige Worte über das, was man in der Landschaftsmalerei oder
strenggenommen Landschafts Zeichnung „Stil" nennt, zu sagen. Denn wenn
auch bei einer sogenannten „stilisirten Landschaft" die Farbe als ein wesent-
liches Moment mitwirkt, so beschränkt sich diese Mitwirkung doch hauptsächlich
auf eine gewisse strenge Einfachheit in Grnndton, ans eine gewisse ernste Tiefe
in der Farbenskalisirnng und auf eine Vermeidung aller scharfen Kontraste.
Die Farbe also zeigt sich im Stil sozusagen als negatives Element; sie darf
nicht der Haupthebel der Wirkung sein, sondern gerade nur soweit zu Geltung
kommen wollen, als sic ihrerseits die Zeichnung zur Geltung z>r bringen vermag.
Diese dagegen ist die eigentliche Seele des Stils, weil sich in ihr die künst-
lerische Idee am meisten, weil mit geistigsten offenbart. Zeichnung aber ist
Form und zwar,, wie die farblose Skulptur, reine Form —: darum ist
sic abstrakter als die Farbe, eben weil sie von ihr zu abstrahireu vermag,
während das Umgekehrte nicht möglich ist; oder mit andern Worten: man
kann sich ein Bild ohne Farbe, aber kein Gemälde ohne Zeichnung vorstellen.
Das erstere ist eben eine Zeichnung, das zweite würde ein ideen- und sinn-
loser FarbenkomplexWin, durch welchen höchstens eine blos materielle Kontrast-
wirkung erreicht würde, die nicht einmal die Regelmäßigkeit deö Regenbogenö
haben dürfte, da dieser noch immer neben seiner farbigen auch eine linearische
Anschauung gewährt.
Die Zeichnung steht daher über der Farbe wie die Seele über denl
Leibe: sic ist ein höheres, edleres, künstlerisch-bedeutsameres Moment, weil sie
die Trägerin der eigentlichen künstlerischen Idee ist. Die Farbe kann durch
ihre Schönheit entzücken, durch ihren Glanz zur Bewunderung, durch ihre
Naturwahrheit zum Entzücken Hinreißen: aber weiter geht ihre Macht nicht,
denn sie spricht einzig und allein an die mehr oder minder sinnliche Empfin-
dung; die Zeichnung dagegen spricht zur geistigen Empfindung, zur freien
Phantasie, zum Geiste, zum Verstände — mit oder ohne Farbe. Allerdings
kann die Farbe, besonders wenn sie sich an die durch die Zeichnung zur
Anschauung gebrachte Idee gewissermaßen symbolisch anschmiegt, sehr idealisirt
und dadurch zu einem wirksamen seelischen Moment der Wirkung erhoben werden,
wie z. B. Murillo durch diese zuweilen an Abstraktion streifende Reinigung
der Farbe wahrhaft groß ist; aber immer ist es doch die Zeichnung d. h.
die Idee der Komposition — denn wir verstehen hier unter Zeichnung natür-
lich nicht blos den Contonr oder die Modellirnng, sondern die ideelle Ge-
staltung überhaupt —, welche jener seelischen Wirkung erst die rechte Bedeutung
verleiht. Auch leuchtet es von selbst ein, daß die Farbe von der Zeichnung,
nicht aber umgekehrt diese von jenen abhängig ist; obschon wir wohl wissen,
daß es nicht wenige Künstler giebt, welche allein eines schönen, ihnen etwa
verschwebenden Kolorits wegen ein Bild malen, in der Ueberzengnng, daß,
wenn sie nur erst über die Farbenwirknng im Klaren seien, sich die speeicllcre
Detaillirung des Motivs dazu wohl von selbst finden lassen werde. Das
ist eine nur zil häufige Verkehrung des wahren Verhältnisses zwischen Zeich-
nung und Farbe, und zugleich eine traurige Verkennung dcs idealen Be-
rufs der Kunst. Freilich solchen Künstler ist eS nur um den äußerlichen
Effekt zu thun, sei cs daß sie diesen in einer niöglichst schlagenden Natnr-
wahrheit, sei es daß sie ihn in der Eleganz, Kraft und Feinheit der Kontrastirung
suchen. Denn so groß der anderweitige Unterschied zwischen den Natura-
listen und Effektmalern'sein mag: in dein einen Punkte treffen sie zn-
sammen, nemlich daß sie mehr zur sinnlichen Empfindung, als zur Seele
sprechen wollen. Aber was hilft die Natnrtrene, was nützt der frappante
Effekt, wenn cs innen hohl ist, wie das Herz ohne Liebe: „eine klingende
Schelle", wie die Bibel sagt.
Wir haben hier nur die Landschaftsmalerei im Sinn. Denn wollten
wir auch die andern Gebiete der Malerei oder gar die andern Künste mit
in die Betrachtung ziehen, so würde uns dies sehr weit führen. Denn leider
herrscht überall der geistlose Materialismus vor, sich spreizend mit eleganter
Technik und seine Blößen verdeckend durch die bunten Lappen des „genialen
Machwerks": eine Laterne brauchte man, wie Diogenes, der Menschensuchcr,
um heutzutage wahrhaftes Streben nach geistiger Bedeutsamkeit, wahren En-
thusiasmus für das Ideale, wahre Achtung vor dem Gedanken in der Kunst
zu finden. Lassen wir also diese unerfreuliche Perspektive für heute bei Seite
und wenden uns zu unserm Thema zurück.
Die Zeichnung — sagten wir — steht über der Farbe, wie die Seele
über dem Leibe. In der That kann man bei einem Gemälde, das als Kunst-
nen am 1. u. 15. jedes Mo-
nats in 1—2 Bogen gr. 4.'
Abonnementspreis vier-
teljährlich i Thlr. xrWnum.
für ganz Deutschland.
Sämmtliche Löbl. Poft-
anstalten u. Buchhand-
lungen des In- und Aus-
landes nehmen Abonne -
ments an. In Commission
der Nicolai'schen Buch-
handlung in Berlin.
t
(8
Nro. 26.1
Mittheilungen und Cor-
respondenzen aller Art, wel-
che den Inhalt der Zeitung
betreffen, sind an die „Ne-
dactiou der Dioskuren^^
( Jägerstr. 38), Reclama-
tionen an die „Expedi-
tion der Dioskuren"
(ebcnd.) zu richten.
sPrejs einer einzelnen
N u m m e r 5 Sgr. ohne
Knnstbeilage.j
Zkitschrist für Kunst, Kuustindustrik un- künstlerisches Leben,
] 1858.
reingiti unter DTtitroirfutng einheimischer und ausmiirtiger Kunstfreunde
von
Dr. Max SchasLer,
Secretair dcs „Museums für Kunst und künstlerische Interessen" in Berlin.
Vas Reckaktionsdnrean der „Dioskuren“ (Jägerstrasse 38) ist in der Regel täglich von 11 — 12 Uhr geöffnet.
3 it h
Abhandeinde Artikel: lieber das Verhältuiß von Farbe und Zeichnung als Elemente
des „Stils" in der Landschaftsmalerei von M. Sr.
Corrrlpondenxen: Z Dresden, im Januar. (Ein Altarbild von Schnorr und
Gönne.) — Münch en, Anfang Januar. (Die Königin Marie Eleonore am
Sarge Gustav Adolfs von Feod. Dietz re.) — * Bremen, Anfang.Januar.
(Einweihung der Künstlerhalle.)
Kunstchronik: Rothwendige Bemerkung der Redaktion. — Verschiedene Lokalnachrichtcn
aus Berlin, Potsdam, Brandenburg, Düsseldorf, Nürnberg Mün-
chen, Stuttgart, Paris, Brüssel, London.
Kunstkritik: Kritische Wanderungen durch die Knnstinstitnte und Ateliers .
von Berlin. — Permanente Gemäldeausstellung von L-achse.
Kunstgeschichte und Antiquitäten: Die Sammlung des Herrn Lenoir. (Privatmit-
theilnng.) — Das Neue Museum zu Danzig von R.
Kunstlitcralur und Albuin: I. Kunstliteratnr. Müller, Oe. H. A., „Die Museen
und Kunstwerke Deutschlands." — Guhl, Dr. E., „Die Frauen in der Kunstge-
schichte." — II. Album. „Album Berliner Künstler." Herausg. von Storch
und Kramer. 4. Heft.
Briefkasten.
Ueber das Verhältnis; van Farbe und Zeichnung als Elemente des „Stils" in der Fandschaftsmalcrei.
Von M« Tr.
Die gegenwärtiger Nummer beigegebene Kunstbeilage, eine treffliche Ra-
dirnng des durch seine meisterhaften landschaftlichen Blätter in dieser Manier
berühmten Direktors der Karlsruher Kunsthalle, Prof. C. Frommel, giebt
uns Anlaß, einige Worte über das, was man in der Landschaftsmalerei oder
strenggenommen Landschafts Zeichnung „Stil" nennt, zu sagen. Denn wenn
auch bei einer sogenannten „stilisirten Landschaft" die Farbe als ein wesent-
liches Moment mitwirkt, so beschränkt sich diese Mitwirkung doch hauptsächlich
auf eine gewisse strenge Einfachheit in Grnndton, ans eine gewisse ernste Tiefe
in der Farbenskalisirnng und auf eine Vermeidung aller scharfen Kontraste.
Die Farbe also zeigt sich im Stil sozusagen als negatives Element; sie darf
nicht der Haupthebel der Wirkung sein, sondern gerade nur soweit zu Geltung
kommen wollen, als sic ihrerseits die Zeichnung zur Geltung z>r bringen vermag.
Diese dagegen ist die eigentliche Seele des Stils, weil sich in ihr die künst-
lerische Idee am meisten, weil mit geistigsten offenbart. Zeichnung aber ist
Form und zwar,, wie die farblose Skulptur, reine Form —: darum ist
sic abstrakter als die Farbe, eben weil sie von ihr zu abstrahireu vermag,
während das Umgekehrte nicht möglich ist; oder mit andern Worten: man
kann sich ein Bild ohne Farbe, aber kein Gemälde ohne Zeichnung vorstellen.
Das erstere ist eben eine Zeichnung, das zweite würde ein ideen- und sinn-
loser FarbenkomplexWin, durch welchen höchstens eine blos materielle Kontrast-
wirkung erreicht würde, die nicht einmal die Regelmäßigkeit deö Regenbogenö
haben dürfte, da dieser noch immer neben seiner farbigen auch eine linearische
Anschauung gewährt.
Die Zeichnung steht daher über der Farbe wie die Seele über denl
Leibe: sic ist ein höheres, edleres, künstlerisch-bedeutsameres Moment, weil sie
die Trägerin der eigentlichen künstlerischen Idee ist. Die Farbe kann durch
ihre Schönheit entzücken, durch ihren Glanz zur Bewunderung, durch ihre
Naturwahrheit zum Entzücken Hinreißen: aber weiter geht ihre Macht nicht,
denn sie spricht einzig und allein an die mehr oder minder sinnliche Empfin-
dung; die Zeichnung dagegen spricht zur geistigen Empfindung, zur freien
Phantasie, zum Geiste, zum Verstände — mit oder ohne Farbe. Allerdings
kann die Farbe, besonders wenn sie sich an die durch die Zeichnung zur
Anschauung gebrachte Idee gewissermaßen symbolisch anschmiegt, sehr idealisirt
und dadurch zu einem wirksamen seelischen Moment der Wirkung erhoben werden,
wie z. B. Murillo durch diese zuweilen an Abstraktion streifende Reinigung
der Farbe wahrhaft groß ist; aber immer ist es doch die Zeichnung d. h.
die Idee der Komposition — denn wir verstehen hier unter Zeichnung natür-
lich nicht blos den Contonr oder die Modellirnng, sondern die ideelle Ge-
staltung überhaupt —, welche jener seelischen Wirkung erst die rechte Bedeutung
verleiht. Auch leuchtet es von selbst ein, daß die Farbe von der Zeichnung,
nicht aber umgekehrt diese von jenen abhängig ist; obschon wir wohl wissen,
daß es nicht wenige Künstler giebt, welche allein eines schönen, ihnen etwa
verschwebenden Kolorits wegen ein Bild malen, in der Ueberzengnng, daß,
wenn sie nur erst über die Farbenwirknng im Klaren seien, sich die speeicllcre
Detaillirung des Motivs dazu wohl von selbst finden lassen werde. Das
ist eine nur zil häufige Verkehrung des wahren Verhältnisses zwischen Zeich-
nung und Farbe, und zugleich eine traurige Verkennung dcs idealen Be-
rufs der Kunst. Freilich solchen Künstler ist eS nur um den äußerlichen
Effekt zu thun, sei cs daß sie diesen in einer niöglichst schlagenden Natnr-
wahrheit, sei es daß sie ihn in der Eleganz, Kraft und Feinheit der Kontrastirung
suchen. Denn so groß der anderweitige Unterschied zwischen den Natura-
listen und Effektmalern'sein mag: in dein einen Punkte treffen sie zn-
sammen, nemlich daß sie mehr zur sinnlichen Empfindung, als zur Seele
sprechen wollen. Aber was hilft die Natnrtrene, was nützt der frappante
Effekt, wenn cs innen hohl ist, wie das Herz ohne Liebe: „eine klingende
Schelle", wie die Bibel sagt.
Wir haben hier nur die Landschaftsmalerei im Sinn. Denn wollten
wir auch die andern Gebiete der Malerei oder gar die andern Künste mit
in die Betrachtung ziehen, so würde uns dies sehr weit führen. Denn leider
herrscht überall der geistlose Materialismus vor, sich spreizend mit eleganter
Technik und seine Blößen verdeckend durch die bunten Lappen des „genialen
Machwerks": eine Laterne brauchte man, wie Diogenes, der Menschensuchcr,
um heutzutage wahrhaftes Streben nach geistiger Bedeutsamkeit, wahren En-
thusiasmus für das Ideale, wahre Achtung vor dem Gedanken in der Kunst
zu finden. Lassen wir also diese unerfreuliche Perspektive für heute bei Seite
und wenden uns zu unserm Thema zurück.
Die Zeichnung — sagten wir — steht über der Farbe, wie die Seele
über dem Leibe. In der That kann man bei einem Gemälde, das als Kunst-