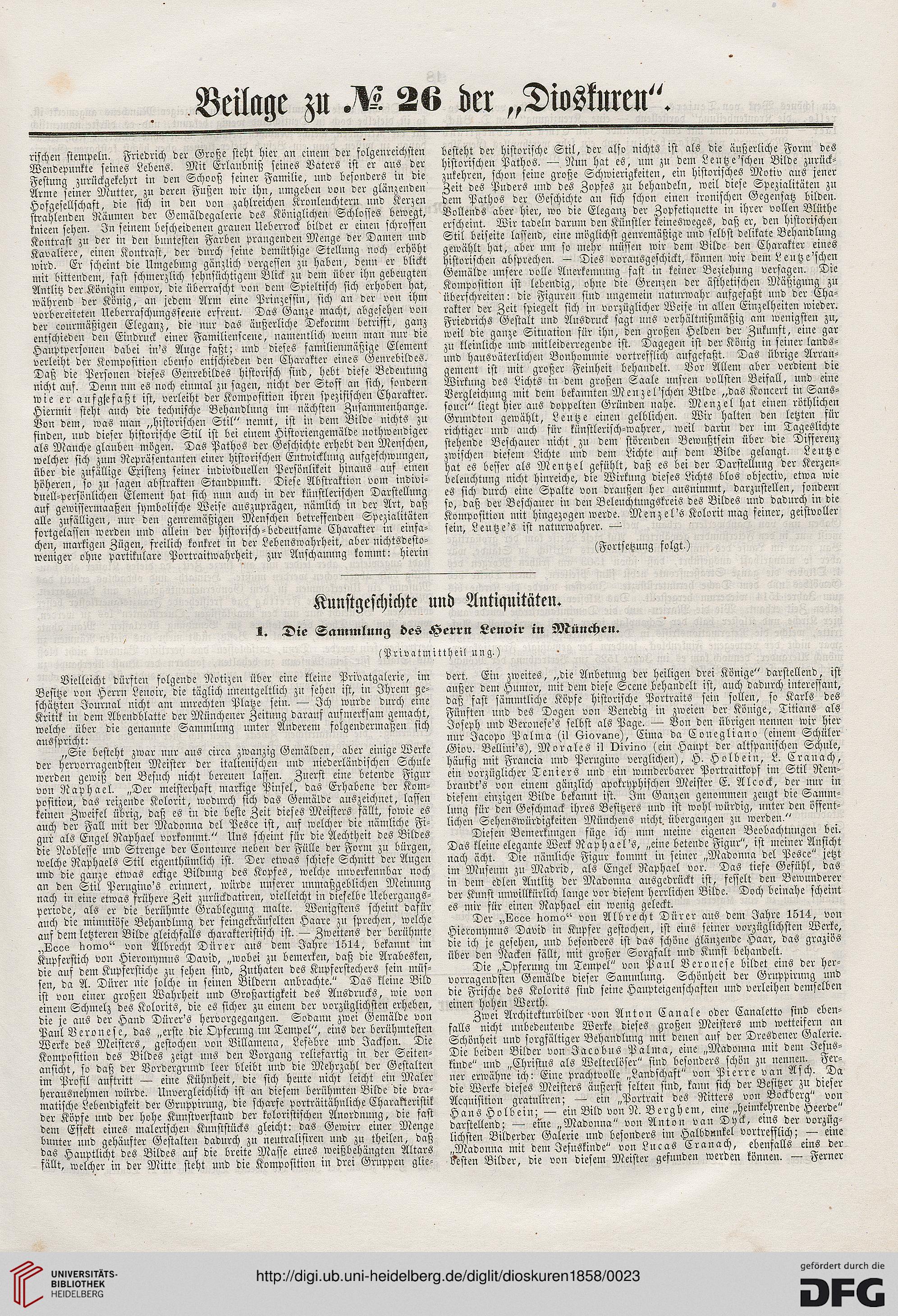Beilage zu M 26 der „Dioskuren".
rischen stempeln. Friedrich der Große steht hier an einem der folgenreichsten
Wendepunkte seines Lebens. Mit Erlaubnis; seines Vaters ist er aus der
Festung zurückgekehrt in den Schoost seiner Familie, und besonders in die
Arme seiner Mutter, zu deren Fußen wir ihn, umgeben von der glänzenden
Hofgesellschaft, die sich in den von zahlreichen Kronleuchtern und Kerzen
strahlenden Räumen der Gemäldegalerie des Königlichen Schlosses bewegt,
knieen sehen. In seinem bescheidenen grauen Ueberrock bildet er einen schroffen
Kontrast zu der in den buntesten Farben prangenden Menge der Damen und
Kavaliere, einen Kontrast, der durch seine demüthige Stellung noch erhöht
wird. Er scheint die Umgebung gänzlich vergessen zu haben, denn er blickt
mit bittendem, fast schmerzlich sehnsüchtigem Blick zu dem über ihn gebeugten
Antlitz der Königin empor, die überrascht von dem Spieltisch sich erhoben hat,
während der König, an jedem Arm eine Prinzessin, sich an der von ihm
vorbereiteten Neberraschungsseene erfreut. Das Ganze macht, abgesehen von
der courmäßigen Eleganz, die nur das äußerliche Dekorum betrifft, ganz
entschieden den Eindruck einer Familienscene, namentlich wenn man nur die
Hauptpersonen dabei in's Auge faßt; und dieses familienmäßige Element
verleiht der Komposition ebenso entschieden den Charakter eines Genrebildes.
Daß die Personen dieses Genrebildes historisch sind, hebt diese Bedeutung
nicht auf. Denn um es noch einmal zu sagen, nicht der Stoff an sich, sondern
wie er aufgjefaßt ist, verleiht der Komposition ihren spezifischen Charakter.
Hiermit steht auch die technische Behandlung im nächsten Zusammenhänge.
Von dem, was man „historischen Stil" nennt, ist in dem Bilde nichts. zu
finden, und dieser historische Stil ist bei einem Historiengemälde nothwendiger
als Manche glauben mögen. Das Pathos der Geschichte erhebt den Menschen,
welcher sich zum Repräsentanten einer historischen Entwicklung aufgeschwungen,
über die zufällige Existenz seiner individuellen Persönlikeit hinaus auf. einen
höheren, so zu sagen abstrakten Standpunkt. Diese Abstraktion vom indivi-
duell-persönlichen Element hat sich nun auch in der künstlerischen Darstellung
auf gewissermaaßen symbolische Weise auszuprägen, nämlich in der Art, daß
alle zufälligen, nur den genremäßigen Menschen betreffenden Spezialitäten
fortgelassen werden und allein der historisch-bedeutsame Charakter in einfa-
chen, markigen Zügen, freilich konkret in der Lebenswahrheit, aber nichtsdesto-
weniger ohne partikulare Portraitwahrheit, zur Anschauung kommt: hierin
besteht der historische Stil, der also nichts ist als die äußerliche Form des
historischen Pathos. — Nun hat es, um zu dem Leutze'schen Bilde zurück-
zukehren, schon seine große Schwierigkeiten, ein historisches Motiv aus jener
Zeit des Puders und des Zopfes zu behandeln, weil diese Spezialitäten zu
dem Pathos der Geschichte an sich schon einen ironischen Gegensatz bilden.
Vollends aber hier, wo die Eleganz der Zopfetiqnette in ihrer vollen Blüthe
erscheint. Wir tadeln darum den Künstler keineswegcs, daß er, den historischen
Stil beiseite lassend, eine möglichst genremäßige und selbst delikate Behandlung
gewählt hat, aber um so mehr müssen wir dem Bilde den Charakter eines
historischen absprechen. — Dies vorausgeschickt, können wir dem Leutze'schen
Gemälde unsere volle Anerkennung fast in keiner Beziehung versagen. Die
Komposition ist lebendig, ohne die Grenzen der ästhetischen Mäßigung zu
überschreiten: die Figuren sind ungemein naturwahr aufgesaßt und der Cha-
rakter der Zeit spiegelt sich in vorzüglicher Weise in allen Einzelheiten wieder.
Friedrichs Gestalt und Ausdruck sagt uns verhältnißmästig am wenigsten zu,
weil die ganze Situation für ihn, den großen Helden der Zukunft, eine gar
zu kleinliche und mitleiderregende ist. Dagegen ist der König in seiner lands-
und hausväterlichen Bonhommie vortrefflich aufgefaßt. Das übrige Arran-
gement ist mit großer Feinheit behandelt. Vor Allem aber verdient die
Wirkung des Lichts in dem großen Saale unsren vollsten Beifall, und eine
Vergleichung mit dem bekannten Menzel'schen Bilde „das Koncert in Sans-
souci" liegt hier aus doppelten Gründen nahe. Menzel hat einen röthlichen
Grundton gewählt, Leutze einen gelblichen. Wir halten den letzten für
richtiger und auch für künstlerisch-wahrer, weil darin der im Tageslichte
stehende Beschauer nicht, zu dem störenden Bewußtsein über die Differenz
zwischen diesem Lichte und dem Lichte auf dem Bilde gelangt. Leutze
hat es besser als Mentzel gefühlt, daß es bei der Darstellung der Kerzen-
beleuchtung nicht hinreiche, die Wirkung dieses Lichts blos objectiv, etwa wie
es sich durch eine Spalte von draußen her ausnimmt, darzustellen, sondern
so, daß der Beschauer in den Beleuchtungskreis des Bildes und dadurch in die
Komposition mit hingezogen werde. Menz el's Kolorit mag feiner, geistvoller
sein, Leutze's ist natnrwahrer. —
(Fortsetzung folgt.)
Kunstgeschichte und Antiquitäten.
I Die Sammlung des Herrn Lenoir in München.
(Privatm
Vielleicht dürften folgende Notizen über eine kleine Privatgalerie, im
Besitze von Herrn Lenoir, die täglich unentgeltlich zu sehen ist, in Ihrem ge-
schätzten Journal nicht am Unrechten Platze sein. — Ich wurde durch eine
Kritik in dem Abendblatts der Münchener Zeitung darauf aufmerksam gemacht,
welche über die genannte Sammlung unter Anderem folgendermaßen sich
ausspricht:
„Sie besteht zwar nur aus circa zwanzig Gemälden, aber einige Werke
der hervorragendsten Meister der italienischen und niederländischen Schule
werden gewiß den Besuch nicht bereuen lassen. Zuerst eine betende Figur
von Raphael. „Der meisterhaft markige Pinsel, das Erhabene der Kom-
position, das reizende Kolorit, wodurch sich das Gemälde auszeichnet, lassen
keinen Zweifel übrig, daß es in die beste Zeit dieses Meisters fällt, sowie eS
auch der Fall mit der Madonna del PeSce ist, auf welcher die nämliche Fi-
gur als Engel Raphael vorkommt." Uns scheint für die Aechtheit des Bildes
die Noblesse und Strenge der Contoure neben der Fülle der Form zu bürgen,
welche Raphaels Stil eigentümlich ist. Der etwas schiefe Schnitt der Augen
und die ganze etwas eckige Bildung des Kopfes, welche unverkennbar noch
an den Stil Perugino's erinnert, würde unserer unmaßgeblichen Meinung
nach in eine etwas frühere Zeit zurückdatiren, vielleicht in dieselbe Uebergaugs-
periode, als er die berühmte Grablegung malte. Wenigstens scheint dafür
auch die minutiöse Behandlung der feingekräuselten Haare zu sprechen, welche
aus dem letzteren Bilde gleichfalls charakteristisch ist. — Zweitens der berühmte
„Loos homo“ von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1514, bekannt im
Kupferstich von Hieronymus David, „wobei zu bemerken, daß die Arabesken,
die auf dem Kupferstiche zu sehen sind, Zuthaten des Kupferstechers sein müs-
sen, da A. Dürer nie solche in seinen Bildern anbrachte." Das kleine Bild
ist von einer großen Wahrheit und Großartigkeit des Ausdrucks, wie von
einem Schmelz des Kolorits, die es sicher zu einem der vorzüglichsten erheben,
die je aus der Hand Dürer's hervorgegangen. Sodann zwei Gemälde von
Paul Veronese, das „erste die Opferung im Tempel", eins der berühmtesten
Werke des Meisters, gestochen von Villamena, Lefobre und Jackson. Die
Komposition des Bildes zeigt uns den Vorgang reliefartig in der Seiten-
ansicht, so daß der Vordergrund leer bleibt und die Mehrzahl der Gestalten
ini Profil auftritt — eine Kühnheit, die sich heute nicht leicht ein Maler
herausnehmen würde. Unvergleichlich ist an diesem berühmten Bilde die dra-
matische Lebendigkeit der Grnppiruug, die scharfe porträitähnliche Charakteristik
der Köpfe und der hohe Kunstverstand der koloristischen Anordnung, die fast
dem Effekt eines malerischen Kunststücks gleicht: das Gewirr einer Menge
bunter und gehäufter Gestalten dadurch zu neutralisiren und zu theilen, daß
das Hauptlicht des Bildes auf die breite Masse eines weißbehängten Altars
fällt, welcher in der Mitte steht und die Komposition in drei Gruppen glie-
ittheil ung.)
dert. Ein zweites, „die Anbetung der heiligen drei Könige" darstellend, ist
außer dem Humor, mit dem diese Scene behandelt ist, auch dadurch interessant,
daß fast sämmtliche Köpfe historische Portraits sein sollen, so Karls des
Fünften und des Dogen von Venedig in zweien der Könige, Titians als
Joseph und Veronese's selbst als Page. — Bon den übrigen nennen wir hier
nur Jacopo Palma (il 6-iovans), Cima da Conegliano (einem Schüler
.Giov. Bellini's), Morales U Divino (ein Haupt der altspanischen Schule,
häufig mit Francia und Perugino verglichen), H. Holbein, L. Cranach,
ein vorzüglicher Teniers und ein wunderbarer Portraitkopf im Stil Rem-
brandt's von einem gänzlich apokryphischen Meister E. Alcock, der nur in
diesem einzigen Bilde bekannt ist. Im Ganzen genommen zeugt die Samm-
lung fiir den Geschmack ihres Besitzers und ist wohl würdig, unter den öffent-
lichen Sehenswürdigkeiten Münchens nicht, übergangen zu werden."
Diesen Beinerkuugen füge ich nun meine eigenen Beobachtungen bei.
Das kleine elegante Werk Rap ha el's, „eine betende Figur", ist meiner Ansicht
nach acht. Die nämliche Figur kommt in seiner „Madonna del Pesce" jetzt
im Museum zu Madrid, als Engel Raphael vor. Das tiefe Gefühl, das
in dem edlen Antlitz der Madonna ausgedrückt ist, fesselt den Bewunderer
der Kunst unwillkürlich lange vor diesem herrlichen Bilde. Doch beinahe scheint
es mir für einen Raphael ein wenig geleckt.
Der „Ecce homo“ von Albrecht Dürer ans dem Jahre 1514, von
Hieronymus David in Kupfer gestochen, ist eins seiner vorzüglichsten Werke,
die ich je gesehen, und besonders ist das schöne glänzende Haar, das graziös
über den Nacken fällt, mit großer Sorgfalt und Kunst behandelt.
Die „Opferung im Tempel" von Paul Veronese bildet eins der her-
vorragendsten Gemälde dieser Sammlung. Schönheit der Gruppirnng und
die Frische deö Kolorits sind seine Haupteigeuschaftcn und verleihen demselben
einen hohen Werth.
Zwei Architekturbilder-von Anton Canale oder Canaletto sind eben-
falls nicht unbedeutende Werke dieses großen Meisters und wetteifern an
Schönheit und sorgfältiger Behandlung mit denen auf der Dresdener Galerie.
Die beiden Bilder von Jacobus Palma, eine „Madonna mit dem Jesus-
kinde" und „Christus als Welterlöser" sind besonders schön zu nennen. Fer-
ner erwähne ich: Eine prachtvolle „Landschaft" von Pierre van Asch. Da
die Werke dieses Meisters äußerst selten sind, kann sich der Besitzer zu dieser
Acquisition gratuliren; — ein „Portrait des Ritters von Bockberg" von
Hans Holbein; — ein Bild von N. Berghem, eine „heimkehrende Heerde"
darstellend; — eine „Madonna" von Anton van Dyck, eins der vorzüg-
lichsten Bilderder Galerie und besonders im Halbdunkel vortrefflich; — eine
„Madonna mit dem Jesuskinde" von Lucas Cranach, ebenfalls eins der
vesten Bilder, die von diesem Meister gefunden werden können. — Ferner
rischen stempeln. Friedrich der Große steht hier an einem der folgenreichsten
Wendepunkte seines Lebens. Mit Erlaubnis; seines Vaters ist er aus der
Festung zurückgekehrt in den Schoost seiner Familie, und besonders in die
Arme seiner Mutter, zu deren Fußen wir ihn, umgeben von der glänzenden
Hofgesellschaft, die sich in den von zahlreichen Kronleuchtern und Kerzen
strahlenden Räumen der Gemäldegalerie des Königlichen Schlosses bewegt,
knieen sehen. In seinem bescheidenen grauen Ueberrock bildet er einen schroffen
Kontrast zu der in den buntesten Farben prangenden Menge der Damen und
Kavaliere, einen Kontrast, der durch seine demüthige Stellung noch erhöht
wird. Er scheint die Umgebung gänzlich vergessen zu haben, denn er blickt
mit bittendem, fast schmerzlich sehnsüchtigem Blick zu dem über ihn gebeugten
Antlitz der Königin empor, die überrascht von dem Spieltisch sich erhoben hat,
während der König, an jedem Arm eine Prinzessin, sich an der von ihm
vorbereiteten Neberraschungsseene erfreut. Das Ganze macht, abgesehen von
der courmäßigen Eleganz, die nur das äußerliche Dekorum betrifft, ganz
entschieden den Eindruck einer Familienscene, namentlich wenn man nur die
Hauptpersonen dabei in's Auge faßt; und dieses familienmäßige Element
verleiht der Komposition ebenso entschieden den Charakter eines Genrebildes.
Daß die Personen dieses Genrebildes historisch sind, hebt diese Bedeutung
nicht auf. Denn um es noch einmal zu sagen, nicht der Stoff an sich, sondern
wie er aufgjefaßt ist, verleiht der Komposition ihren spezifischen Charakter.
Hiermit steht auch die technische Behandlung im nächsten Zusammenhänge.
Von dem, was man „historischen Stil" nennt, ist in dem Bilde nichts. zu
finden, und dieser historische Stil ist bei einem Historiengemälde nothwendiger
als Manche glauben mögen. Das Pathos der Geschichte erhebt den Menschen,
welcher sich zum Repräsentanten einer historischen Entwicklung aufgeschwungen,
über die zufällige Existenz seiner individuellen Persönlikeit hinaus auf. einen
höheren, so zu sagen abstrakten Standpunkt. Diese Abstraktion vom indivi-
duell-persönlichen Element hat sich nun auch in der künstlerischen Darstellung
auf gewissermaaßen symbolische Weise auszuprägen, nämlich in der Art, daß
alle zufälligen, nur den genremäßigen Menschen betreffenden Spezialitäten
fortgelassen werden und allein der historisch-bedeutsame Charakter in einfa-
chen, markigen Zügen, freilich konkret in der Lebenswahrheit, aber nichtsdesto-
weniger ohne partikulare Portraitwahrheit, zur Anschauung kommt: hierin
besteht der historische Stil, der also nichts ist als die äußerliche Form des
historischen Pathos. — Nun hat es, um zu dem Leutze'schen Bilde zurück-
zukehren, schon seine große Schwierigkeiten, ein historisches Motiv aus jener
Zeit des Puders und des Zopfes zu behandeln, weil diese Spezialitäten zu
dem Pathos der Geschichte an sich schon einen ironischen Gegensatz bilden.
Vollends aber hier, wo die Eleganz der Zopfetiqnette in ihrer vollen Blüthe
erscheint. Wir tadeln darum den Künstler keineswegcs, daß er, den historischen
Stil beiseite lassend, eine möglichst genremäßige und selbst delikate Behandlung
gewählt hat, aber um so mehr müssen wir dem Bilde den Charakter eines
historischen absprechen. — Dies vorausgeschickt, können wir dem Leutze'schen
Gemälde unsere volle Anerkennung fast in keiner Beziehung versagen. Die
Komposition ist lebendig, ohne die Grenzen der ästhetischen Mäßigung zu
überschreiten: die Figuren sind ungemein naturwahr aufgesaßt und der Cha-
rakter der Zeit spiegelt sich in vorzüglicher Weise in allen Einzelheiten wieder.
Friedrichs Gestalt und Ausdruck sagt uns verhältnißmästig am wenigsten zu,
weil die ganze Situation für ihn, den großen Helden der Zukunft, eine gar
zu kleinliche und mitleiderregende ist. Dagegen ist der König in seiner lands-
und hausväterlichen Bonhommie vortrefflich aufgefaßt. Das übrige Arran-
gement ist mit großer Feinheit behandelt. Vor Allem aber verdient die
Wirkung des Lichts in dem großen Saale unsren vollsten Beifall, und eine
Vergleichung mit dem bekannten Menzel'schen Bilde „das Koncert in Sans-
souci" liegt hier aus doppelten Gründen nahe. Menzel hat einen röthlichen
Grundton gewählt, Leutze einen gelblichen. Wir halten den letzten für
richtiger und auch für künstlerisch-wahrer, weil darin der im Tageslichte
stehende Beschauer nicht, zu dem störenden Bewußtsein über die Differenz
zwischen diesem Lichte und dem Lichte auf dem Bilde gelangt. Leutze
hat es besser als Mentzel gefühlt, daß es bei der Darstellung der Kerzen-
beleuchtung nicht hinreiche, die Wirkung dieses Lichts blos objectiv, etwa wie
es sich durch eine Spalte von draußen her ausnimmt, darzustellen, sondern
so, daß der Beschauer in den Beleuchtungskreis des Bildes und dadurch in die
Komposition mit hingezogen werde. Menz el's Kolorit mag feiner, geistvoller
sein, Leutze's ist natnrwahrer. —
(Fortsetzung folgt.)
Kunstgeschichte und Antiquitäten.
I Die Sammlung des Herrn Lenoir in München.
(Privatm
Vielleicht dürften folgende Notizen über eine kleine Privatgalerie, im
Besitze von Herrn Lenoir, die täglich unentgeltlich zu sehen ist, in Ihrem ge-
schätzten Journal nicht am Unrechten Platze sein. — Ich wurde durch eine
Kritik in dem Abendblatts der Münchener Zeitung darauf aufmerksam gemacht,
welche über die genannte Sammlung unter Anderem folgendermaßen sich
ausspricht:
„Sie besteht zwar nur aus circa zwanzig Gemälden, aber einige Werke
der hervorragendsten Meister der italienischen und niederländischen Schule
werden gewiß den Besuch nicht bereuen lassen. Zuerst eine betende Figur
von Raphael. „Der meisterhaft markige Pinsel, das Erhabene der Kom-
position, das reizende Kolorit, wodurch sich das Gemälde auszeichnet, lassen
keinen Zweifel übrig, daß es in die beste Zeit dieses Meisters fällt, sowie eS
auch der Fall mit der Madonna del PeSce ist, auf welcher die nämliche Fi-
gur als Engel Raphael vorkommt." Uns scheint für die Aechtheit des Bildes
die Noblesse und Strenge der Contoure neben der Fülle der Form zu bürgen,
welche Raphaels Stil eigentümlich ist. Der etwas schiefe Schnitt der Augen
und die ganze etwas eckige Bildung des Kopfes, welche unverkennbar noch
an den Stil Perugino's erinnert, würde unserer unmaßgeblichen Meinung
nach in eine etwas frühere Zeit zurückdatiren, vielleicht in dieselbe Uebergaugs-
periode, als er die berühmte Grablegung malte. Wenigstens scheint dafür
auch die minutiöse Behandlung der feingekräuselten Haare zu sprechen, welche
aus dem letzteren Bilde gleichfalls charakteristisch ist. — Zweitens der berühmte
„Loos homo“ von Albrecht Dürer aus dem Jahre 1514, bekannt im
Kupferstich von Hieronymus David, „wobei zu bemerken, daß die Arabesken,
die auf dem Kupferstiche zu sehen sind, Zuthaten des Kupferstechers sein müs-
sen, da A. Dürer nie solche in seinen Bildern anbrachte." Das kleine Bild
ist von einer großen Wahrheit und Großartigkeit des Ausdrucks, wie von
einem Schmelz des Kolorits, die es sicher zu einem der vorzüglichsten erheben,
die je aus der Hand Dürer's hervorgegangen. Sodann zwei Gemälde von
Paul Veronese, das „erste die Opferung im Tempel", eins der berühmtesten
Werke des Meisters, gestochen von Villamena, Lefobre und Jackson. Die
Komposition des Bildes zeigt uns den Vorgang reliefartig in der Seiten-
ansicht, so daß der Vordergrund leer bleibt und die Mehrzahl der Gestalten
ini Profil auftritt — eine Kühnheit, die sich heute nicht leicht ein Maler
herausnehmen würde. Unvergleichlich ist an diesem berühmten Bilde die dra-
matische Lebendigkeit der Grnppiruug, die scharfe porträitähnliche Charakteristik
der Köpfe und der hohe Kunstverstand der koloristischen Anordnung, die fast
dem Effekt eines malerischen Kunststücks gleicht: das Gewirr einer Menge
bunter und gehäufter Gestalten dadurch zu neutralisiren und zu theilen, daß
das Hauptlicht des Bildes auf die breite Masse eines weißbehängten Altars
fällt, welcher in der Mitte steht und die Komposition in drei Gruppen glie-
ittheil ung.)
dert. Ein zweites, „die Anbetung der heiligen drei Könige" darstellend, ist
außer dem Humor, mit dem diese Scene behandelt ist, auch dadurch interessant,
daß fast sämmtliche Köpfe historische Portraits sein sollen, so Karls des
Fünften und des Dogen von Venedig in zweien der Könige, Titians als
Joseph und Veronese's selbst als Page. — Bon den übrigen nennen wir hier
nur Jacopo Palma (il 6-iovans), Cima da Conegliano (einem Schüler
.Giov. Bellini's), Morales U Divino (ein Haupt der altspanischen Schule,
häufig mit Francia und Perugino verglichen), H. Holbein, L. Cranach,
ein vorzüglicher Teniers und ein wunderbarer Portraitkopf im Stil Rem-
brandt's von einem gänzlich apokryphischen Meister E. Alcock, der nur in
diesem einzigen Bilde bekannt ist. Im Ganzen genommen zeugt die Samm-
lung fiir den Geschmack ihres Besitzers und ist wohl würdig, unter den öffent-
lichen Sehenswürdigkeiten Münchens nicht, übergangen zu werden."
Diesen Beinerkuugen füge ich nun meine eigenen Beobachtungen bei.
Das kleine elegante Werk Rap ha el's, „eine betende Figur", ist meiner Ansicht
nach acht. Die nämliche Figur kommt in seiner „Madonna del Pesce" jetzt
im Museum zu Madrid, als Engel Raphael vor. Das tiefe Gefühl, das
in dem edlen Antlitz der Madonna ausgedrückt ist, fesselt den Bewunderer
der Kunst unwillkürlich lange vor diesem herrlichen Bilde. Doch beinahe scheint
es mir für einen Raphael ein wenig geleckt.
Der „Ecce homo“ von Albrecht Dürer ans dem Jahre 1514, von
Hieronymus David in Kupfer gestochen, ist eins seiner vorzüglichsten Werke,
die ich je gesehen, und besonders ist das schöne glänzende Haar, das graziös
über den Nacken fällt, mit großer Sorgfalt und Kunst behandelt.
Die „Opferung im Tempel" von Paul Veronese bildet eins der her-
vorragendsten Gemälde dieser Sammlung. Schönheit der Gruppirnng und
die Frische deö Kolorits sind seine Haupteigeuschaftcn und verleihen demselben
einen hohen Werth.
Zwei Architekturbilder-von Anton Canale oder Canaletto sind eben-
falls nicht unbedeutende Werke dieses großen Meisters und wetteifern an
Schönheit und sorgfältiger Behandlung mit denen auf der Dresdener Galerie.
Die beiden Bilder von Jacobus Palma, eine „Madonna mit dem Jesus-
kinde" und „Christus als Welterlöser" sind besonders schön zu nennen. Fer-
ner erwähne ich: Eine prachtvolle „Landschaft" von Pierre van Asch. Da
die Werke dieses Meisters äußerst selten sind, kann sich der Besitzer zu dieser
Acquisition gratuliren; — ein „Portrait des Ritters von Bockberg" von
Hans Holbein; — ein Bild von N. Berghem, eine „heimkehrende Heerde"
darstellend; — eine „Madonna" von Anton van Dyck, eins der vorzüg-
lichsten Bilderder Galerie und besonders im Halbdunkel vortrefflich; — eine
„Madonna mit dem Jesuskinde" von Lucas Cranach, ebenfalls eins der
vesten Bilder, die von diesem Meister gefunden werden können. — Ferner