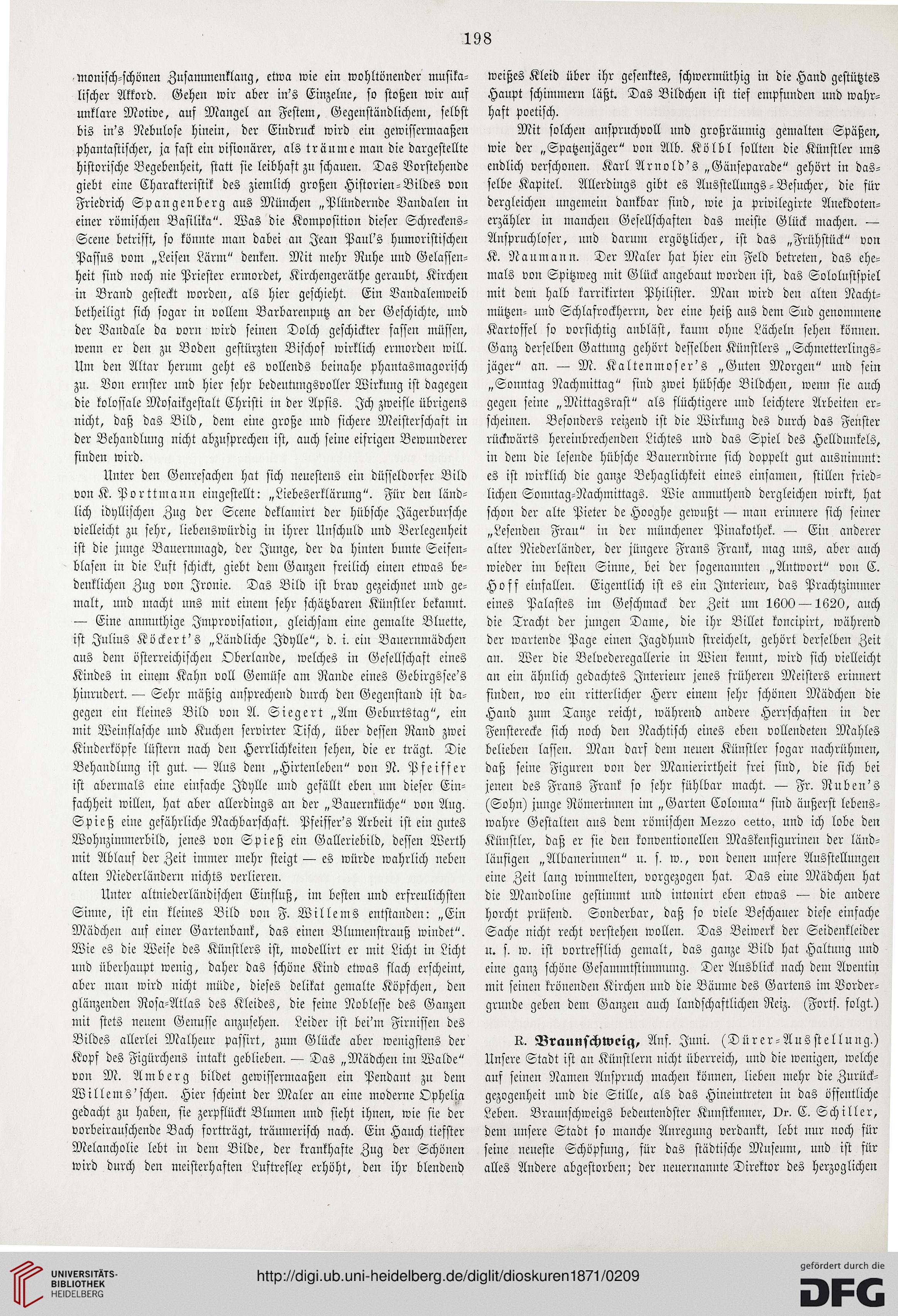198
monisch-schönen Zusammenklang, etwa wie ein wohltönender musika-
lischer Akkord. Gehen wir aber in's Einzelne, so stoßen wir auf
unklare Motive, auf Mangel an Festem, Gegenständlichem, selbst
bis in's Nebulöse hinein, der Eindruck wird ein gewissermaaßen
phantastischer, ja fast ein visionärer, als träume man die dargestellte
historische Begebenheit, statt sie leibhaft zu schauen. Das Vorstehende
giebt eine Charakteristik des ziemlich großen Historien-Bildes von
Friedrich Spangenberg aus München „Plündernde Vandalen in
einer römischen Basilika". Was die Komposition dieser Schreckens-
Scene betrifft, so könnte man dabei an Jean Paul's humoristischen
Passus vom „Leisen Lärm" denken. Mit mehr Ruhe und Gelassen-
heit sind noch nie Priester ermordet, Kirchengeräthe geraubt, Kirchen
in Brand gesteckt worden, als hier geschieht. Ein Vandalenweib
betheiligt sich sogar in vollem Barbarenputz an der Geschichte, und
der Vandale da vorn wird seinen Dolch geschickter fassen müssen,
wenn er den zu Boden gestürzten Bischof wirklich ermorden will.
Um den Altar herum geht es vollends beinahe phantasmagorisch
zu. Von ernster und hier sehr bedeutungsvoller Wirkung ist dagegen
die kolossale Mosaikgestalt Christi in der Apsis. Ich zweifle übrigens
nicht, daß das Bild, dem eine große und sichere Meisterschaft in
der Behandlung nicht abzusprechen ist, auch seine eifrigen Bewunderer
finden wird.
Unter den Genresachen hat sich neuestens ein düsseldorser Bild
von K. Porttmann eingestellt: „Liebeserklärung". Für den länd-
lich idyllischen Zug der Scene deklamirt der hübsche Jägerbursche
vielleicht zu sehr, liebenswürdig in ihrer Unschuld und Verlegenheit
ist die junge Bauernmagd, der Junge, der da hinten bunte Seifen-
blasen in die Luft schickt, giebt dem Ganzen freilich einen etwas be-
denklichen Zug von Ironie. Das Bild ist brav gezeichnet und ge-
malt, und macht uns mit einem sehr schätzbaren Künstler bekannt.
— Eine anmuthige Improvisation, gleichsam eine gemalte Bluette,
ist Julius Köckert's „Ländliche Idylle", d. i. ein Bauernmädchen
aus dem österreichischen Oberlande, welches in Gesellschaft eines
Kindes in einem Kahn voll Gemüse am Rande eines Gebirgssee's
hinrudert. — Sehr mäßig ansprechend durch den Gegenstand ist da-
gegen ein kleines Bild von A. Siegert „Am Geburtstag", ein
mit Weinflasche und Kuchen servirter Tisch, über dessen Rand zwei
Kinderköpfe lüstern nach den Herrlichkeiten sehen, die er trägt. Die
Behandlung ist gut. — Aus dem „Hirtenleben" von N. Pfeiffer
ist abermals eine einfache Idylle und gefällt eben um dieser Ein-
fachheit willen, hat aber allerdings an der „Bauernküche" von Aug.
Spieß eine gefährliche Nachbarschaft. Pfeifser's Arbeit ist ein gutes
Wohnzimmerbild, jenes von Spieß ein Galleriebild, dessen Werth
mit Ablauf der Zeit immer mehr steigt — es würde wahrlich neben
alten Niederländern nichts verlieren.
Unter altniederländischen Einfluß, im besten und erfreulichsten
Sinne, ist ein kleines Bild von F. Willems entstanden: „Ein
Mädchen ans einer Gartenbank, das einen Blumenstrauß windet".
Wie es die Weise des Künstlers ist, modellirt er mit Licht in Licht
und überhaupt wenig, daher das schöne Kind etwas flach erscheint,
aber man wird nicht müde, dieses delikat gemalte Köpfchen, den
glänzenden Rosa-Atlas des Kleides, die seine Noblesse des Ganzen
mit stets neuem Genüsse auzusehen. Leider ist bei'm Firnissen des
Bildes allerlei Malheur passirt, zum Glücke aber wenigstens der
Kops des Figürchens intakt geblieben. — Das „Mädchen im Walde"
von M. Amberg bildet gewissermaaßen ein Pendant zu dem
Willems'scheu. Hier scheint der Maler an eine moderne Ophelia
gedacht zu haben, sie zerpflückt Blumen und sieht ihnen, wie sie der
vorbeiranschende Bach fortträgt, träumerisch nach. Ein Hauch tiefster
Melancholie lebt in dem Bilde, der krankhafte Zug der Schönen
wird durch den meisterhaften Luftreslex erhöht, den ihr blendend
weißes Kleid über ihr gesenktes, schwermüthig in die Hand gestütztes
Haupt schimmern läßt. Das Bildchen ist tief empfunden und wahr-
haft poetisch.
Mit solchen anspruchvoll und großräumig gemalten Späßen,
wie der „Spatzenjäger" von Alb. Kölbl sollten die Künstler uns
endlich verschonen. Karl Arnold's „Gänseparade" gehört in das-
selbe Kapitel. Allerdings gibt es Ausstellungs-Besucher, die für
dergleichen ungemein dankbar sind, wie ja privilegirte Anekdoten-
erzähler in manchen Gesellschaften das meiste Glück machen. —
Anspruchloser, und darum ergötzlicher, ist das „Frühstück" von
K. Naumann. Der Maler hat hier ein Feld betreten, das ehe-
mals von Spitzweg mit Glück angebaut worden ist, das Sololustspiel
mit dem halb karrikirten Philister. Man wird den alten Nacht-
mützen- und Schlafrockherrn, der eine heiß aus dem Sud genommene
Kartoffel so vorsichtig anbläst, kaum ohne Lächeln sehen können.
Ganz derselben Gattung gehört desselben Künstlers „Schmetterlings-
jäger" an. — M. Kaltenmoser's „Guten Morgen" und sein
„Sonntag Nachmittag" sind zwei hübsche Bildchen, wenn sie auch
gegen seine „Mittagsrast" als flüchtigere und leichtere Arbeiten er-
scheinen. Besonders reizend ist die Wirkung des durch das Fenster
rückwärts hereinbrechenden Lichtes und das Spiel des Helldunkels,
in dem die lesende hübsche Bauerndirne sich doppelt gut ausnimmt:
es ist wirklich die ganze Behaglichkeit eines einsamen, stillen fried-
lichen Sonntag-Nachmittags. Wie anmuthend dergleichen wirkt, hat
schon der alte Pieter de Hooghe gewußt — man erinnere sich seiner
„Lesenden Frau" in der Münchener Pinakothek. — Ein anderer
alter Niederländer, der jüngere Frans Frank, mag uns, aber auch
wieder im besteu Sinne, bei der sogenannten „Antwort" von C.
Hoff einfallen. Eigentlich ist es ein Interieur, das Prachtzimmer
eines Palastes im Geschmack der Zeit um 1600 —1620, auch
die Tracht der jungen Dame, die ihr Billet koncipirt, während
der wartende Page einen Jagdhund streichelt, gehört derselben Zeit
an. Wer die Belvederegallerie in Wien kennt, wird sich vielleicht
an ein ähnlich gedachtes Interieur jenes früheren Meisters erinnert
finden, wo ein ritterlicher Herr einem sehr schönen Mädchen die
Hand zum Tanze reicht, während andere Herrschaften in der
Fensterecke sich noch den Nachtisch eines eben vollendeten Mahles
belieben lassen. Man darf dem neuen Künstler sogar nachrühmen,
daß seine Figuren von der Manierirtheit frei sind, die sich bei
jenen des Frans Frank so sehr fühlbar macht. — Fr. Ruben's
(Sohn) junge Römerinnen im „Garten Colonna" sind äußerst lebens-
wahre Gestalten aus dem römischen Mezzo cetto, und ich lobe den
Künstler, daß er sie den konventionellen Maskenfigurinen der länd-
läusigen „Albanerinnen" u. s. w., von denen unsere Ausstellungen
eine Zeit lang wimmelten, vorgezogen hat. Das eine Mädchen hat
die Mandoline gestimmt und intonirt eben etwas — die andere
horcht prüfend. Sonderbar, daß so viele Beschauer diese einfache
Sache nicht recht verstehen wollen. Das Beiwerk der Seidenkleider
u. s. w. ist vortrefflich gemalt, das ganze Bild hat Haltung und
eine ganz schöne Gesammtstimmung. Der Ausblick nach dem Aventin
mit seinen krönenden Kirchen und die Bäume des Gartens im Vorder-
gründe geben dem Ganzen auch landschaftlichen Reiz. (Forts, folgt.)
R. Vrannschweig, Ans. Juni. (Dürer-Ausstellung.)
Unsere Stadt ist an Künstlern nicht überreich, und die wenigen, welche
auf seinen Namen Anspruch machen können, lieben mehr die Zurück-
gezogenheit und die Stille, als das Hineintreten in das öffentliche
Leben. Braunschweigs bedeutendster Kunstkenner, Dr. C. Schiller,
dem unsere Stadt so manche Anregung verdankt, lebt nur noch für
seine neueste Schöpfung, für das städtische Museum, und ist für
alles Andere abgestorben; der neuernannte Direktor des herzoglichen
monisch-schönen Zusammenklang, etwa wie ein wohltönender musika-
lischer Akkord. Gehen wir aber in's Einzelne, so stoßen wir auf
unklare Motive, auf Mangel an Festem, Gegenständlichem, selbst
bis in's Nebulöse hinein, der Eindruck wird ein gewissermaaßen
phantastischer, ja fast ein visionärer, als träume man die dargestellte
historische Begebenheit, statt sie leibhaft zu schauen. Das Vorstehende
giebt eine Charakteristik des ziemlich großen Historien-Bildes von
Friedrich Spangenberg aus München „Plündernde Vandalen in
einer römischen Basilika". Was die Komposition dieser Schreckens-
Scene betrifft, so könnte man dabei an Jean Paul's humoristischen
Passus vom „Leisen Lärm" denken. Mit mehr Ruhe und Gelassen-
heit sind noch nie Priester ermordet, Kirchengeräthe geraubt, Kirchen
in Brand gesteckt worden, als hier geschieht. Ein Vandalenweib
betheiligt sich sogar in vollem Barbarenputz an der Geschichte, und
der Vandale da vorn wird seinen Dolch geschickter fassen müssen,
wenn er den zu Boden gestürzten Bischof wirklich ermorden will.
Um den Altar herum geht es vollends beinahe phantasmagorisch
zu. Von ernster und hier sehr bedeutungsvoller Wirkung ist dagegen
die kolossale Mosaikgestalt Christi in der Apsis. Ich zweifle übrigens
nicht, daß das Bild, dem eine große und sichere Meisterschaft in
der Behandlung nicht abzusprechen ist, auch seine eifrigen Bewunderer
finden wird.
Unter den Genresachen hat sich neuestens ein düsseldorser Bild
von K. Porttmann eingestellt: „Liebeserklärung". Für den länd-
lich idyllischen Zug der Scene deklamirt der hübsche Jägerbursche
vielleicht zu sehr, liebenswürdig in ihrer Unschuld und Verlegenheit
ist die junge Bauernmagd, der Junge, der da hinten bunte Seifen-
blasen in die Luft schickt, giebt dem Ganzen freilich einen etwas be-
denklichen Zug von Ironie. Das Bild ist brav gezeichnet und ge-
malt, und macht uns mit einem sehr schätzbaren Künstler bekannt.
— Eine anmuthige Improvisation, gleichsam eine gemalte Bluette,
ist Julius Köckert's „Ländliche Idylle", d. i. ein Bauernmädchen
aus dem österreichischen Oberlande, welches in Gesellschaft eines
Kindes in einem Kahn voll Gemüse am Rande eines Gebirgssee's
hinrudert. — Sehr mäßig ansprechend durch den Gegenstand ist da-
gegen ein kleines Bild von A. Siegert „Am Geburtstag", ein
mit Weinflasche und Kuchen servirter Tisch, über dessen Rand zwei
Kinderköpfe lüstern nach den Herrlichkeiten sehen, die er trägt. Die
Behandlung ist gut. — Aus dem „Hirtenleben" von N. Pfeiffer
ist abermals eine einfache Idylle und gefällt eben um dieser Ein-
fachheit willen, hat aber allerdings an der „Bauernküche" von Aug.
Spieß eine gefährliche Nachbarschaft. Pfeifser's Arbeit ist ein gutes
Wohnzimmerbild, jenes von Spieß ein Galleriebild, dessen Werth
mit Ablauf der Zeit immer mehr steigt — es würde wahrlich neben
alten Niederländern nichts verlieren.
Unter altniederländischen Einfluß, im besten und erfreulichsten
Sinne, ist ein kleines Bild von F. Willems entstanden: „Ein
Mädchen ans einer Gartenbank, das einen Blumenstrauß windet".
Wie es die Weise des Künstlers ist, modellirt er mit Licht in Licht
und überhaupt wenig, daher das schöne Kind etwas flach erscheint,
aber man wird nicht müde, dieses delikat gemalte Köpfchen, den
glänzenden Rosa-Atlas des Kleides, die seine Noblesse des Ganzen
mit stets neuem Genüsse auzusehen. Leider ist bei'm Firnissen des
Bildes allerlei Malheur passirt, zum Glücke aber wenigstens der
Kops des Figürchens intakt geblieben. — Das „Mädchen im Walde"
von M. Amberg bildet gewissermaaßen ein Pendant zu dem
Willems'scheu. Hier scheint der Maler an eine moderne Ophelia
gedacht zu haben, sie zerpflückt Blumen und sieht ihnen, wie sie der
vorbeiranschende Bach fortträgt, träumerisch nach. Ein Hauch tiefster
Melancholie lebt in dem Bilde, der krankhafte Zug der Schönen
wird durch den meisterhaften Luftreslex erhöht, den ihr blendend
weißes Kleid über ihr gesenktes, schwermüthig in die Hand gestütztes
Haupt schimmern läßt. Das Bildchen ist tief empfunden und wahr-
haft poetisch.
Mit solchen anspruchvoll und großräumig gemalten Späßen,
wie der „Spatzenjäger" von Alb. Kölbl sollten die Künstler uns
endlich verschonen. Karl Arnold's „Gänseparade" gehört in das-
selbe Kapitel. Allerdings gibt es Ausstellungs-Besucher, die für
dergleichen ungemein dankbar sind, wie ja privilegirte Anekdoten-
erzähler in manchen Gesellschaften das meiste Glück machen. —
Anspruchloser, und darum ergötzlicher, ist das „Frühstück" von
K. Naumann. Der Maler hat hier ein Feld betreten, das ehe-
mals von Spitzweg mit Glück angebaut worden ist, das Sololustspiel
mit dem halb karrikirten Philister. Man wird den alten Nacht-
mützen- und Schlafrockherrn, der eine heiß aus dem Sud genommene
Kartoffel so vorsichtig anbläst, kaum ohne Lächeln sehen können.
Ganz derselben Gattung gehört desselben Künstlers „Schmetterlings-
jäger" an. — M. Kaltenmoser's „Guten Morgen" und sein
„Sonntag Nachmittag" sind zwei hübsche Bildchen, wenn sie auch
gegen seine „Mittagsrast" als flüchtigere und leichtere Arbeiten er-
scheinen. Besonders reizend ist die Wirkung des durch das Fenster
rückwärts hereinbrechenden Lichtes und das Spiel des Helldunkels,
in dem die lesende hübsche Bauerndirne sich doppelt gut ausnimmt:
es ist wirklich die ganze Behaglichkeit eines einsamen, stillen fried-
lichen Sonntag-Nachmittags. Wie anmuthend dergleichen wirkt, hat
schon der alte Pieter de Hooghe gewußt — man erinnere sich seiner
„Lesenden Frau" in der Münchener Pinakothek. — Ein anderer
alter Niederländer, der jüngere Frans Frank, mag uns, aber auch
wieder im besteu Sinne, bei der sogenannten „Antwort" von C.
Hoff einfallen. Eigentlich ist es ein Interieur, das Prachtzimmer
eines Palastes im Geschmack der Zeit um 1600 —1620, auch
die Tracht der jungen Dame, die ihr Billet koncipirt, während
der wartende Page einen Jagdhund streichelt, gehört derselben Zeit
an. Wer die Belvederegallerie in Wien kennt, wird sich vielleicht
an ein ähnlich gedachtes Interieur jenes früheren Meisters erinnert
finden, wo ein ritterlicher Herr einem sehr schönen Mädchen die
Hand zum Tanze reicht, während andere Herrschaften in der
Fensterecke sich noch den Nachtisch eines eben vollendeten Mahles
belieben lassen. Man darf dem neuen Künstler sogar nachrühmen,
daß seine Figuren von der Manierirtheit frei sind, die sich bei
jenen des Frans Frank so sehr fühlbar macht. — Fr. Ruben's
(Sohn) junge Römerinnen im „Garten Colonna" sind äußerst lebens-
wahre Gestalten aus dem römischen Mezzo cetto, und ich lobe den
Künstler, daß er sie den konventionellen Maskenfigurinen der länd-
läusigen „Albanerinnen" u. s. w., von denen unsere Ausstellungen
eine Zeit lang wimmelten, vorgezogen hat. Das eine Mädchen hat
die Mandoline gestimmt und intonirt eben etwas — die andere
horcht prüfend. Sonderbar, daß so viele Beschauer diese einfache
Sache nicht recht verstehen wollen. Das Beiwerk der Seidenkleider
u. s. w. ist vortrefflich gemalt, das ganze Bild hat Haltung und
eine ganz schöne Gesammtstimmung. Der Ausblick nach dem Aventin
mit seinen krönenden Kirchen und die Bäume des Gartens im Vorder-
gründe geben dem Ganzen auch landschaftlichen Reiz. (Forts, folgt.)
R. Vrannschweig, Ans. Juni. (Dürer-Ausstellung.)
Unsere Stadt ist an Künstlern nicht überreich, und die wenigen, welche
auf seinen Namen Anspruch machen können, lieben mehr die Zurück-
gezogenheit und die Stille, als das Hineintreten in das öffentliche
Leben. Braunschweigs bedeutendster Kunstkenner, Dr. C. Schiller,
dem unsere Stadt so manche Anregung verdankt, lebt nur noch für
seine neueste Schöpfung, für das städtische Museum, und ist für
alles Andere abgestorben; der neuernannte Direktor des herzoglichen