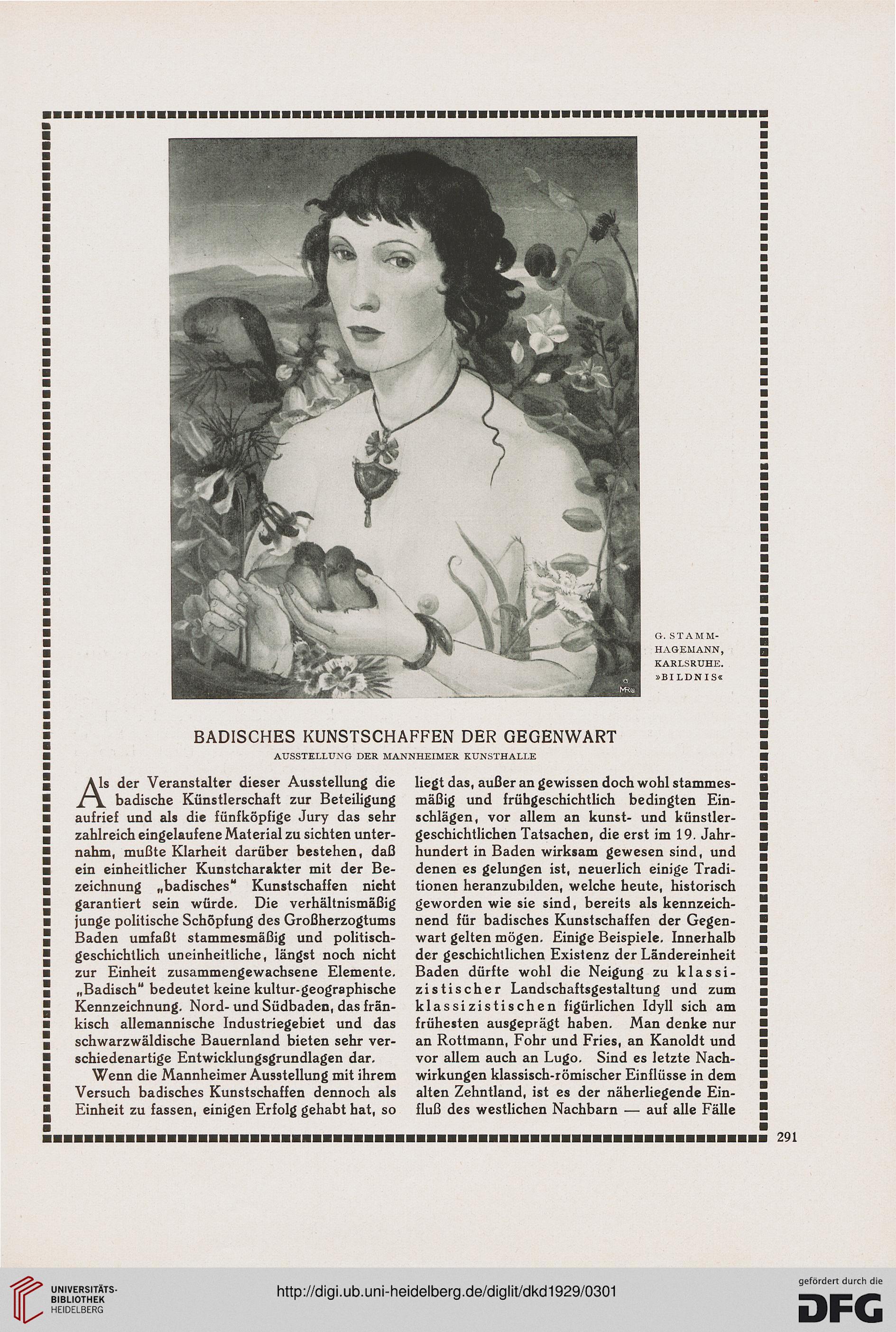G. STAMM-
HAGEMANN,
KARLSRUHE.
»BILDNIS«
BADISCHES KUNSTSCHAFFEN DER GEGENWART
AUSSTELLUNG DER MANNHEIMER KUNSTHALLE
Als der Veranstalter dieser Ausstellung die
badische Künstlerschaft zur Beteiligung
aufrief und als die fünfköpfige Jury das sehr
zahlreich eingelaufene Material zu sichten unter-
nahm, mußte Klarheit darüber bestehen, daß
ein einheitlicher Kunstcharakter mit der Be-
zeichnung „badisches" Kunstschaffen nicht
garantiert sein würde. Die verhältnismäßig
junge politische Schöpfung des Großherzogtums
Baden umfaßt stammesmäßig und politisch-
geschichtlich uneinheitliche, längst noch nicht
zur Einheit zusammengewachsene Elemente.
„Badisch" bedeutet keine kultur-geographische
Kennzeichnung. Nord- und Südbaden, das frän-
kisch allemannische Industriegebiet und das
schwarzwäldische Bauernland bieten sehr ver-
schiedenartige Entwicklungsgrundlagen dar.
Wenn die Mannheimer Ausstellung mit ihrem
Versuch badisches Kunstschaffen dennoch als
Einheit zu fassen, einigen Erfolg gehabt hat, so
liegt das, außer an gewissen doch wohl stammes-
mäßig und frühgeschichtlich bedingten Ein-
schlägen, vor allem an kunst- und künstler-
geschichtlichen Tatsachen, die erst im 19. Jahr-
hundert in Baden wirksam gewesen sind, und
denen es gelungen ist, neuerlich einige Tradi-
tionen heranzubilden, welche heute, historisch
geworden wie sie sind, bereits als kennzeich-
nend für badisches Kunstschaffen der Gegen-
wart gelten mögen. Einige Beispiele. Innerhalb
der geschichtlichen Existenz der Ländereinheit
Baden dürfte wohl die Neigung zu klassi-
zistischer Landschaftsgestaltung und zum
klassizistischen figürlichen Idyll sich am
frühesten ausgeprägt haben. Man denke nur
an Rottmann, Fohr und Fries, an Kanoldt und
vor allem auch an Lugo. Sind es letzte Nach-
wirkungen klassisch-römischer Einflüsse in dem
alten Zehntland, ist es der näherliegende Ein-
fluß des westlichen Nachbarn — auf alle Fälle
HAGEMANN,
KARLSRUHE.
»BILDNIS«
BADISCHES KUNSTSCHAFFEN DER GEGENWART
AUSSTELLUNG DER MANNHEIMER KUNSTHALLE
Als der Veranstalter dieser Ausstellung die
badische Künstlerschaft zur Beteiligung
aufrief und als die fünfköpfige Jury das sehr
zahlreich eingelaufene Material zu sichten unter-
nahm, mußte Klarheit darüber bestehen, daß
ein einheitlicher Kunstcharakter mit der Be-
zeichnung „badisches" Kunstschaffen nicht
garantiert sein würde. Die verhältnismäßig
junge politische Schöpfung des Großherzogtums
Baden umfaßt stammesmäßig und politisch-
geschichtlich uneinheitliche, längst noch nicht
zur Einheit zusammengewachsene Elemente.
„Badisch" bedeutet keine kultur-geographische
Kennzeichnung. Nord- und Südbaden, das frän-
kisch allemannische Industriegebiet und das
schwarzwäldische Bauernland bieten sehr ver-
schiedenartige Entwicklungsgrundlagen dar.
Wenn die Mannheimer Ausstellung mit ihrem
Versuch badisches Kunstschaffen dennoch als
Einheit zu fassen, einigen Erfolg gehabt hat, so
liegt das, außer an gewissen doch wohl stammes-
mäßig und frühgeschichtlich bedingten Ein-
schlägen, vor allem an kunst- und künstler-
geschichtlichen Tatsachen, die erst im 19. Jahr-
hundert in Baden wirksam gewesen sind, und
denen es gelungen ist, neuerlich einige Tradi-
tionen heranzubilden, welche heute, historisch
geworden wie sie sind, bereits als kennzeich-
nend für badisches Kunstschaffen der Gegen-
wart gelten mögen. Einige Beispiele. Innerhalb
der geschichtlichen Existenz der Ländereinheit
Baden dürfte wohl die Neigung zu klassi-
zistischer Landschaftsgestaltung und zum
klassizistischen figürlichen Idyll sich am
frühesten ausgeprägt haben. Man denke nur
an Rottmann, Fohr und Fries, an Kanoldt und
vor allem auch an Lugo. Sind es letzte Nach-
wirkungen klassisch-römischer Einflüsse in dem
alten Zehntland, ist es der näherliegende Ein-
fluß des westlichen Nachbarn — auf alle Fälle