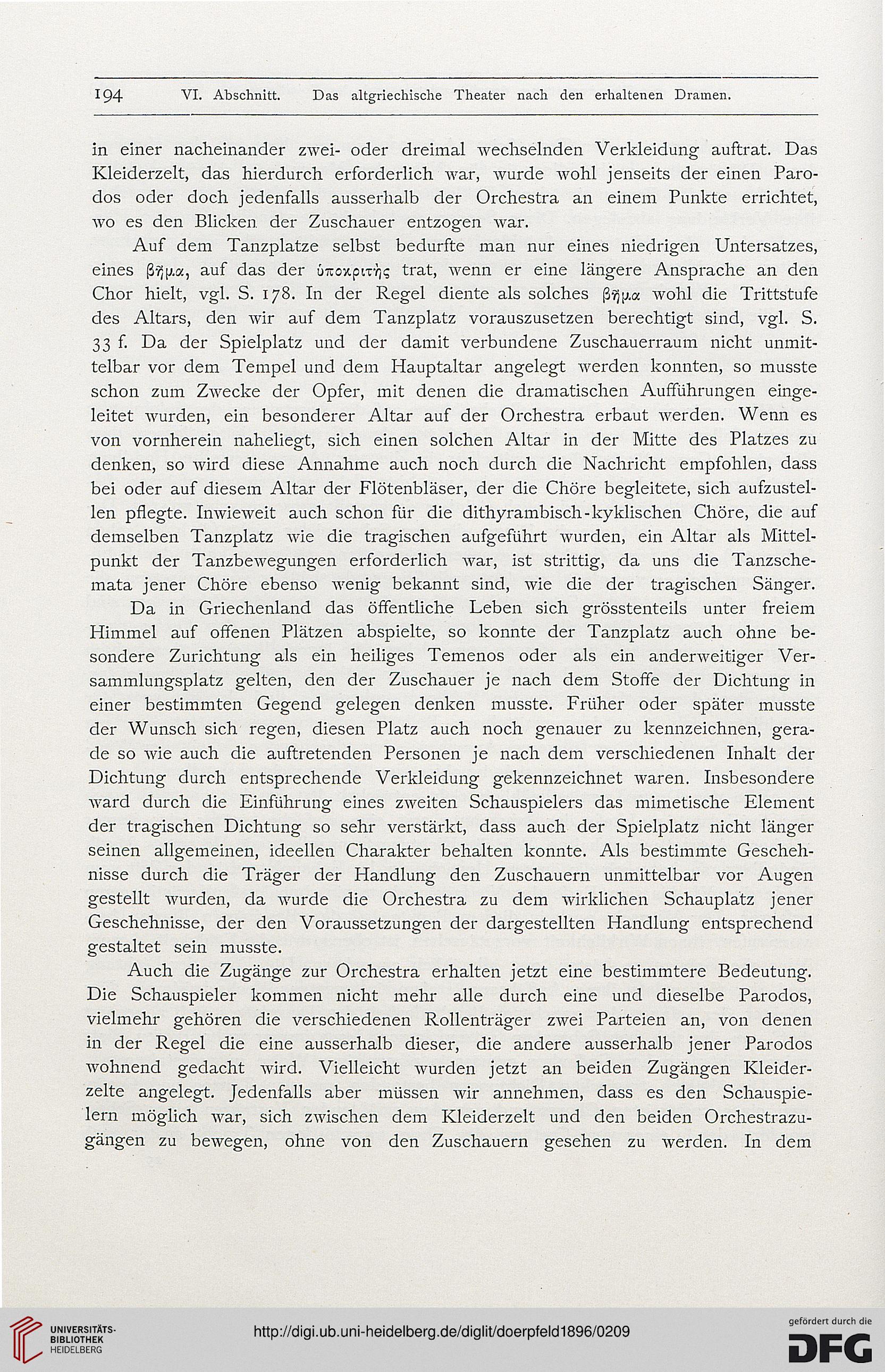i94
VI. Abschnitt. Das altgriechische Theater nach den erhaltenen Dramen.
in einer nacheinander zwei- oder dreimal wechselnden Verkleidung auftrat. Das
Kleiderzelt, das hierdurch erforderlich war, wurde wohl jenseits der einen Paro-
dos oder doch jedenfalls ausserhalb der Orchestra an einem Punkte errichtet,
wo es den Blicken der Zuschauer entzogen war.
Auf dem Tanzplatze selbst bedurfte man nur eines niedrigen Untersatzes,
eines fir^x, auf das der ü^oxpiro? trat, wenn er eine längere Ansprache an den
Chor hielt, vgl. S. 178. In der Regel diente als solches ß?j[j.a wohl die Trittstufe
des Altars, den wir auf dem Tanzplatz vorauszusetzen berechtigt sind, vgl. S.
33 f. Da der Spielplatz und der damit verbundene Zuschauerraum nicht unmit-
telbar vor dem Tempel und dem Hauptaltar angelegt werden konnten, so musste
schon zum Zwecke der Opfer, mit denen die dramatischen Aufführungen einge-
leitet wurden, ein besonderer Altar auf der Orchestra erbaut werden. Wenn es
von vornherein naheliegt, sich einen solchen Altar in der Mitte des Platzes zu
denken, so wird diese Annahme auch noch durch die Nachricht empfohlen, dass
bei oder auf diesem Altar der Flötenbläser, der die Chöre begleitete, sich aufzustel-
len pflegte. Inwieweit auch schon für die dithyrambisch-kyklischen Chöre, die auf
demselben Tanzplatz wie die tragischen aufgeführt wurden, ein Altar als Mittel-
punkt der Tanzbewegungen erforderlich war, ist strittig, da uns die Tanzsche-
mata jener Chöre ebenso wenig bekannt sind, wie die der tragischen Sänger.
Da in Griechenland das öffentliche Leben sich grösstenteils unter freiem
Himmel auf offenen Plätzen abspielte, so konnte der Tanzplatz auch ohne be-
sondere Zurichtung als ein heiliges Temenos oder als ein anderweitiger Ver-
sammlungsplatz gelten, den der Zuschauer je nach dem Stoffe der Dichtung in
einer bestimmten Gegend gelegen denken musste. Früher oder später musste
der Wunsch sich regen, diesen Platz auch noch genauer zu kennzeichnen, gera-
de so wie auch die auftretenden Personen je nach dem verschiedenen Inhalt der
Dichtung durch entsprechende Verkleidung gekennzeichnet waren. Insbesondere
ward durch die Einführung eines zweiten Schauspielers das mimetische Element
der tragischen Dichtung so sehr verstärkt, dass auch der Spielplatz nicht länger
seinen allgemeinen, ideellen Charakter behalten konnte. Als bestimmte Gescheh-
nisse durch die Träger der Handlung den Zuschauern unmittelbar vor Augen
gestellt wurden, da wurde die Orchestra zu dem wirklichen Schauplatz jener
Geschehnisse, der den Voraussetzungen der dargestellten Handlung entsprechend
gestaltet sein musste.
Auch die Zugänge zur Orchestra erhalten jetzt eine bestimmtere Bedeutung.
Die Schauspieler kommen nicht mehr alle durch eine und dieselbe Parodos,
vielmehr gehören die verschiedenen Rollenträger zwei Parteien an, von denen
in der Regel die eine ausserhalb dieser, die andere ausserhalb jener Parodos
wohnend gedacht wird. Vielleicht wurden jetzt an beiden Zugängen Kleider-
zelte angelegt. Jedenfalls aber müssen wir annehmen, dass es den Schauspie-
lern möglich war, sich zwischen dem Kleiderzelt und den beiden Orchestrazu-
gängen zu bewegen, ohne von den Zuschauern gesehen zu werden. In dem
VI. Abschnitt. Das altgriechische Theater nach den erhaltenen Dramen.
in einer nacheinander zwei- oder dreimal wechselnden Verkleidung auftrat. Das
Kleiderzelt, das hierdurch erforderlich war, wurde wohl jenseits der einen Paro-
dos oder doch jedenfalls ausserhalb der Orchestra an einem Punkte errichtet,
wo es den Blicken der Zuschauer entzogen war.
Auf dem Tanzplatze selbst bedurfte man nur eines niedrigen Untersatzes,
eines fir^x, auf das der ü^oxpiro? trat, wenn er eine längere Ansprache an den
Chor hielt, vgl. S. 178. In der Regel diente als solches ß?j[j.a wohl die Trittstufe
des Altars, den wir auf dem Tanzplatz vorauszusetzen berechtigt sind, vgl. S.
33 f. Da der Spielplatz und der damit verbundene Zuschauerraum nicht unmit-
telbar vor dem Tempel und dem Hauptaltar angelegt werden konnten, so musste
schon zum Zwecke der Opfer, mit denen die dramatischen Aufführungen einge-
leitet wurden, ein besonderer Altar auf der Orchestra erbaut werden. Wenn es
von vornherein naheliegt, sich einen solchen Altar in der Mitte des Platzes zu
denken, so wird diese Annahme auch noch durch die Nachricht empfohlen, dass
bei oder auf diesem Altar der Flötenbläser, der die Chöre begleitete, sich aufzustel-
len pflegte. Inwieweit auch schon für die dithyrambisch-kyklischen Chöre, die auf
demselben Tanzplatz wie die tragischen aufgeführt wurden, ein Altar als Mittel-
punkt der Tanzbewegungen erforderlich war, ist strittig, da uns die Tanzsche-
mata jener Chöre ebenso wenig bekannt sind, wie die der tragischen Sänger.
Da in Griechenland das öffentliche Leben sich grösstenteils unter freiem
Himmel auf offenen Plätzen abspielte, so konnte der Tanzplatz auch ohne be-
sondere Zurichtung als ein heiliges Temenos oder als ein anderweitiger Ver-
sammlungsplatz gelten, den der Zuschauer je nach dem Stoffe der Dichtung in
einer bestimmten Gegend gelegen denken musste. Früher oder später musste
der Wunsch sich regen, diesen Platz auch noch genauer zu kennzeichnen, gera-
de so wie auch die auftretenden Personen je nach dem verschiedenen Inhalt der
Dichtung durch entsprechende Verkleidung gekennzeichnet waren. Insbesondere
ward durch die Einführung eines zweiten Schauspielers das mimetische Element
der tragischen Dichtung so sehr verstärkt, dass auch der Spielplatz nicht länger
seinen allgemeinen, ideellen Charakter behalten konnte. Als bestimmte Gescheh-
nisse durch die Träger der Handlung den Zuschauern unmittelbar vor Augen
gestellt wurden, da wurde die Orchestra zu dem wirklichen Schauplatz jener
Geschehnisse, der den Voraussetzungen der dargestellten Handlung entsprechend
gestaltet sein musste.
Auch die Zugänge zur Orchestra erhalten jetzt eine bestimmtere Bedeutung.
Die Schauspieler kommen nicht mehr alle durch eine und dieselbe Parodos,
vielmehr gehören die verschiedenen Rollenträger zwei Parteien an, von denen
in der Regel die eine ausserhalb dieser, die andere ausserhalb jener Parodos
wohnend gedacht wird. Vielleicht wurden jetzt an beiden Zugängen Kleider-
zelte angelegt. Jedenfalls aber müssen wir annehmen, dass es den Schauspie-
lern möglich war, sich zwischen dem Kleiderzelt und den beiden Orchestrazu-
gängen zu bewegen, ohne von den Zuschauern gesehen zu werden. In dem