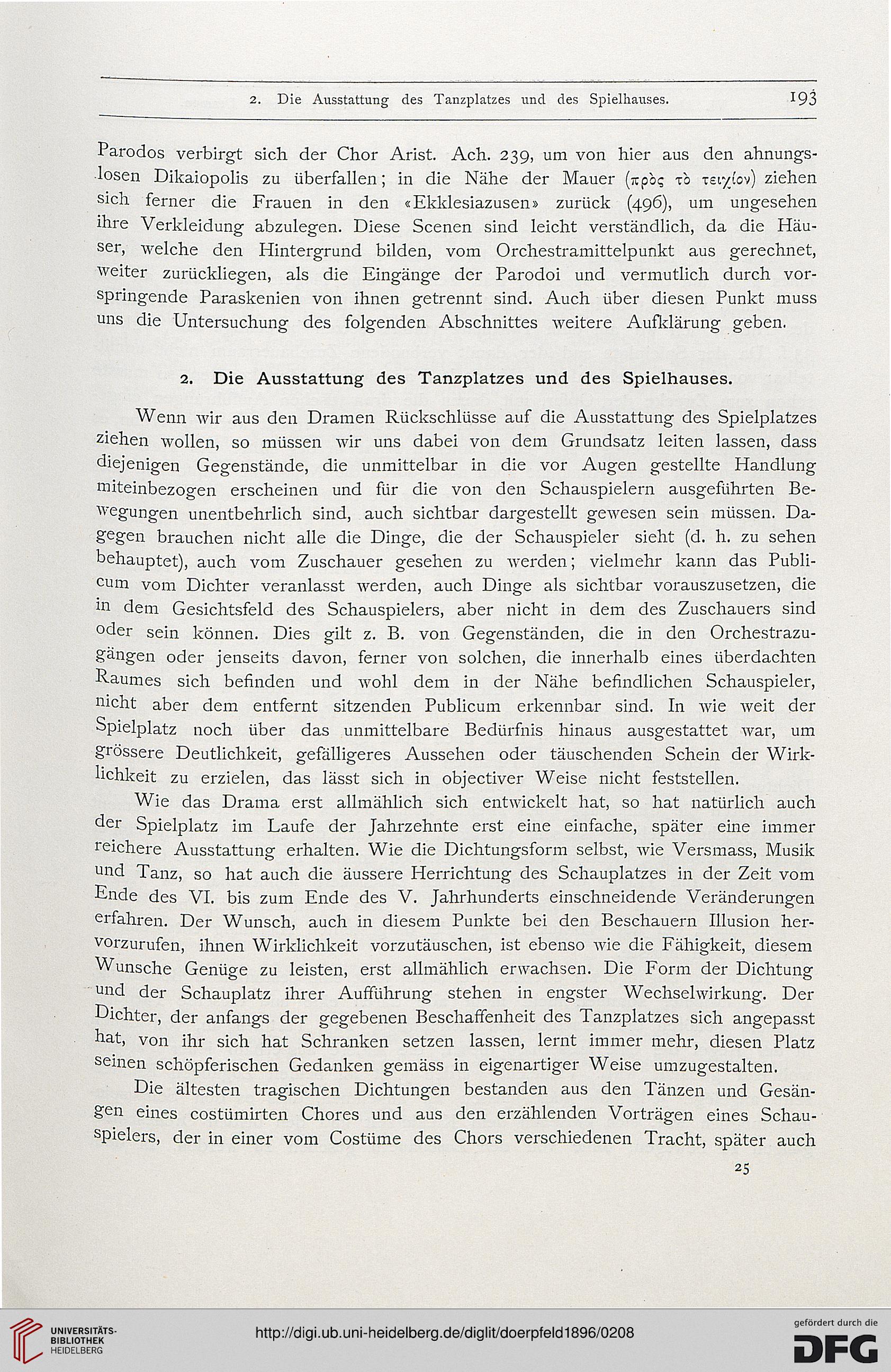2. Die Ausstattung des Tanzplatzes und des Spielhauses.
193
Parodos verbirgt sich der Chor Arist. Ach. 239, um von hier aus den ahnungs-
losen Dikaiopolis zu überfallen; in die Nähe der Mauer (irpbg xb Tsr/£ov) ziehen
sich ferner die Frauen in den «Ekklesiazusen» zurück (496), um ungesehen
ihre Verkleidung abzulegen. Diese Scenen sind leicht verständlich, da die Häu-
ser, welche den Hintergrund bilden, vom Orchestramittelpunkt aus gerechnet,
weiter zurückliegen, als die Eingänge der Parodoi und vermutlich durch vor-
springende Paraskenien von ihnen getrennt sind. Auch über diesen Punkt muss
uns die Untersuchung des folgenden Abschnittes weitere Aufklärung geben.
2. Die Ausstattung des Tanzplatzes und des Spielhauses.
Wenn wir aus den Dramen Rückschlüsse auf die Ausstattung des Spielplatzes
ziehen wollen, so müssen wir uns dabei von dem Grundsatz leiten lassen, dass
diejenigen Gegenstände, die unmittelbar in die vor Augen gestellte Handlung
miteinbezogen erscheinen und für die von den Schauspielern ausgeführten Be-
wegungen unentbehrlich sind, auch sichtbar dargestellt gewesen sein müssen. Da-
gegen brauchen nicht alle die Dinge, die der Schauspieler sieht (d. h. zu sehen
behauptet), auch vom Zuschauer gesehen zu werden; vielmehr kann das Publi-
cum vom Dichter veranlasst werden, auch Dinge als sichtbar vorauszusetzen, die
M dem Gesichtsfeld des Schauspielers, aber nicht in dem des Zuschauers sind
oder sein können. Dies gilt z. B. von Gegenständen, die in den Orchestrazu-
gängen oder jenseits davon, ferner von solchen, die innerhalb eines überdachten
Raumes sich befinden und wohl dem in der Nähe befindlichen Schauspieler,
nicht aber dem entfernt sitzenden Publicum erkennbar sind. In wie weit der
Spielplatz noch über das unmittelbare Bedürfnis hinaus ausgestattet war, um
grössere Deutlichkeit, gefälligeres Aussehen oder täuschenden Schein der Wirk-
lichkeit zu erzielen, das lässt sich in objectiver Weise nicht feststellen.
Wie das Drama erst allmählich sich entwickelt hat, so hat natürlich auch
der Spielplatz im Laufe der Jahrzehnte erst eine einfache, später eine immer
reichere Ausstattung erhalten. Wie die Dichtungsform selbst, wie Versmass, Musik
und Tanz, so hat auch die äussere Herrichtung des Schauplatzes in der Zeit vom
Ende des VT. bis zum Ende des V. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen
erfahren. Der Wunsch, auch in diesem Punkte bei den Beschauern Illusion her-
vorzurufen, ihnen Wirklichkeit vorzutäuschen, ist ebenso wie die Fähigkeit, diesem
Wunsche Genüge zu leisten, erst allmählich erwachsen. Die Form der Dichtung
und der Schauplatz ihrer Aufführung stehen in engster Wechselwirkung. Der
Dichter, der anfangs der gegebenen Beschaffenheit des Tanzplatzes sich angepasst
hat, von ihr sich hat Schranken setzen lassen, lernt immer mehr, diesen Platz
seinen schöpferischen Gedanken gemäss in eigenartiger Weise umzugestalten.
Die ältesten tragischen Dichtungen bestanden aus den Tänzen und Gesän-
gen eines costümirten Chores und aus den erzählenden Vorträgen eines Schau-
spielers, der in einer vom Costüme des Chors verschiedenen Tracht, später auch
25
193
Parodos verbirgt sich der Chor Arist. Ach. 239, um von hier aus den ahnungs-
losen Dikaiopolis zu überfallen; in die Nähe der Mauer (irpbg xb Tsr/£ov) ziehen
sich ferner die Frauen in den «Ekklesiazusen» zurück (496), um ungesehen
ihre Verkleidung abzulegen. Diese Scenen sind leicht verständlich, da die Häu-
ser, welche den Hintergrund bilden, vom Orchestramittelpunkt aus gerechnet,
weiter zurückliegen, als die Eingänge der Parodoi und vermutlich durch vor-
springende Paraskenien von ihnen getrennt sind. Auch über diesen Punkt muss
uns die Untersuchung des folgenden Abschnittes weitere Aufklärung geben.
2. Die Ausstattung des Tanzplatzes und des Spielhauses.
Wenn wir aus den Dramen Rückschlüsse auf die Ausstattung des Spielplatzes
ziehen wollen, so müssen wir uns dabei von dem Grundsatz leiten lassen, dass
diejenigen Gegenstände, die unmittelbar in die vor Augen gestellte Handlung
miteinbezogen erscheinen und für die von den Schauspielern ausgeführten Be-
wegungen unentbehrlich sind, auch sichtbar dargestellt gewesen sein müssen. Da-
gegen brauchen nicht alle die Dinge, die der Schauspieler sieht (d. h. zu sehen
behauptet), auch vom Zuschauer gesehen zu werden; vielmehr kann das Publi-
cum vom Dichter veranlasst werden, auch Dinge als sichtbar vorauszusetzen, die
M dem Gesichtsfeld des Schauspielers, aber nicht in dem des Zuschauers sind
oder sein können. Dies gilt z. B. von Gegenständen, die in den Orchestrazu-
gängen oder jenseits davon, ferner von solchen, die innerhalb eines überdachten
Raumes sich befinden und wohl dem in der Nähe befindlichen Schauspieler,
nicht aber dem entfernt sitzenden Publicum erkennbar sind. In wie weit der
Spielplatz noch über das unmittelbare Bedürfnis hinaus ausgestattet war, um
grössere Deutlichkeit, gefälligeres Aussehen oder täuschenden Schein der Wirk-
lichkeit zu erzielen, das lässt sich in objectiver Weise nicht feststellen.
Wie das Drama erst allmählich sich entwickelt hat, so hat natürlich auch
der Spielplatz im Laufe der Jahrzehnte erst eine einfache, später eine immer
reichere Ausstattung erhalten. Wie die Dichtungsform selbst, wie Versmass, Musik
und Tanz, so hat auch die äussere Herrichtung des Schauplatzes in der Zeit vom
Ende des VT. bis zum Ende des V. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen
erfahren. Der Wunsch, auch in diesem Punkte bei den Beschauern Illusion her-
vorzurufen, ihnen Wirklichkeit vorzutäuschen, ist ebenso wie die Fähigkeit, diesem
Wunsche Genüge zu leisten, erst allmählich erwachsen. Die Form der Dichtung
und der Schauplatz ihrer Aufführung stehen in engster Wechselwirkung. Der
Dichter, der anfangs der gegebenen Beschaffenheit des Tanzplatzes sich angepasst
hat, von ihr sich hat Schranken setzen lassen, lernt immer mehr, diesen Platz
seinen schöpferischen Gedanken gemäss in eigenartiger Weise umzugestalten.
Die ältesten tragischen Dichtungen bestanden aus den Tänzen und Gesän-
gen eines costümirten Chores und aus den erzählenden Vorträgen eines Schau-
spielers, der in einer vom Costüme des Chors verschiedenen Tracht, später auch
25