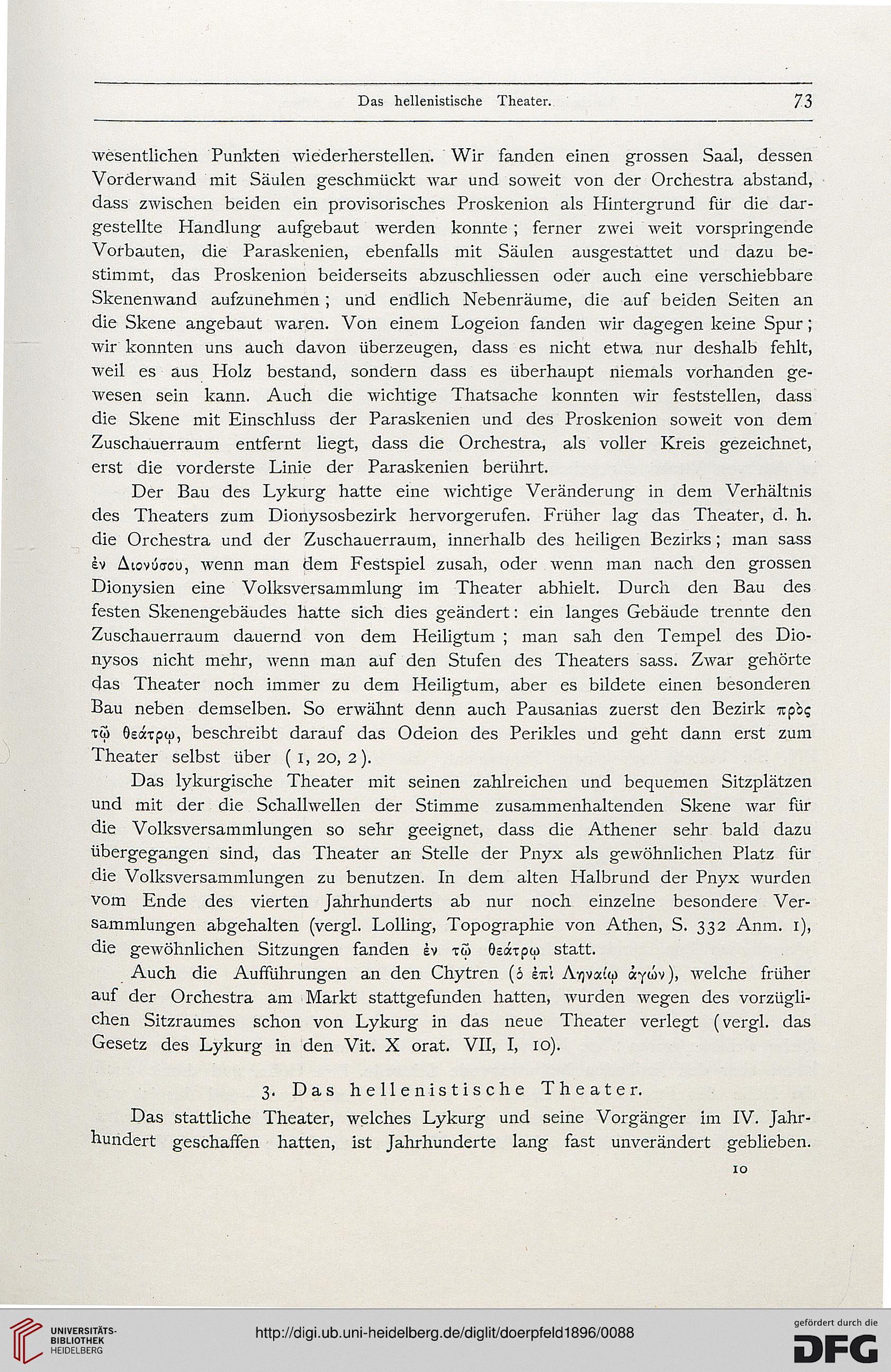Das hellenistische Theater.
73
wesentlichen Punkten wiederherstellen. Wir fanden einen grossen Saal, dessen
Vorderwand mit Säulen geschmückt war und soweit von der Orchestra abstand,
dass zwischen beiden ein provisorisches Proskenion als Hintergrund für die dar-
gestellte Handlung aufgebaut werden konnte ; ferner zwei weit vorspringende
Vorbauten, die Paraskenien, ebenfalls mit Säulen ausgestattet und dazu be-
stimmt, das Proskenion beiderseits abzuschliessen oder auch eine verschiebbare
Skenenwand aufzunehmen ; und endlich Nebenräume, die auf beiden Seiten an
die Skene angebaut waren. Von einem Logeion fanden wir dagegen keine Spur;
wir konnten uns auch davon überzeugen, dass es nicht etwa nur deshalb fehlt,
weil es aus Holz bestand, sondern dass es überhaupt niemals vorhanden ge-
wesen sein kann. Auch die wichtige Thatsache konnten wir feststellen, dass
die Skene mit Einschluss der Paraskenien und des Proskenion soweit von dem
Zuschauerraum entfernt liegt, dass die Orchestra, als voller Kreis gezeichnet,
erst die vorderste Linie der Paraskenien berührt.
Der Bau des Lykurg hatte eine wichtige Veränderung in dem Verhältnis
des Theaters zum Dionysosbezirk hervorgerufen. Früher lag das Theater, d. h.
die Orchestra und der Zuschauerraum, innerhalb des heiligen Bezirks; man sass
£v Atovüuou, wenn man dem Festspiel zusah, oder wenn man nach den grossen
Dionysien eine Volksversammlung im Theater abhielt. Durch den Bau des
festen Skenengebäudes hatte sich dies geändert: ein langes Gebäude trennte den
Zuschauerraum dauernd von dem Heiligtum ; man sah den Tempel des Dio-
nysos nicht mehr, wenn man auf den Stufen des Theaters sass. Zwar gehörte
das Theater noch immer zu dem Heiligtum, aber es bildete einen besonderen
Bau neben demselben. So erwähnt denn auch Pausanias zuerst den Bezirk Ttpb?
t<ö Qeatpw, beschreibt darauf das Odeion des Perikles und geht dann erst zum
Theater selbst über (1,20,2).
Das lykurgische Theater mit seinen zahlreichen und bequemen Sitzplätzen
und mit der die Schallwellen der Stimme zusammenhaltenden Skene war für
die Volksversammlungen so sehr geeignet, dass die Athener sehr bald dazu
übergegangen sind, das Theater an Stelle der Pnyx als gewöhnlichen Platz für
die Volksversammlungen zu benutzen. In dem alten Halbrund der Pnyx wurden
vom Ende des vierten Jahrhunderts ab nur noch einzelne besondere Ver-
sammlungen abgehalten (vergl. Lolling, Topographie von Athen, S. 332 Anm. 1),
die gewöhnlichen Sitzungen fanden ev tw Osaipu statt.
Auch die Aufführungen an den Chytren (b t%\ A-^vatw äywv), welche früher
auf der Orchestra am Markt stattgefunden hatten, Avurden wegen des vorzügli-
chen Sitzraumes schon von Lykurg in das neue Theater verlegt (vergl. das
Gesetz des Lykurg in den Vit. X orat. VII, I, 10).
3. Das hellenistische Theater.
Das stattliche Theater, welches Lykurg und seine Vorgänger im IV. Jahr-
hundert geschaffen hatten, ist Jahrhunderte lang fast unverändert geblieben.
10
73
wesentlichen Punkten wiederherstellen. Wir fanden einen grossen Saal, dessen
Vorderwand mit Säulen geschmückt war und soweit von der Orchestra abstand,
dass zwischen beiden ein provisorisches Proskenion als Hintergrund für die dar-
gestellte Handlung aufgebaut werden konnte ; ferner zwei weit vorspringende
Vorbauten, die Paraskenien, ebenfalls mit Säulen ausgestattet und dazu be-
stimmt, das Proskenion beiderseits abzuschliessen oder auch eine verschiebbare
Skenenwand aufzunehmen ; und endlich Nebenräume, die auf beiden Seiten an
die Skene angebaut waren. Von einem Logeion fanden wir dagegen keine Spur;
wir konnten uns auch davon überzeugen, dass es nicht etwa nur deshalb fehlt,
weil es aus Holz bestand, sondern dass es überhaupt niemals vorhanden ge-
wesen sein kann. Auch die wichtige Thatsache konnten wir feststellen, dass
die Skene mit Einschluss der Paraskenien und des Proskenion soweit von dem
Zuschauerraum entfernt liegt, dass die Orchestra, als voller Kreis gezeichnet,
erst die vorderste Linie der Paraskenien berührt.
Der Bau des Lykurg hatte eine wichtige Veränderung in dem Verhältnis
des Theaters zum Dionysosbezirk hervorgerufen. Früher lag das Theater, d. h.
die Orchestra und der Zuschauerraum, innerhalb des heiligen Bezirks; man sass
£v Atovüuou, wenn man dem Festspiel zusah, oder wenn man nach den grossen
Dionysien eine Volksversammlung im Theater abhielt. Durch den Bau des
festen Skenengebäudes hatte sich dies geändert: ein langes Gebäude trennte den
Zuschauerraum dauernd von dem Heiligtum ; man sah den Tempel des Dio-
nysos nicht mehr, wenn man auf den Stufen des Theaters sass. Zwar gehörte
das Theater noch immer zu dem Heiligtum, aber es bildete einen besonderen
Bau neben demselben. So erwähnt denn auch Pausanias zuerst den Bezirk Ttpb?
t<ö Qeatpw, beschreibt darauf das Odeion des Perikles und geht dann erst zum
Theater selbst über (1,20,2).
Das lykurgische Theater mit seinen zahlreichen und bequemen Sitzplätzen
und mit der die Schallwellen der Stimme zusammenhaltenden Skene war für
die Volksversammlungen so sehr geeignet, dass die Athener sehr bald dazu
übergegangen sind, das Theater an Stelle der Pnyx als gewöhnlichen Platz für
die Volksversammlungen zu benutzen. In dem alten Halbrund der Pnyx wurden
vom Ende des vierten Jahrhunderts ab nur noch einzelne besondere Ver-
sammlungen abgehalten (vergl. Lolling, Topographie von Athen, S. 332 Anm. 1),
die gewöhnlichen Sitzungen fanden ev tw Osaipu statt.
Auch die Aufführungen an den Chytren (b t%\ A-^vatw äywv), welche früher
auf der Orchestra am Markt stattgefunden hatten, Avurden wegen des vorzügli-
chen Sitzraumes schon von Lykurg in das neue Theater verlegt (vergl. das
Gesetz des Lykurg in den Vit. X orat. VII, I, 10).
3. Das hellenistische Theater.
Das stattliche Theater, welches Lykurg und seine Vorgänger im IV. Jahr-
hundert geschaffen hatten, ist Jahrhunderte lang fast unverändert geblieben.
10