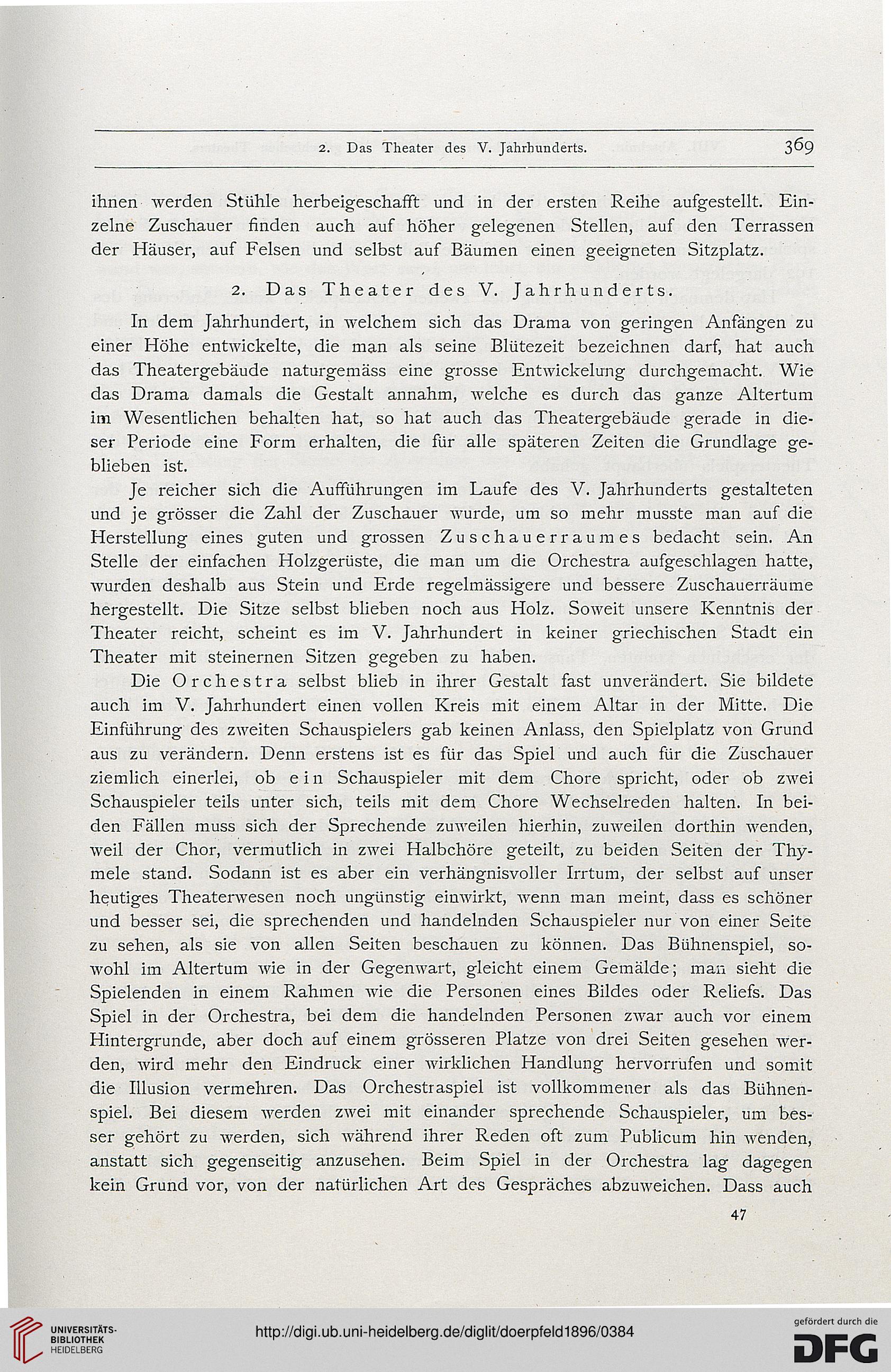2. Das Theater des V. Jahrhunderts.
369
ihnen werden Stühle herbeigeschafft und in der ersten Reihe aufgestellt. Ein-
zelne Zuschauer finden auch auf höher gelegenen Stellen, auf den Terrassen
der Häuser, auf Felsen und selbst auf Bäumen einen geeigneten Sitzplatz.
2. Das Theater des V. Jahrhunderts.
In dem Jahrhundert, in welchem sich das Drama von geringen Anfängen zu
einer Höhe entwickelte, die man als seine Blütezeit bezeichnen darf, hat auch
das Theatergebäude naturgemäss eine grosse Entwickelung durchgemacht. Wie
das Drama damals die Gestalt annahm, welche es durch das ganze Altertum
im Wesentlichen behalten hat, so hat auch das Theatergebäude gerade in die-
ser Periode eine Form erhalten, die für alle späteren Zeiten die Grundlage ge-
blieben ist.
Je reicher sich die Aufführungen im Laufe des V. Jahrhunderts gestalteten
und je grösser die Zahl der Zuschauer wurde, um so mehr musste man auf die
Herstellung eines guten und grossen Zuschauerraumes bedacht sein. An
Stelle der einfachen Holzgerüste, die man um die Orchestra aufgeschlagen hatte,
wurden deshalb aus Stein und Erde regelmässigere und bessere Zuschauerräume
hergestellt. Die Sitze selbst blieben noch aus Holz. Soweit unsere Kenntnis der
Theater reicht, scheint es im V. Jahrhundert in keiner griechischen Stadt ein
Theater mit steinernen Sitzen gegeben zu haben.
Die Orchestra selbst blieb in ihrer Gestalt fast unverändert. Sie bildete
auch im V. Jahrhundert einen vollen Kreis mit einem Altar in der Mitte. Die
Einführung des zweiten Schauspielers gab keinen Anlass, den Spielplatz von Grund
aus zu verändern. Denn erstens ist es für das Spiel und auch für die Zuschauer
ziemlich einerlei, ob ein Schauspieler mit dem Chore spricht, oder ob zwei
Schauspieler teils unter sich, teils mit dem Chore Wechselreden halten. In bei-
den Fällen muss sich der Sprechende zuweilen hierhin, zuweilen dorthin wenden,
weil der Chor, vermutlich in zwei Halbchöre geteilt, zu beiden Seiten der Thy-
mele stand. Sodann ist es aber ein verhängnisvoller Irrtum, der selbst auf unser
heutiges Theaterwesen noch ungünstig einwirkt, wenn man meint, dass es schöner
und besser sei, die sprechenden und handelnden Schauspieler nur von einer Seite
zu sehen, als sie von allen Seiten beschauen zu können. Das Bühnenspiel, so-
wohl im Altertum wie in der Gegenwart, gleicht einem Gemälde; man sieht die
Spielenden in einem Rahmen wie die Personen eines Bildes oder Reliefs. Das
Spiel in der Orchestra, bei dem die handelnden Personen zwar auch vor einem
Hintergrunde, aber doch auf einem grösseren Platze von drei Seiten gesehen wer-
den, wird mehr den Eindruck einer wirklichen Handlung hervorrufen und somit
die Illusion vermehren. Das Orchestraspiel ist vollkommener als das Bühnen-
spiel. Bei diesem werden zwei mit einander sprechende Schauspieler, um bes-
ser gehört zu werden, sich während ihrer Reden oft zum Publicum hin wenden,
anstatt sich gegenseitig anzusehen. Beim Spiel in der Orchestra lag dagegen
kein Grund vor, von der natürlichen Art des Gespräches abzuweichen. Dass auch
47
369
ihnen werden Stühle herbeigeschafft und in der ersten Reihe aufgestellt. Ein-
zelne Zuschauer finden auch auf höher gelegenen Stellen, auf den Terrassen
der Häuser, auf Felsen und selbst auf Bäumen einen geeigneten Sitzplatz.
2. Das Theater des V. Jahrhunderts.
In dem Jahrhundert, in welchem sich das Drama von geringen Anfängen zu
einer Höhe entwickelte, die man als seine Blütezeit bezeichnen darf, hat auch
das Theatergebäude naturgemäss eine grosse Entwickelung durchgemacht. Wie
das Drama damals die Gestalt annahm, welche es durch das ganze Altertum
im Wesentlichen behalten hat, so hat auch das Theatergebäude gerade in die-
ser Periode eine Form erhalten, die für alle späteren Zeiten die Grundlage ge-
blieben ist.
Je reicher sich die Aufführungen im Laufe des V. Jahrhunderts gestalteten
und je grösser die Zahl der Zuschauer wurde, um so mehr musste man auf die
Herstellung eines guten und grossen Zuschauerraumes bedacht sein. An
Stelle der einfachen Holzgerüste, die man um die Orchestra aufgeschlagen hatte,
wurden deshalb aus Stein und Erde regelmässigere und bessere Zuschauerräume
hergestellt. Die Sitze selbst blieben noch aus Holz. Soweit unsere Kenntnis der
Theater reicht, scheint es im V. Jahrhundert in keiner griechischen Stadt ein
Theater mit steinernen Sitzen gegeben zu haben.
Die Orchestra selbst blieb in ihrer Gestalt fast unverändert. Sie bildete
auch im V. Jahrhundert einen vollen Kreis mit einem Altar in der Mitte. Die
Einführung des zweiten Schauspielers gab keinen Anlass, den Spielplatz von Grund
aus zu verändern. Denn erstens ist es für das Spiel und auch für die Zuschauer
ziemlich einerlei, ob ein Schauspieler mit dem Chore spricht, oder ob zwei
Schauspieler teils unter sich, teils mit dem Chore Wechselreden halten. In bei-
den Fällen muss sich der Sprechende zuweilen hierhin, zuweilen dorthin wenden,
weil der Chor, vermutlich in zwei Halbchöre geteilt, zu beiden Seiten der Thy-
mele stand. Sodann ist es aber ein verhängnisvoller Irrtum, der selbst auf unser
heutiges Theaterwesen noch ungünstig einwirkt, wenn man meint, dass es schöner
und besser sei, die sprechenden und handelnden Schauspieler nur von einer Seite
zu sehen, als sie von allen Seiten beschauen zu können. Das Bühnenspiel, so-
wohl im Altertum wie in der Gegenwart, gleicht einem Gemälde; man sieht die
Spielenden in einem Rahmen wie die Personen eines Bildes oder Reliefs. Das
Spiel in der Orchestra, bei dem die handelnden Personen zwar auch vor einem
Hintergrunde, aber doch auf einem grösseren Platze von drei Seiten gesehen wer-
den, wird mehr den Eindruck einer wirklichen Handlung hervorrufen und somit
die Illusion vermehren. Das Orchestraspiel ist vollkommener als das Bühnen-
spiel. Bei diesem werden zwei mit einander sprechende Schauspieler, um bes-
ser gehört zu werden, sich während ihrer Reden oft zum Publicum hin wenden,
anstatt sich gegenseitig anzusehen. Beim Spiel in der Orchestra lag dagegen
kein Grund vor, von der natürlichen Art des Gespräches abzuweichen. Dass auch
47