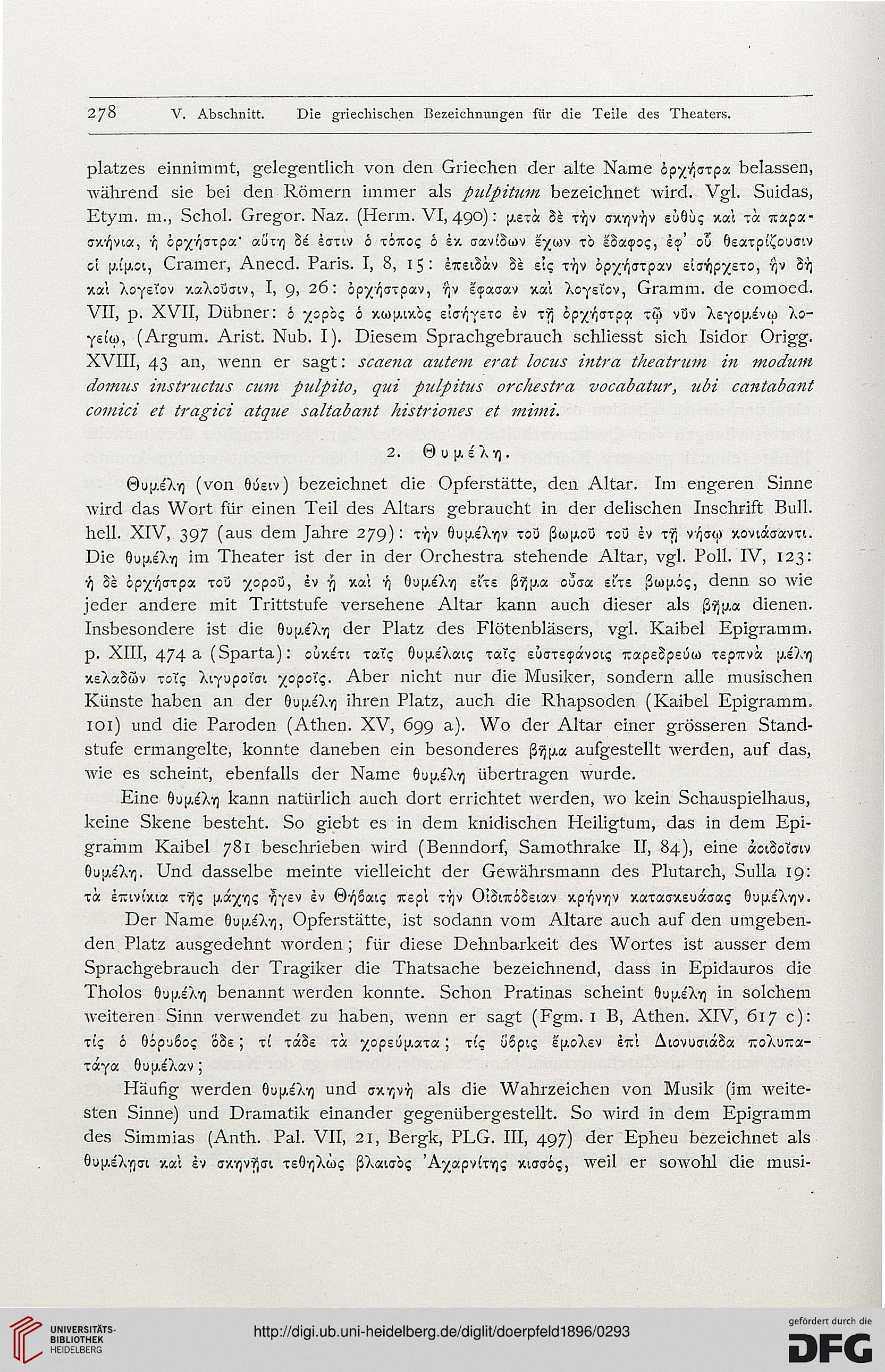V. Abschnitt. Die griechischen Bezeichnungen für die Teile des Theaters.
platzes einnimmt, gelegentlich von den Griechen der alte Name bpyr^xpa belassen,
während sie bei den Römern immer als pulpitum bezeichnet wird. Vgl. Suidas,
Etym. m., Schob Gregor. Naz. (Herrn. VI, 490): [Asxa §s tyjv ax^v/jv eüOu? v.a\ xa irapa-
a/.-rjvia, rj bpyqsxptx' aur^ §s sortv 6 tokos 6 kv. aaviSuv s^iov %b ebatfoq, £?' cu 6saTpiCcoatv
o'i [).{[>.oi, Cramer, Anecd. Paris. I, 8, 15: STtsiSäv §s sie vqv bpyr^xpxi ti^pyt-o, yjv Syj
xai Xoystov y.zXouaiv, I, 9, 26: ip^a-pav, -i^v Iffiatjav y.at XoysTov, Gramm, de comoed.
VII, p. XVII, Dübner: 6 yopbq b nwjj.ixbc eta^ysTO sv xr\ bpyr^xpa xS> vuv Xsyoiasvw
yetu, (Argum. Arist. Nub. I). Diesem Sprachgebrauch schliesst sich Isidor Origg.
XVIII, 43 an, wenn er sagt: scaena autem erat locus intra theatrum in modum
domus instruetus cum pulpito, qui pulpitus orcJiestra vocabatur, tibi cantabant
comici et tragici atque saltabant histriones et mimi.
2. 6 U JJ. SÄT].
0u(j.eXv) (von 6usiv) bezeichnet die Opferstätte, den Altar. Im engeren Sinne
wird das Wort für einen Teil des Altars gebraucht in der delischen Inschrift Bull,
hell. XIV, 397 (aus dem Jahre 279): tyjv Ouij.sXyjv xoü ß<i)|j.oÜ tou sv ty) vvjaw xoviäaavTi.
Die Ou|asXy) im Theater ist der in der Orchestra stehende Altar, vgl. Poll. IV, 123:
Ss bpyriazpx xoö yopsv, sv fj xai y) 8u|a£Xyj si'ts ßrjij.a ouaa si'xs ßwp.öi;, denn so wie
jeder andere mit Trittstufe versehene Altar kann auch dieser als ßyj|j,a dienen.
Insbesondere ist die Öü|j.sXvj der Platz des Flötenbläsers, vgl. Kaibel Epigramm,
p. XIII, 474 a (Sparta): obv.ixi xoXq Ou[j.sXact; xaXq sü<TTsa>ävoic, TcapeBpsüa) xspicvä |j.sXy)
y.sXao'uv toTs Xiyupotat x°P°'S- Aber nicht nur die Musiker, sondern alle musischen
Künste haben an der öujj.e'Xy) ihren Platz, auch die Rhapsoden (Kaibel Epigramm,
101) und die Paroden (Athen. XV, 699 a). Wo der Altar einer grösseren Stand-
stufe ermangelte, konnte daneben ein besonderes ß^p.a aufgestellt Averden, auf das,
wie es scheint, ebenfalls der Name öujasXy; übertragen wurde.
Eine 9u|j.sXy) kann natürlich auch dort errichtet werden, wo kein Schauspielhaus,
keine Skene besteht. So giebt es in dem knidischen Heiligtum, das in dem Epi-
gramm Kaibel 781 beschrieben wird (Benndorf, Samothrake II, 84), eine äoiSotJtv
8u[jiXV)i Und dasselbe meinte vielleicht der Gewährsmann des Plutarch, Sulla 19:
xa STUVtma tyjs ^*X'1? '<QYSV £v ©v)6at? nspl tv;v O!on:6osiav y.prjvrjv y.ataa'Asuaaas Ouj/.s'Xyjv.
Der Name Oup.sXr,, Opferstätte, ist sodann vom Altare auch auf den umgeben-
den Platz ausgedehnt worden ; für diese Dehnbarkeit des Wortes ist ausser dem
Sprachgebrauch der Tragiker die Thatsache bezeichnend, dass in Epidauros die
Tholos 8ü|/.£Xy) benannt werden konnte. Schon Pratinas scheint 6'jjj.sXr) in solchem
weiteren Sinn verwendet zu haben, wenn er sagt (Fgm. 1 B, Athen. XIV, 617 c):
xiq b 6opu6oc, SBs; xi xäbs xa yoptby.otxa ; xiq Ö6pt; s[/.oXev £tci Aiovumäba TtoXuxa-
xaya Ouy.sXav;
Pläufig werden 6u[j.sXr) und ax,rjV7) als die Wahrzeichen von Musik (im weite-
sten Sinne) und Dramatik einander gegenübergestellt. So wird in dem Epigramm
des Simmias (Anth. Pal. VII, 21, Bergk, PLG. III, 497) der Epheu bezeichnet als
Ou|j.sXY](n xai sv irvMjvf,«« xeOyjXws ßXawb? 'A^apvi'TYjs suaaö?, weil er sowohl die musi-
platzes einnimmt, gelegentlich von den Griechen der alte Name bpyr^xpa belassen,
während sie bei den Römern immer als pulpitum bezeichnet wird. Vgl. Suidas,
Etym. m., Schob Gregor. Naz. (Herrn. VI, 490): [Asxa §s tyjv ax^v/jv eüOu? v.a\ xa irapa-
a/.-rjvia, rj bpyqsxptx' aur^ §s sortv 6 tokos 6 kv. aaviSuv s^iov %b ebatfoq, £?' cu 6saTpiCcoatv
o'i [).{[>.oi, Cramer, Anecd. Paris. I, 8, 15: STtsiSäv §s sie vqv bpyr^xpxi ti^pyt-o, yjv Syj
xai Xoystov y.zXouaiv, I, 9, 26: ip^a-pav, -i^v Iffiatjav y.at XoysTov, Gramm, de comoed.
VII, p. XVII, Dübner: 6 yopbq b nwjj.ixbc eta^ysTO sv xr\ bpyr^xpa xS> vuv Xsyoiasvw
yetu, (Argum. Arist. Nub. I). Diesem Sprachgebrauch schliesst sich Isidor Origg.
XVIII, 43 an, wenn er sagt: scaena autem erat locus intra theatrum in modum
domus instruetus cum pulpito, qui pulpitus orcJiestra vocabatur, tibi cantabant
comici et tragici atque saltabant histriones et mimi.
2. 6 U JJ. SÄT].
0u(j.eXv) (von 6usiv) bezeichnet die Opferstätte, den Altar. Im engeren Sinne
wird das Wort für einen Teil des Altars gebraucht in der delischen Inschrift Bull,
hell. XIV, 397 (aus dem Jahre 279): tyjv Ouij.sXyjv xoü ß<i)|j.oÜ tou sv ty) vvjaw xoviäaavTi.
Die Ou|asXy) im Theater ist der in der Orchestra stehende Altar, vgl. Poll. IV, 123:
Ss bpyriazpx xoö yopsv, sv fj xai y) 8u|a£Xyj si'ts ßrjij.a ouaa si'xs ßwp.öi;, denn so wie
jeder andere mit Trittstufe versehene Altar kann auch dieser als ßyj|j,a dienen.
Insbesondere ist die Öü|j.sXvj der Platz des Flötenbläsers, vgl. Kaibel Epigramm,
p. XIII, 474 a (Sparta): obv.ixi xoXq Ou[j.sXact; xaXq sü<TTsa>ävoic, TcapeBpsüa) xspicvä |j.sXy)
y.sXao'uv toTs Xiyupotat x°P°'S- Aber nicht nur die Musiker, sondern alle musischen
Künste haben an der öujj.e'Xy) ihren Platz, auch die Rhapsoden (Kaibel Epigramm,
101) und die Paroden (Athen. XV, 699 a). Wo der Altar einer grösseren Stand-
stufe ermangelte, konnte daneben ein besonderes ß^p.a aufgestellt Averden, auf das,
wie es scheint, ebenfalls der Name öujasXy; übertragen wurde.
Eine 9u|j.sXy) kann natürlich auch dort errichtet werden, wo kein Schauspielhaus,
keine Skene besteht. So giebt es in dem knidischen Heiligtum, das in dem Epi-
gramm Kaibel 781 beschrieben wird (Benndorf, Samothrake II, 84), eine äoiSotJtv
8u[jiXV)i Und dasselbe meinte vielleicht der Gewährsmann des Plutarch, Sulla 19:
xa STUVtma tyjs ^*X'1? '<QYSV £v ©v)6at? nspl tv;v O!on:6osiav y.prjvrjv y.ataa'Asuaaas Ouj/.s'Xyjv.
Der Name Oup.sXr,, Opferstätte, ist sodann vom Altare auch auf den umgeben-
den Platz ausgedehnt worden ; für diese Dehnbarkeit des Wortes ist ausser dem
Sprachgebrauch der Tragiker die Thatsache bezeichnend, dass in Epidauros die
Tholos 8ü|/.£Xy) benannt werden konnte. Schon Pratinas scheint 6'jjj.sXr) in solchem
weiteren Sinn verwendet zu haben, wenn er sagt (Fgm. 1 B, Athen. XIV, 617 c):
xiq b 6opu6oc, SBs; xi xäbs xa yoptby.otxa ; xiq Ö6pt; s[/.oXev £tci Aiovumäba TtoXuxa-
xaya Ouy.sXav;
Pläufig werden 6u[j.sXr) und ax,rjV7) als die Wahrzeichen von Musik (im weite-
sten Sinne) und Dramatik einander gegenübergestellt. So wird in dem Epigramm
des Simmias (Anth. Pal. VII, 21, Bergk, PLG. III, 497) der Epheu bezeichnet als
Ou|j.sXY](n xai sv irvMjvf,«« xeOyjXws ßXawb? 'A^apvi'TYjs suaaö?, weil er sowohl die musi-