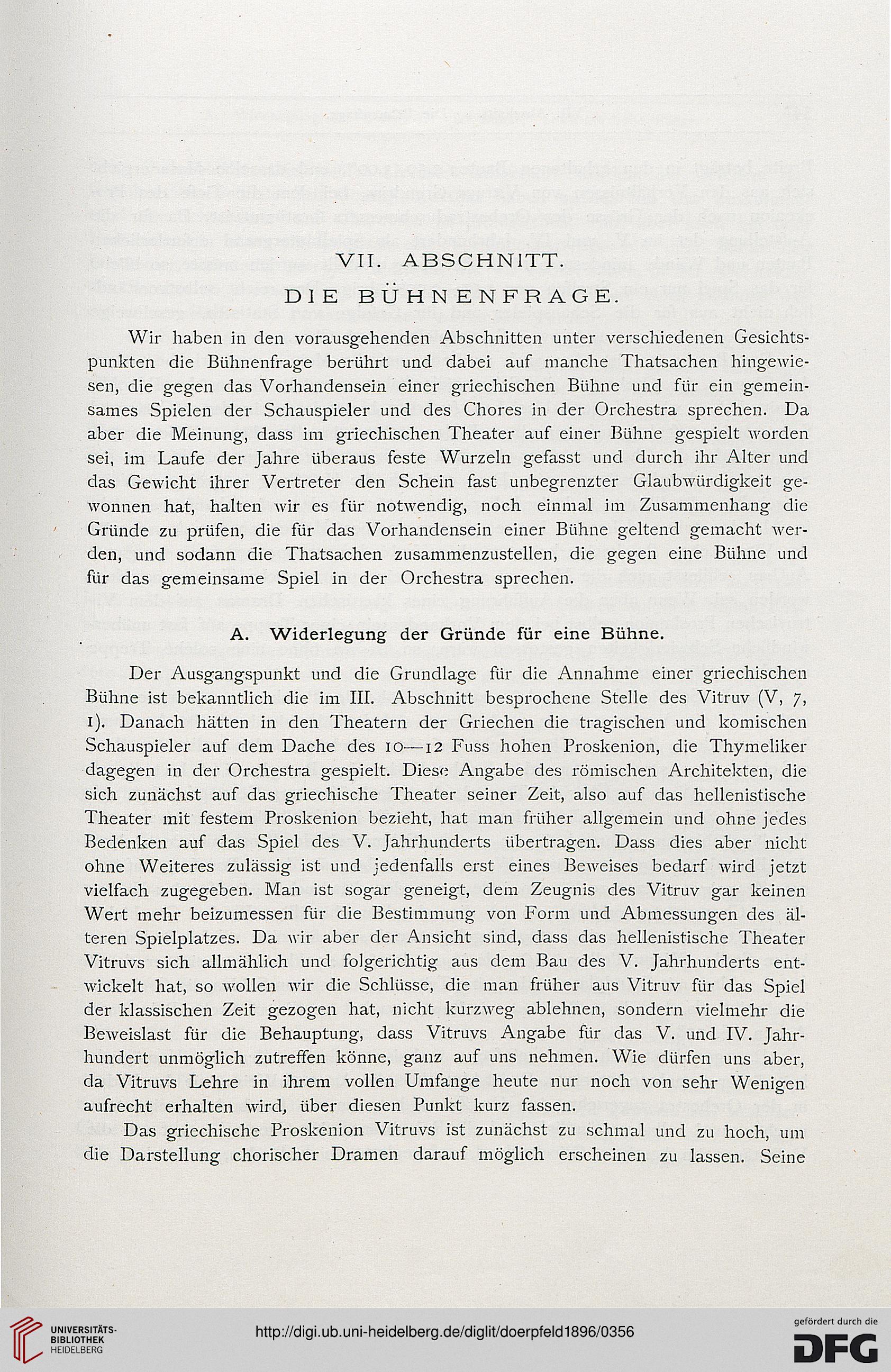VII.
ABSCHNITT.
DIE BÜHNENFRAGE.
Wir haben in den vorausgehenden Abschnitten unter verschiedenen Gesichts-
punkten die Bühnenfrage berührt und dabei auf manche Thatsachen hingewie-
sen, die gegen das Vorhandensein einer griechischen Bühne und für ein gemein-
sames Spielen der Schauspieler und des Chores in der Orchestra sprechen. Da
aber die Meinung, dass im griechischen Theater auf einer Bühne gespielt worden
sei, im Laufe der Jahre überaus feste Wurzeln gefasst und durch ihr Alter und
das Gewicht ihrer Vertreter den Schein fast unbegrenzter Glaubwürdigkeit ge-
wonnen hat, halten wir es für notwendig, noch einmal im Zusammenhang die
Gründe zu prüfen, die für das Vorhandensein einer Bühne geltend gemacht wer-
den, und sodann die Thatsachen zusammenzustellen, die gegen eine Bühne und
für das gemeinsame Spiel in der Orchestra sprechen.
A. Widerlegung der Gründe für eine Bühne.
Der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Annahme einer griechischen
Bühne ist bekanntlich die im III. Abschnitt besprochene Stelle des Vitruv (V, 7,
1). Danach hätten in den Theatern der Griechen die tragischen und komischen
Schauspieler auf dem Dache des 10—12 Fuss hohen Proskenion, die Thymeliker
dagegen in der Orchestra gespielt. Diese Angabe des römischen Architekten, die
sich zunächst auf das griechische Theater seiner Zeit, also auf das hellenistische
Theater mit festem Proskenion bezieht, hat man früher allgemein und ohne jedes
Bedenken auf das Spiel des V. Jahrhunderts übertragen. Dass dies aber nicht
ohne Weiteres zulässig ist und jedenfalls erst eines Beweises bedarf wird jetzt
vielfach zugegeben. Man ist sogar geneigt, dem Zeugnis des Vitruv gar keinen
Wert mehr beizumessen für die Bestimmung von Form und Abmessungen des äl-
teren Spielplatzes. Da wir aber der Ansicht sind, dass das hellenistische Theater
Vitruvs sich allmählich und folgerichtig aus dem Bau des V. Jahrhunderts ent-
wickelt hat, so wollen wir die Schlüsse, die man früher aus Vitruv für das Spiel
der klassischen Zeit gezogen hat, nicht kurzweg ablehnen, sondern vielmehr die
Beweislast für die Behauptung, dass Vitruvs Angabe für das V. und IV. Jahr-
hundert unmöglich zutreffen könne, ganz auf uns nehmen. Wie dürfen uns aber,
da Vitruvs Lehre in ihrem vollen Umfange heute nur noch von sehr Wenigen
aufrecht erhalten wird, über diesen Punkt kurz fassen.
Das griechische Proskenion Vitruvs ist zunächst zu schmal und zu hoch, um
die Darstellung chorischer Dramen darauf möglich erscheinen zu lassen. Seine
ABSCHNITT.
DIE BÜHNENFRAGE.
Wir haben in den vorausgehenden Abschnitten unter verschiedenen Gesichts-
punkten die Bühnenfrage berührt und dabei auf manche Thatsachen hingewie-
sen, die gegen das Vorhandensein einer griechischen Bühne und für ein gemein-
sames Spielen der Schauspieler und des Chores in der Orchestra sprechen. Da
aber die Meinung, dass im griechischen Theater auf einer Bühne gespielt worden
sei, im Laufe der Jahre überaus feste Wurzeln gefasst und durch ihr Alter und
das Gewicht ihrer Vertreter den Schein fast unbegrenzter Glaubwürdigkeit ge-
wonnen hat, halten wir es für notwendig, noch einmal im Zusammenhang die
Gründe zu prüfen, die für das Vorhandensein einer Bühne geltend gemacht wer-
den, und sodann die Thatsachen zusammenzustellen, die gegen eine Bühne und
für das gemeinsame Spiel in der Orchestra sprechen.
A. Widerlegung der Gründe für eine Bühne.
Der Ausgangspunkt und die Grundlage für die Annahme einer griechischen
Bühne ist bekanntlich die im III. Abschnitt besprochene Stelle des Vitruv (V, 7,
1). Danach hätten in den Theatern der Griechen die tragischen und komischen
Schauspieler auf dem Dache des 10—12 Fuss hohen Proskenion, die Thymeliker
dagegen in der Orchestra gespielt. Diese Angabe des römischen Architekten, die
sich zunächst auf das griechische Theater seiner Zeit, also auf das hellenistische
Theater mit festem Proskenion bezieht, hat man früher allgemein und ohne jedes
Bedenken auf das Spiel des V. Jahrhunderts übertragen. Dass dies aber nicht
ohne Weiteres zulässig ist und jedenfalls erst eines Beweises bedarf wird jetzt
vielfach zugegeben. Man ist sogar geneigt, dem Zeugnis des Vitruv gar keinen
Wert mehr beizumessen für die Bestimmung von Form und Abmessungen des äl-
teren Spielplatzes. Da wir aber der Ansicht sind, dass das hellenistische Theater
Vitruvs sich allmählich und folgerichtig aus dem Bau des V. Jahrhunderts ent-
wickelt hat, so wollen wir die Schlüsse, die man früher aus Vitruv für das Spiel
der klassischen Zeit gezogen hat, nicht kurzweg ablehnen, sondern vielmehr die
Beweislast für die Behauptung, dass Vitruvs Angabe für das V. und IV. Jahr-
hundert unmöglich zutreffen könne, ganz auf uns nehmen. Wie dürfen uns aber,
da Vitruvs Lehre in ihrem vollen Umfange heute nur noch von sehr Wenigen
aufrecht erhalten wird, über diesen Punkt kurz fassen.
Das griechische Proskenion Vitruvs ist zunächst zu schmal und zu hoch, um
die Darstellung chorischer Dramen darauf möglich erscheinen zu lassen. Seine