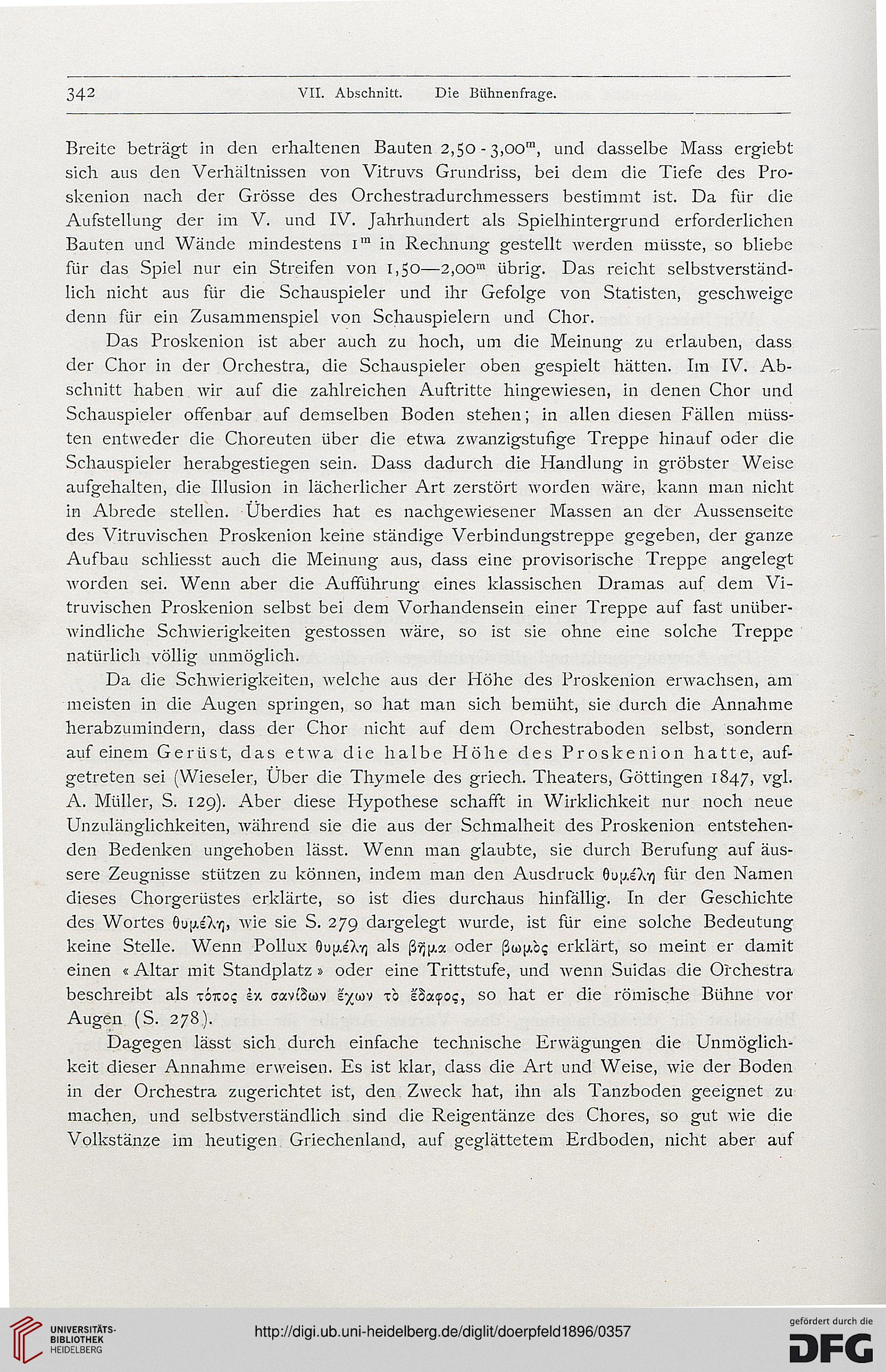342
VII. Abschnitt. Die Bühnenfrage.
Breite beträgt in den erhaltenen Bauten 2,50 - 3,00™, und dasselbe Mass ergiebt
sich aus den Verhältnissen von Vitruvs Grundriss, bei dem die Tiefe des Pro-
skenion nach der Grösse des Orchestradurchmessers bestimmt ist. Da für die
Aufstellung der im V. und IV. Jahrhundert als Spielhintergrund erforderlichen
Bauten und Wände mindestens im in Rechnung gestellt werden müsste, so bliebe
für das Spiel nur ein Streifen von 1,50—2,oom übrig. Das reicht selbstverständ-
lich nicht aus für die Schauspieler und ihr Gefolge von Statisten, geschweige
denn für ein Zusammenspiel von Schauspielern und Chor.
Das Proskenion ist aber auch zu hoch, um die Meinung zu erlauben, dass
der Chor in der Orchestra, die Schauspieler oben gespielt hätten. Im IV. Ab-
schnitt haben wir auf die zahlreichen Auftritte hingewiesen, in denen Chor und
Schauspieler offenbar auf demselben Boden stehen; in allen diesen Fällen müss-
ten entweder die Choreuten über die etwa zwanzigstufige Treppe hinauf oder die
Schauspieler herabgestiegen sein. Dass dadurch die Handlung in gröbster Weise
aufgehalten, die Illusion in lächerlicher Art zerstört worden wäre, kann man nicht
in Abrede stellen. Überdies hat es nachgewiesener Massen an der Aussenseite
des Vitruvischen Proskenion keine ständige Verbindungstreppe gegeben, der ganze
Aufbau schliesst auch die Meinung aus, dass eine provisorische Treppe angelegt
worden sei. Wenn aber die Aufführung eines klassischen Dramas auf dem Vi-
truvischen Proskenion selbst bei dem Vorhandensein einer Treppe auf fast unüber-
windliche Schwierigkeiten gestossen wäre, so ist sie ohne eine solche Treppe
natürlich völlig unmöglich.
Da die Schwierigkeiten, welche aus der Höhe des Proskenion erwachsen, am
meisten in die Augen springen, so hat man sich bemüht, sie durch die Annahme
herabzumindern, dass der Chor nicht auf dem Orchestraboden selbst, sondern
auf einem Gerüst, das etwa die halbe Höhe des Proskenion hatte, auf-
getreten sei (Wieseler, Über die Thymele des griech. Theaters, Göttingen 1847, vgl.
A. Müller, S. 129). Aber diese Hypothese schafft in Wirklichkeit nur noch neue
Unzulänglichkeiten, Avährend sie die aus der Schmalheit des Proskenion entstehen-
den Bedenken ungehoben lässt. Wenn man glaubte, sie durch Berufung auf äus-
sere Zeugnisse stützen zu können, indem man den Ausdruck ©ujaeXy] für den Namen
dieses Chorgerüstes erklärte, so ist dies durchaus hinfällig. In der Geschichte
des Wortes 0u|/iXv), wie sie S. 279 dargelegt wurde, ist für eine solche Bedeutung
keine Stelle. Wenn Pollux 8u[AeXvj als ßyjjj.a oder ßwjjws erklärt, so meint er damit
einen «Altar mit Standplatz » oder eine Trittstufe, und wenn Suidas die Orchestra
beschreibt als tÖtco? iv. cavi'Swv e-/wv tb eSwpo?, so hat er die römische Bühne vor
Augen (S. 278.).
Dagegen lässt sich durch einfache technische Erwägungen die Unmöglich-
keit dieser Annahme erweisen. Es ist klar, dass die Art und Weise, wie der Boden
in der Orchestra zugerichtet ist, den Zweck hat, ihn als Tanzboden geeignet zu
machen, und selbstverständlich sind die Reigentänze des Chores, so gut wie die
Volkstänze im heutigen Griechenland, auf geglättetem Erdboden, nicht aber auf
VII. Abschnitt. Die Bühnenfrage.
Breite beträgt in den erhaltenen Bauten 2,50 - 3,00™, und dasselbe Mass ergiebt
sich aus den Verhältnissen von Vitruvs Grundriss, bei dem die Tiefe des Pro-
skenion nach der Grösse des Orchestradurchmessers bestimmt ist. Da für die
Aufstellung der im V. und IV. Jahrhundert als Spielhintergrund erforderlichen
Bauten und Wände mindestens im in Rechnung gestellt werden müsste, so bliebe
für das Spiel nur ein Streifen von 1,50—2,oom übrig. Das reicht selbstverständ-
lich nicht aus für die Schauspieler und ihr Gefolge von Statisten, geschweige
denn für ein Zusammenspiel von Schauspielern und Chor.
Das Proskenion ist aber auch zu hoch, um die Meinung zu erlauben, dass
der Chor in der Orchestra, die Schauspieler oben gespielt hätten. Im IV. Ab-
schnitt haben wir auf die zahlreichen Auftritte hingewiesen, in denen Chor und
Schauspieler offenbar auf demselben Boden stehen; in allen diesen Fällen müss-
ten entweder die Choreuten über die etwa zwanzigstufige Treppe hinauf oder die
Schauspieler herabgestiegen sein. Dass dadurch die Handlung in gröbster Weise
aufgehalten, die Illusion in lächerlicher Art zerstört worden wäre, kann man nicht
in Abrede stellen. Überdies hat es nachgewiesener Massen an der Aussenseite
des Vitruvischen Proskenion keine ständige Verbindungstreppe gegeben, der ganze
Aufbau schliesst auch die Meinung aus, dass eine provisorische Treppe angelegt
worden sei. Wenn aber die Aufführung eines klassischen Dramas auf dem Vi-
truvischen Proskenion selbst bei dem Vorhandensein einer Treppe auf fast unüber-
windliche Schwierigkeiten gestossen wäre, so ist sie ohne eine solche Treppe
natürlich völlig unmöglich.
Da die Schwierigkeiten, welche aus der Höhe des Proskenion erwachsen, am
meisten in die Augen springen, so hat man sich bemüht, sie durch die Annahme
herabzumindern, dass der Chor nicht auf dem Orchestraboden selbst, sondern
auf einem Gerüst, das etwa die halbe Höhe des Proskenion hatte, auf-
getreten sei (Wieseler, Über die Thymele des griech. Theaters, Göttingen 1847, vgl.
A. Müller, S. 129). Aber diese Hypothese schafft in Wirklichkeit nur noch neue
Unzulänglichkeiten, Avährend sie die aus der Schmalheit des Proskenion entstehen-
den Bedenken ungehoben lässt. Wenn man glaubte, sie durch Berufung auf äus-
sere Zeugnisse stützen zu können, indem man den Ausdruck ©ujaeXy] für den Namen
dieses Chorgerüstes erklärte, so ist dies durchaus hinfällig. In der Geschichte
des Wortes 0u|/iXv), wie sie S. 279 dargelegt wurde, ist für eine solche Bedeutung
keine Stelle. Wenn Pollux 8u[AeXvj als ßyjjj.a oder ßwjjws erklärt, so meint er damit
einen «Altar mit Standplatz » oder eine Trittstufe, und wenn Suidas die Orchestra
beschreibt als tÖtco? iv. cavi'Swv e-/wv tb eSwpo?, so hat er die römische Bühne vor
Augen (S. 278.).
Dagegen lässt sich durch einfache technische Erwägungen die Unmöglich-
keit dieser Annahme erweisen. Es ist klar, dass die Art und Weise, wie der Boden
in der Orchestra zugerichtet ist, den Zweck hat, ihn als Tanzboden geeignet zu
machen, und selbstverständlich sind die Reigentänze des Chores, so gut wie die
Volkstänze im heutigen Griechenland, auf geglättetem Erdboden, nicht aber auf