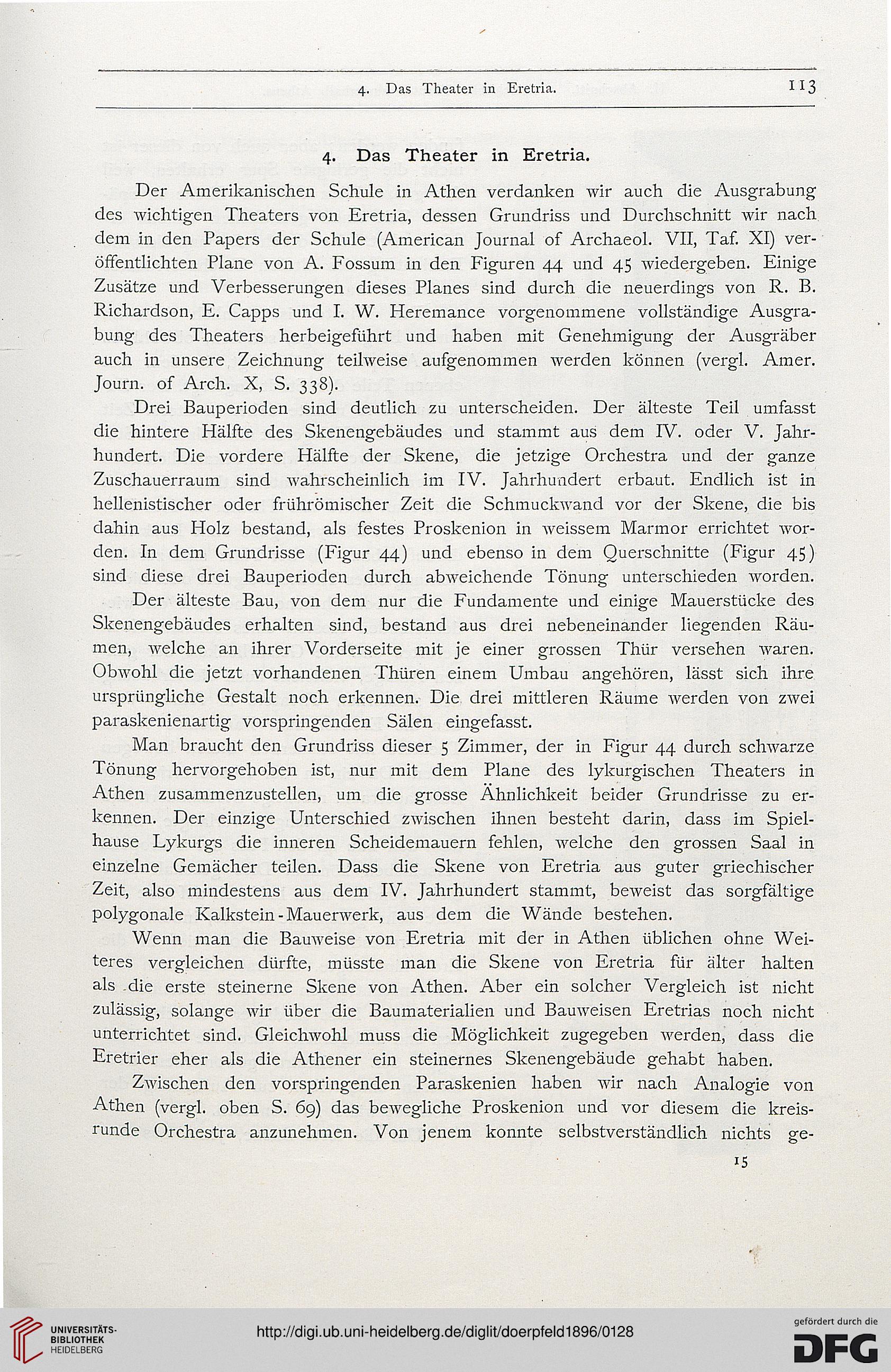4. Das Theater in Eretria.
113
4. Das Theater in Eretria.
Der Amerikanischen Schule in Athen verdanken wir auch die Ausgrabung
des wichtigen Theaters von Eretria, dessen Grundriss und Durchschnitt wir nach
dem in den Papers der Schule (American Journal of Archaeol. VII, Taf. XI) ver-
öffentlichten Plane von A. Fossum in den Figuren 44 und 45 wiedergeben. Einige
Zusätze und Verbesserungen dieses Planes sind durch die neuerdings von R. B.
Richardson, E. Capps und I. W. Heremance vorgenommene vollständige Ausgra-
bung des Theaters herbeigeführt und haben mit Genehmigung der Ausgräber
auch in unsere Zeichnung teilweise aufgenommen werden können (vergl. Amer.
Journ. of Arch. X, S. 338).
Drei Bauperioden sind deutlich zu unterscheiden. Der älteste Teil umfasst
die hintere Hälfte des Skenengebäudes und stammt aus dem IV. oder V. Jahr-
hundert. Die vordere Hälfte der Skene, die jetzige Orchestra und der ganze
Zuschauerraum sind wahrscheinlich im IV. Jahrhundert erbaut. Endlich ist in
hellenistischer oder frührömischer Zeit die Schmuckwand vor der Skene, die bis
dahin aus Holz bestand, als festes Proskenion in weissem Marmor errichtet wor-
den. In dem Grundrisse (Figur 44) und ebenso in dem Querschnitte (Figur 45)
sind diese drei Bauperioden durch abweichende Tönung unterschieden worden.
Der älteste Bau, von dem nur die Fundamente und einige Mauerstücke des
Skenengebäudes erhalten sind, bestand aus drei nebeneinander liegenden Räu-
men, welche an ihrer Vorderseite mit je einer grossen Thür versehen waren.
Obwohl die jetzt vorhandenen Thüren einem Umbau angehören, lässt sich ihre
ursprüngliche Gestalt noch erkennen. Die drei mittleren Räume werden von zwei
paraskenienartig vorspringenden Sälen eingefasst.
Man braucht den Grundriss dieser 5 Zimmer, der in Figur 44 durch schwarze
Tönung hervorgehoben ist, nur mit dem Plane des lykurgischen Theaters in
Athen zusammenzustellen, um die grosse Ähnlichkeit beider Grundrisse zu er-
kennen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass im Spiel-
hause Lykurgs die inneren Scheidemauern fehlen, welche den grossen Saal in
einzelne Gemächer teilen. Dass die Skene von Eretria aus guter griechischer
Zeit, also mindestens aus dem IV. Jahrhundert stammt, beweist das sorgfältige
polygonale Kalkstein - Mauerwerk, aus dem die Wände bestehen.
Wenn man die Bauweise von Eretria mit der in Athen üblichen ohne Wei-
teres vergleichen dürfte, müsste man die Skene von Eretria für älter halten
als die erste steinerne Skene von Athen. Aber ein solcher Vergleich ist nicht
zulässig, solange wir über die Baumaterialien und Bauweisen Eretrias noch nicht
unterrichtet sind. Gleichwohl muss die Möglichkeit zugegeben werden, dass die
Eretrier eher als die Athener ein steinernes Skenengebäude gehabt haben.
Zwischen den vorspringenden Paraskenien haben wir nach Analogie von
Athen (vergl. oben S. 69) das bewegliche Proskenion und vor diesem die kreis-
runde Orchestra anzunehmen. Von jenem konnte selbstverständlich nichts ge-
15
113
4. Das Theater in Eretria.
Der Amerikanischen Schule in Athen verdanken wir auch die Ausgrabung
des wichtigen Theaters von Eretria, dessen Grundriss und Durchschnitt wir nach
dem in den Papers der Schule (American Journal of Archaeol. VII, Taf. XI) ver-
öffentlichten Plane von A. Fossum in den Figuren 44 und 45 wiedergeben. Einige
Zusätze und Verbesserungen dieses Planes sind durch die neuerdings von R. B.
Richardson, E. Capps und I. W. Heremance vorgenommene vollständige Ausgra-
bung des Theaters herbeigeführt und haben mit Genehmigung der Ausgräber
auch in unsere Zeichnung teilweise aufgenommen werden können (vergl. Amer.
Journ. of Arch. X, S. 338).
Drei Bauperioden sind deutlich zu unterscheiden. Der älteste Teil umfasst
die hintere Hälfte des Skenengebäudes und stammt aus dem IV. oder V. Jahr-
hundert. Die vordere Hälfte der Skene, die jetzige Orchestra und der ganze
Zuschauerraum sind wahrscheinlich im IV. Jahrhundert erbaut. Endlich ist in
hellenistischer oder frührömischer Zeit die Schmuckwand vor der Skene, die bis
dahin aus Holz bestand, als festes Proskenion in weissem Marmor errichtet wor-
den. In dem Grundrisse (Figur 44) und ebenso in dem Querschnitte (Figur 45)
sind diese drei Bauperioden durch abweichende Tönung unterschieden worden.
Der älteste Bau, von dem nur die Fundamente und einige Mauerstücke des
Skenengebäudes erhalten sind, bestand aus drei nebeneinander liegenden Räu-
men, welche an ihrer Vorderseite mit je einer grossen Thür versehen waren.
Obwohl die jetzt vorhandenen Thüren einem Umbau angehören, lässt sich ihre
ursprüngliche Gestalt noch erkennen. Die drei mittleren Räume werden von zwei
paraskenienartig vorspringenden Sälen eingefasst.
Man braucht den Grundriss dieser 5 Zimmer, der in Figur 44 durch schwarze
Tönung hervorgehoben ist, nur mit dem Plane des lykurgischen Theaters in
Athen zusammenzustellen, um die grosse Ähnlichkeit beider Grundrisse zu er-
kennen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen besteht darin, dass im Spiel-
hause Lykurgs die inneren Scheidemauern fehlen, welche den grossen Saal in
einzelne Gemächer teilen. Dass die Skene von Eretria aus guter griechischer
Zeit, also mindestens aus dem IV. Jahrhundert stammt, beweist das sorgfältige
polygonale Kalkstein - Mauerwerk, aus dem die Wände bestehen.
Wenn man die Bauweise von Eretria mit der in Athen üblichen ohne Wei-
teres vergleichen dürfte, müsste man die Skene von Eretria für älter halten
als die erste steinerne Skene von Athen. Aber ein solcher Vergleich ist nicht
zulässig, solange wir über die Baumaterialien und Bauweisen Eretrias noch nicht
unterrichtet sind. Gleichwohl muss die Möglichkeit zugegeben werden, dass die
Eretrier eher als die Athener ein steinernes Skenengebäude gehabt haben.
Zwischen den vorspringenden Paraskenien haben wir nach Analogie von
Athen (vergl. oben S. 69) das bewegliche Proskenion und vor diesem die kreis-
runde Orchestra anzunehmen. Von jenem konnte selbstverständlich nichts ge-
15