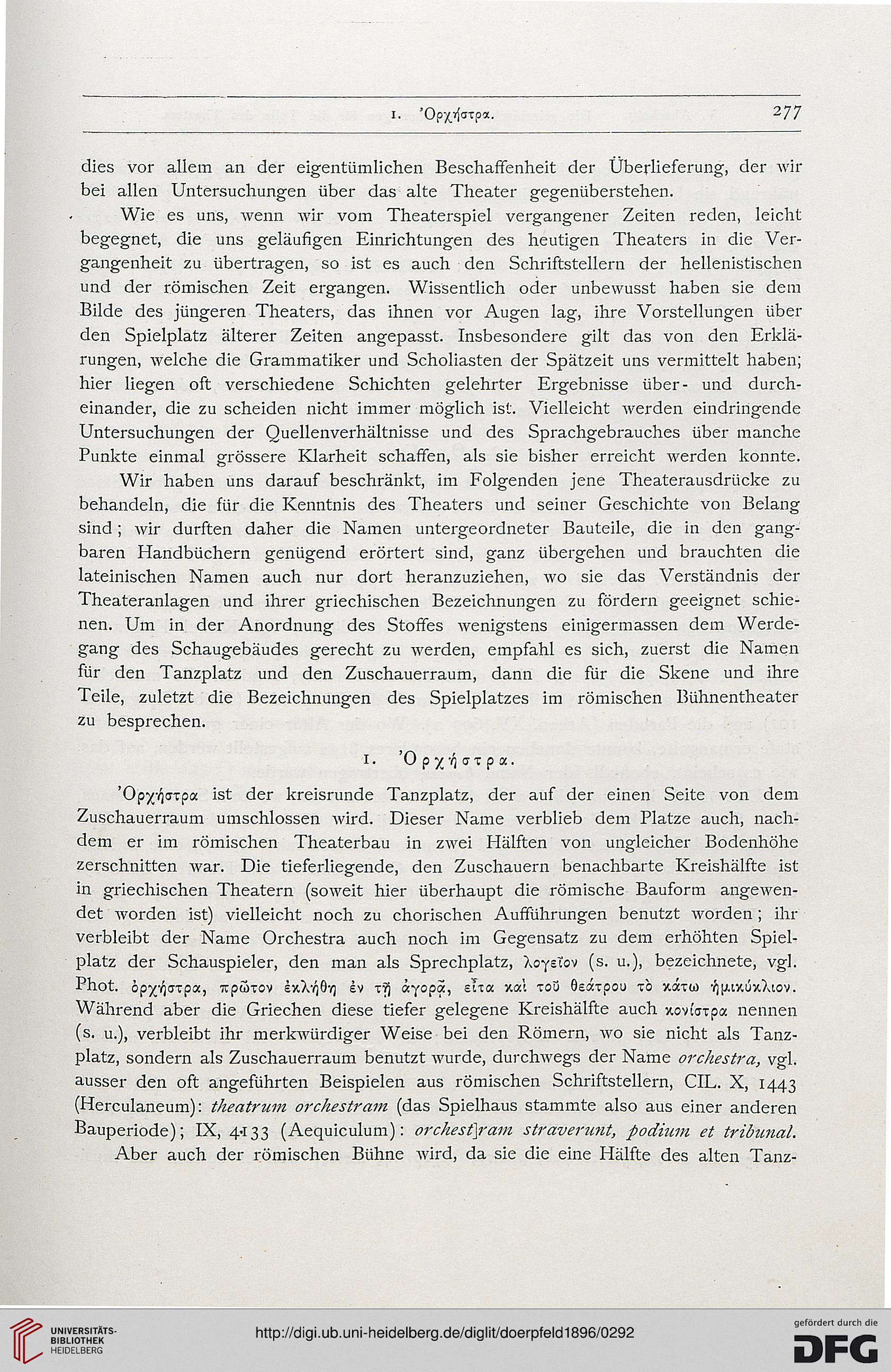'Op'//[aTpa.
dies vor allem an der eigentümlichen Beschaffenheit der Überlieferung, der wir
bei allen Untersuchungen über das alte Theater gegenüberstehen.
Wie es uns, wenn wir vom Theaterspiel vergangener Zeiten reden, leicht
begegnet, die uns geläufigen Einrichtungen des heutigen Theaters in die Ver-
gangenheit zu übertragen, so ist es auch den Schriftstellern der hellenistischen
und der römischen Zeit ergangen. Wissentlich oder unbewusst haben sie dem
Bilde des jüngeren Theaters, das ihnen vor Augen lag, ihre Vorstellungen über
den Spielplatz älterer Zeiten angepasst. Insbesondere gilt das von den Erklä-
rungen, welche die Grammatiker und Scholiasten der Spätzeit uns vermittelt haben;
hier liegen oft verschiedene Schichten gelehrter Ergebnisse über- und durch-
einander, die zu scheiden nicht immer möglich ist. Vielleicht werden eindringende
Untersuchungen der Quellenverhältnisse und des Sprachgebrauches über manche
Punkte einmal grössere Klarheit schaffen, als sie bisher erreicht werden konnte.
Wir haben uns darauf beschränkt, im Folgenden jene Theaterausdrücke zu
behandeln, die für die Kenntnis des Theaters und seiner Geschichte von Belang
sind; wir durften daher die Namen untergeordneter Bauteile, die in den gang-
baren Handbüchern genügend erörtert sind, ganz übergehen und brauchten die
lateinischen Namen auch nur dort heranzuziehen, wo sie das Verständnis der
Theateranlagen und ihrer griechischen Bezeichnungen zu fördern geeignet schie-
nen. Um in der Anordnung des Stoffes wenigstens einigermassen dem Werde-
gang des Schaugebäudes gerecht zu werden, empfahl es sich, zuerst die Namen
für den Tanzplatz und den Zuschauerraum, dann die für die Skene und ihre
Teile, zuletzt die Bezeichnungen des Spielplatzes im römischen Bühnentheater
zu besprechen.
i. '0 p */■(] st p a.
'O'p^Ttp« ist der kreisrunde Tanzplatz, der auf der einen Seite von dem
Zuschauerraum umschlossen wird. Dieser Name verblieb dem Platze auch, nach-
dem er im römischen Theaterbau in zwei Hälften von ungleicher Bodenhöhe
zerschnitten war. Die tieferliegende, den Zuschauern benachbarte Kreishälfte ist
in griechischen Theatern (soweit hier überhaupt die römische Bauform angewen-
det worden ist) vielleicht noch zu chorischen Aufführungen benutzt worden; ihr
verbleibt der Name Orchestra auch noch im Gegensatz zu dem erhöhten Spiel-
platz der Schauspieler, den man als Sprechplatz, XoysTov (s. u.), bezeichnete, vgl.
Phot. öp^axps, xpw-ov ey.X^Ov) sv äyopa, eha xai toü öeaxpou tb xaxa) v)|juKtJx,Xiov.
Während aber die Griechen diese tiefer gelegene Kreishälfte auch /.oviatpa nennen
(s. u.), verbleibt ihr merkwürdiger Weise bei den Römern, wo sie nicht als Tanz-
platz, sondern als Zuschauerraum benutzt wurde, durchwegs der Name orchestra, vgl.
ausser den oft angeführten Beispielen aus römischen Schriftstellern, CIL. X, 1443
(Herculaneum): theatrum orchestram (das Spielhaus stammte also aus einer anderen
Bauperiode); IX, 4-133 (Aequiculum): orchest\ram straverimt, podium et tribunal.
Aber auch der römischen Bühne wird, da sie die eine Hälfte des alten Tanz-
dies vor allem an der eigentümlichen Beschaffenheit der Überlieferung, der wir
bei allen Untersuchungen über das alte Theater gegenüberstehen.
Wie es uns, wenn wir vom Theaterspiel vergangener Zeiten reden, leicht
begegnet, die uns geläufigen Einrichtungen des heutigen Theaters in die Ver-
gangenheit zu übertragen, so ist es auch den Schriftstellern der hellenistischen
und der römischen Zeit ergangen. Wissentlich oder unbewusst haben sie dem
Bilde des jüngeren Theaters, das ihnen vor Augen lag, ihre Vorstellungen über
den Spielplatz älterer Zeiten angepasst. Insbesondere gilt das von den Erklä-
rungen, welche die Grammatiker und Scholiasten der Spätzeit uns vermittelt haben;
hier liegen oft verschiedene Schichten gelehrter Ergebnisse über- und durch-
einander, die zu scheiden nicht immer möglich ist. Vielleicht werden eindringende
Untersuchungen der Quellenverhältnisse und des Sprachgebrauches über manche
Punkte einmal grössere Klarheit schaffen, als sie bisher erreicht werden konnte.
Wir haben uns darauf beschränkt, im Folgenden jene Theaterausdrücke zu
behandeln, die für die Kenntnis des Theaters und seiner Geschichte von Belang
sind; wir durften daher die Namen untergeordneter Bauteile, die in den gang-
baren Handbüchern genügend erörtert sind, ganz übergehen und brauchten die
lateinischen Namen auch nur dort heranzuziehen, wo sie das Verständnis der
Theateranlagen und ihrer griechischen Bezeichnungen zu fördern geeignet schie-
nen. Um in der Anordnung des Stoffes wenigstens einigermassen dem Werde-
gang des Schaugebäudes gerecht zu werden, empfahl es sich, zuerst die Namen
für den Tanzplatz und den Zuschauerraum, dann die für die Skene und ihre
Teile, zuletzt die Bezeichnungen des Spielplatzes im römischen Bühnentheater
zu besprechen.
i. '0 p */■(] st p a.
'O'p^Ttp« ist der kreisrunde Tanzplatz, der auf der einen Seite von dem
Zuschauerraum umschlossen wird. Dieser Name verblieb dem Platze auch, nach-
dem er im römischen Theaterbau in zwei Hälften von ungleicher Bodenhöhe
zerschnitten war. Die tieferliegende, den Zuschauern benachbarte Kreishälfte ist
in griechischen Theatern (soweit hier überhaupt die römische Bauform angewen-
det worden ist) vielleicht noch zu chorischen Aufführungen benutzt worden; ihr
verbleibt der Name Orchestra auch noch im Gegensatz zu dem erhöhten Spiel-
platz der Schauspieler, den man als Sprechplatz, XoysTov (s. u.), bezeichnete, vgl.
Phot. öp^axps, xpw-ov ey.X^Ov) sv äyopa, eha xai toü öeaxpou tb xaxa) v)|juKtJx,Xiov.
Während aber die Griechen diese tiefer gelegene Kreishälfte auch /.oviatpa nennen
(s. u.), verbleibt ihr merkwürdiger Weise bei den Römern, wo sie nicht als Tanz-
platz, sondern als Zuschauerraum benutzt wurde, durchwegs der Name orchestra, vgl.
ausser den oft angeführten Beispielen aus römischen Schriftstellern, CIL. X, 1443
(Herculaneum): theatrum orchestram (das Spielhaus stammte also aus einer anderen
Bauperiode); IX, 4-133 (Aequiculum): orchest\ram straverimt, podium et tribunal.
Aber auch der römischen Bühne wird, da sie die eine Hälfte des alten Tanz-