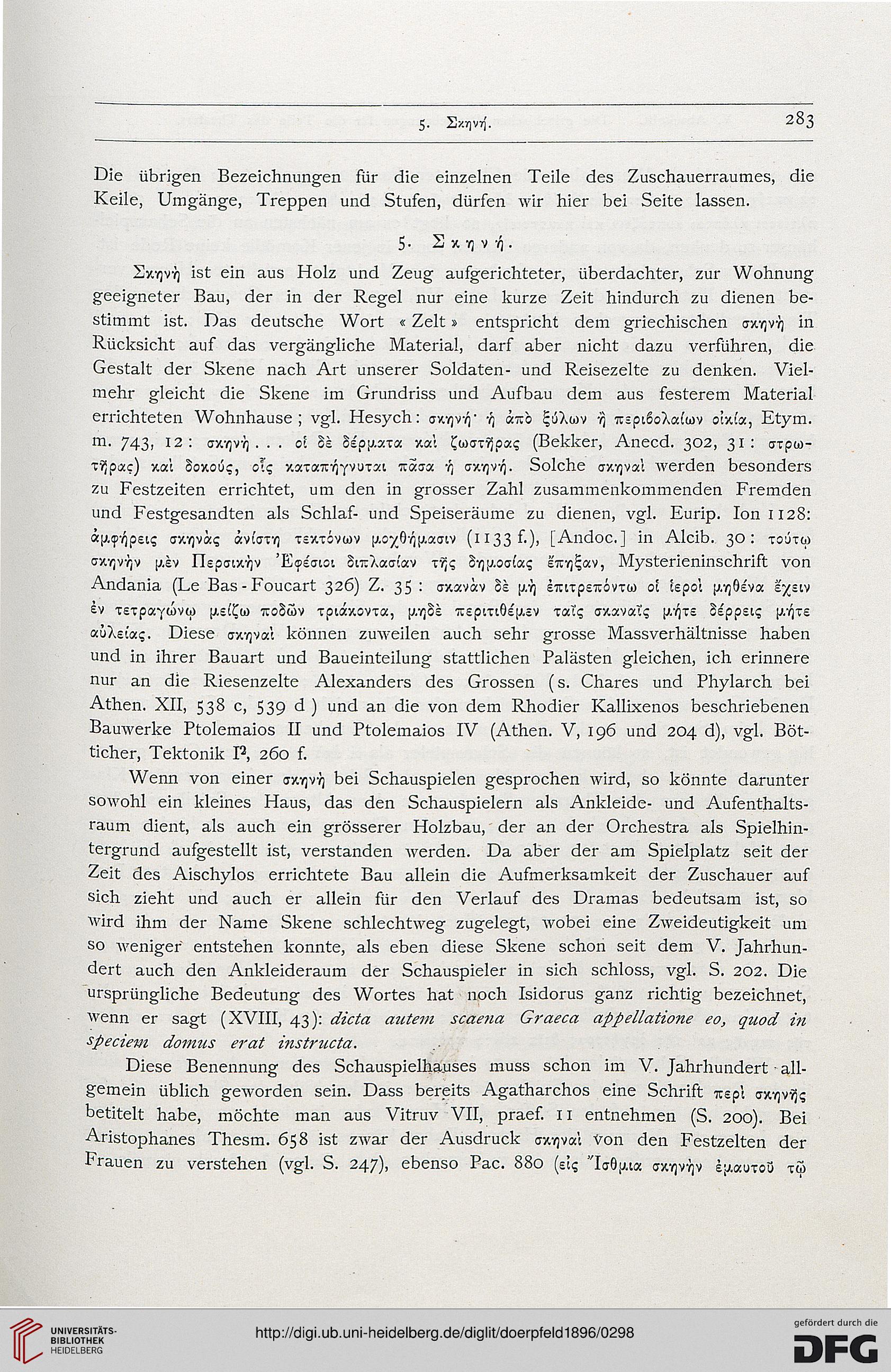5. Exj]V7j.
283
Die übrigen Bezeichnungen für die einzelnen Teile des Zuschauerraumes, die
Keile, Umgänge, Treppen und Stufen, dürfen wir hier bei Seite lassen.
5- 2 v. -q v -r\.
Sxy)Vyj ist ein aus Holz und Zeug aufgerichteter, überdachter, zur Wohnung
geeigneter Bau, der in der Regel nur eine kurze Zeit hindurch zu dienen be-
stimmt ist. Das deutsche Wort « Zelt» entspricht dem griechischen raijvi] in
Rücksicht auf das vergängliche Material, darf aber nicht dazu verführen, die
Gestalt der Skene nach Art unserer Soldaten- und Reisezelte zu denken. Viel-
mehr gleicht die Skene im Grundriss und Aufbau dem aus festerem Material
errichteten Wohnhause; vgl. Hesych: rcij'v^' vj ä-b £i}Xü)v yj itspiSoXafwv olxhx, Etym.
m. 743, 12: axvj vi]. . . ei 5= Mpy.y.xa. ■/.»: ^wcTiJpas (Bekker, Anecd. 302, 31: arpu-
T?jpae) y.ai Soxoik, ot? ■/.z-oi7;rlyvutM rcaaa y) axvjv^. Solche axvjval werden besonders
zu Festzeiten errichtet, um den in grosser Zahl zusammenkommenden Fremden
und Festgesandten als Schlaf- und Speiseräume zu dienen, vgl. Eurip. Ion ii28:
äpfqpeis ay.Yjväg ävurcv) T6*t6v»v |j.sy_Or(lu.aaiv (1133 f.), [Andoc] in Alcib. 30: toutg)
«iyjvyjv |j.ev ITepffwfjv 'Eoeatot SircXaai'av tyjs sy)[w<r(as eirrj^av, Mysterieninschrift von
Andania (Le Bas-Foucart 326) Z. 35 : «tavav äs jj.y) eTtiTpsTtovxw oi Espol jj.yjOeva ejjstv
£v Texpaytivw jj.sf£u> ttoSwv rpiaxovTa, p.^os rcepiTiöe'jji.ev xat? raävatg [/.t^ts Seppstg [a-^xe
«uXst'as. Diese uxvjvat können zuweilen auch sehr grosse Massverhältnisse haben
und in ihrer Bauart und Baueinteilung stattlichen Palästen gleichen, ich erinnere
nur an die Riesenzelte Alexanders des Grossen (s. Chares und Phylarch bei
Athen. XII, 538 c, 539 d ) und an die von dem Rhodier Kallixenos beschriebenen
Bauwerke Ptolemaios II und Ptolemaios IV (Athen. V, 196 und 204 d), vgl. Böt-
ticher, Tektonik P, 260 f.
Wenn von einer ay.Yjvv) bei Schauspielen gesprochen wird, so könnte darunter
sowohl ein kleines Haus, das den Schauspielern als Ankleide- und Aufenthalts-
raum dient, als auch ein grösserer Holzbau, der an der Orchestra als Spielhin-
tergrund aufgestellt ist, verstanden werden. Da aber der am Spielplatz seit der
Zeit des Aischylos errichtete Bau allein die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf
sich zieht und auch er allein für den Verlauf des Dramas bedeutsam ist, so
wird ihm der Name Skene schlechtweg zugelegt, wobei eine Zweideutigkeit um
so weniger entstehen konnte, als eben diese Skene schon seit dem V. Jahrhun-
dert auch den Ankleideraum der Schauspieler in sich schloss, vgl. S. 202. Die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes hat noch Isidorus ganz richtig bezeichnet,
wenn er sagt (XVIII, 43): dicta autem scae?ia Graeca appellatione eo, quod in
speciem domus erat instructa.
Diese Benennung des Schauspielhauses muss schon im V. Jahrhundert all-
gemein üblich geworden sein. Dass bereits Agatharchos eine Schrift uspl ay.^vvj?
betitelt habe, möchte man aus Vitruv VII, praef. 11 entnehmen (S. 200). Bei
Aristophanes Thesm. 658 ist zwar der Ausdruck m-^a\ von den Festzelten der
Frauen zu verstehen (vgl. S. 247), ebenso Pac. 880 (et? "I<j8(ua sxY)vi)v i;j.tzuToü -«
283
Die übrigen Bezeichnungen für die einzelnen Teile des Zuschauerraumes, die
Keile, Umgänge, Treppen und Stufen, dürfen wir hier bei Seite lassen.
5- 2 v. -q v -r\.
Sxy)Vyj ist ein aus Holz und Zeug aufgerichteter, überdachter, zur Wohnung
geeigneter Bau, der in der Regel nur eine kurze Zeit hindurch zu dienen be-
stimmt ist. Das deutsche Wort « Zelt» entspricht dem griechischen raijvi] in
Rücksicht auf das vergängliche Material, darf aber nicht dazu verführen, die
Gestalt der Skene nach Art unserer Soldaten- und Reisezelte zu denken. Viel-
mehr gleicht die Skene im Grundriss und Aufbau dem aus festerem Material
errichteten Wohnhause; vgl. Hesych: rcij'v^' vj ä-b £i}Xü)v yj itspiSoXafwv olxhx, Etym.
m. 743, 12: axvj vi]. . . ei 5= Mpy.y.xa. ■/.»: ^wcTiJpas (Bekker, Anecd. 302, 31: arpu-
T?jpae) y.ai Soxoik, ot? ■/.z-oi7;rlyvutM rcaaa y) axvjv^. Solche axvjval werden besonders
zu Festzeiten errichtet, um den in grosser Zahl zusammenkommenden Fremden
und Festgesandten als Schlaf- und Speiseräume zu dienen, vgl. Eurip. Ion ii28:
äpfqpeis ay.Yjväg ävurcv) T6*t6v»v |j.sy_Or(lu.aaiv (1133 f.), [Andoc] in Alcib. 30: toutg)
«iyjvyjv |j.ev ITepffwfjv 'Eoeatot SircXaai'av tyjs sy)[w<r(as eirrj^av, Mysterieninschrift von
Andania (Le Bas-Foucart 326) Z. 35 : «tavav äs jj.y) eTtiTpsTtovxw oi Espol jj.yjOeva ejjstv
£v Texpaytivw jj.sf£u> ttoSwv rpiaxovTa, p.^os rcepiTiöe'jji.ev xat? raävatg [/.t^ts Seppstg [a-^xe
«uXst'as. Diese uxvjvat können zuweilen auch sehr grosse Massverhältnisse haben
und in ihrer Bauart und Baueinteilung stattlichen Palästen gleichen, ich erinnere
nur an die Riesenzelte Alexanders des Grossen (s. Chares und Phylarch bei
Athen. XII, 538 c, 539 d ) und an die von dem Rhodier Kallixenos beschriebenen
Bauwerke Ptolemaios II und Ptolemaios IV (Athen. V, 196 und 204 d), vgl. Böt-
ticher, Tektonik P, 260 f.
Wenn von einer ay.Yjvv) bei Schauspielen gesprochen wird, so könnte darunter
sowohl ein kleines Haus, das den Schauspielern als Ankleide- und Aufenthalts-
raum dient, als auch ein grösserer Holzbau, der an der Orchestra als Spielhin-
tergrund aufgestellt ist, verstanden werden. Da aber der am Spielplatz seit der
Zeit des Aischylos errichtete Bau allein die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf
sich zieht und auch er allein für den Verlauf des Dramas bedeutsam ist, so
wird ihm der Name Skene schlechtweg zugelegt, wobei eine Zweideutigkeit um
so weniger entstehen konnte, als eben diese Skene schon seit dem V. Jahrhun-
dert auch den Ankleideraum der Schauspieler in sich schloss, vgl. S. 202. Die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes hat noch Isidorus ganz richtig bezeichnet,
wenn er sagt (XVIII, 43): dicta autem scae?ia Graeca appellatione eo, quod in
speciem domus erat instructa.
Diese Benennung des Schauspielhauses muss schon im V. Jahrhundert all-
gemein üblich geworden sein. Dass bereits Agatharchos eine Schrift uspl ay.^vvj?
betitelt habe, möchte man aus Vitruv VII, praef. 11 entnehmen (S. 200). Bei
Aristophanes Thesm. 658 ist zwar der Ausdruck m-^a\ von den Festzelten der
Frauen zu verstehen (vgl. S. 247), ebenso Pac. 880 (et? "I<j8(ua sxY)vi)v i;j.tzuToü -«