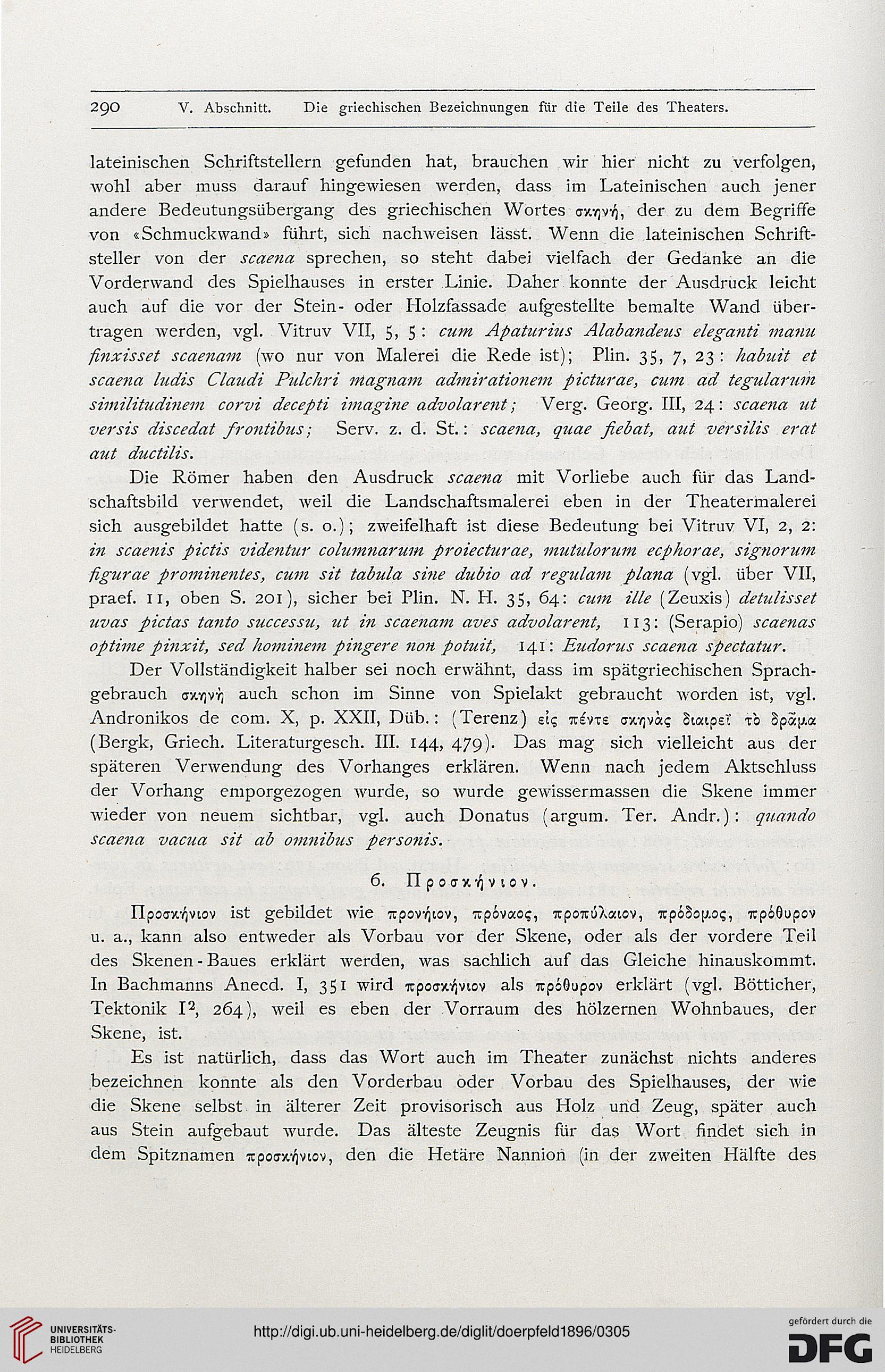290
V. Abschnitt. Die griechischen Bezeichnungen für die Teile des Theaters.
lateinischen Schriftstellern gefunden hat, brauchen wir hier nicht zu verfolgen,
wohl aber muss darauf hingewiesen werden, dass im Lateinischen auch jener
andere Bedeutungsübergang des griechischen Wortes sxyjv^, der zu dem Begriffe
von «Schmuckwand» führt, sich nachweisen lässt. Wenn die lateinischen Schrift-
steller von der scaena sprechen, so steht dabei vielfach der Gedanke an die
Vorderwand des Spielhauses in erster Linie. Daher konnte der Ausdruck leicht
auch auf die vor der Stein- oder Holzfassade aufgestellte bemalte Wand über-
tragen werden, vgl. Vitruv VII, S> 5 : cum Apaturius Alabandeus eleganti manu
finxisset scaenam (wo nur von Malerei die Rede ist); Plin. 35, 7, 23 : habuit et
scaena ludis Claudi Pulchri magnam admirationem picturae, cum ad tegularum
similitudinem corvi decepti imagine advolarent; Verg. Georg. III, 24: scaena ut
versis discedat frontibus; Serv. z. d. St.: scaena, quae fiebat, aut versilis erat
aut ductilis.
Die Römer haben den Ausdruck scaena mit Vorliebe auch für das Land-
schaftsbild verwendet, weil die Landschaftsmalerei eben in der Theatermalerei
sich ausgebildet hatte (s. o.); zweifelhaft ist diese Bedeutung bei Vitruv VI, 2, 2:
in scaenis pictis videntur columnarum proiecturae, mutulorum ecphorae, signoruni
figurae prominentes, cum sit tabula sine dubio ad regulam plana (vgl. über VII,
praef. Ii, oben S. 201), sicher bei Plin. N. H. 35, 64: cum ille (Zeuxis) detulisset
uvas pictas ta?ito successu, ut in scaenam aves advolarent, 113: (Serapio) scaenas
optime pinxit, sed hominem pingere non potuit, 141: Eudorus scae?ia spectaüir.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass im spätgriechischen Sprach-
gebrauch ay.Yjvo auch schon im Sinne von Spielakt gebraucht worden ist, vgl.
Andronikos de com. X, p. XXII, Düb.: (Terenz) s'i; uevte (jXYjvi? Siaipet xo Spay.a
(Bergk, Griech. Literaturgesch. III. 144, 479). Das mag sich vielleicht aus der
späteren Verwendung des Vorhanges erklären. Wenn nach jedem Aktschluss
der Vorhang emporgezogen wurde, so wurde gewissermassen die Skene immer
wieder von neuem sichtbar, vgl. auch Donatus (argum. Ter. Andr.): quando
scaena vacua sit ab Omnibus personis.
6. Ilpoffx^viov.
EIpo<TX,VjVtov ist gebildet wie upovfyov, rcpövao«;, 7cpo'ic.iSXaiov, xpooojj.o?, xpoöupov
u. a., kann also entweder als Vorbau vor der Skene, oder als der vordere Teil
des Skenen - Baues erklärt werden, was sachlich auf das Gleiche hinauskommt.
In Bachmanns Anecd. I, 351 wird xpoax^viov als upöOupov erklärt (vgl. Bötticher,
Tektonik I2, 264), weil es eben der Vorraum des hölzernen Wohnbaues, der
Skene, ist.
Es ist natürlich, dass das Wort auch im Theater zunächst nichts anderes
bezeichnen konnte als den Vorderbau oder Vorbau des Spielhauses, der wie
die Skene selbst in älterer Zeit provisorisch aus Holz und Zeug, später auch
aus Stein aufgebaut wurde. Das älteste Zeugnis für das Wort findet sich in
dem Spitznamen itpom^viov, den die Hetäre Nannion (in der zweiten Hälfte des
V. Abschnitt. Die griechischen Bezeichnungen für die Teile des Theaters.
lateinischen Schriftstellern gefunden hat, brauchen wir hier nicht zu verfolgen,
wohl aber muss darauf hingewiesen werden, dass im Lateinischen auch jener
andere Bedeutungsübergang des griechischen Wortes sxyjv^, der zu dem Begriffe
von «Schmuckwand» führt, sich nachweisen lässt. Wenn die lateinischen Schrift-
steller von der scaena sprechen, so steht dabei vielfach der Gedanke an die
Vorderwand des Spielhauses in erster Linie. Daher konnte der Ausdruck leicht
auch auf die vor der Stein- oder Holzfassade aufgestellte bemalte Wand über-
tragen werden, vgl. Vitruv VII, S> 5 : cum Apaturius Alabandeus eleganti manu
finxisset scaenam (wo nur von Malerei die Rede ist); Plin. 35, 7, 23 : habuit et
scaena ludis Claudi Pulchri magnam admirationem picturae, cum ad tegularum
similitudinem corvi decepti imagine advolarent; Verg. Georg. III, 24: scaena ut
versis discedat frontibus; Serv. z. d. St.: scaena, quae fiebat, aut versilis erat
aut ductilis.
Die Römer haben den Ausdruck scaena mit Vorliebe auch für das Land-
schaftsbild verwendet, weil die Landschaftsmalerei eben in der Theatermalerei
sich ausgebildet hatte (s. o.); zweifelhaft ist diese Bedeutung bei Vitruv VI, 2, 2:
in scaenis pictis videntur columnarum proiecturae, mutulorum ecphorae, signoruni
figurae prominentes, cum sit tabula sine dubio ad regulam plana (vgl. über VII,
praef. Ii, oben S. 201), sicher bei Plin. N. H. 35, 64: cum ille (Zeuxis) detulisset
uvas pictas ta?ito successu, ut in scaenam aves advolarent, 113: (Serapio) scaenas
optime pinxit, sed hominem pingere non potuit, 141: Eudorus scae?ia spectaüir.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass im spätgriechischen Sprach-
gebrauch ay.Yjvo auch schon im Sinne von Spielakt gebraucht worden ist, vgl.
Andronikos de com. X, p. XXII, Düb.: (Terenz) s'i; uevte (jXYjvi? Siaipet xo Spay.a
(Bergk, Griech. Literaturgesch. III. 144, 479). Das mag sich vielleicht aus der
späteren Verwendung des Vorhanges erklären. Wenn nach jedem Aktschluss
der Vorhang emporgezogen wurde, so wurde gewissermassen die Skene immer
wieder von neuem sichtbar, vgl. auch Donatus (argum. Ter. Andr.): quando
scaena vacua sit ab Omnibus personis.
6. Ilpoffx^viov.
EIpo<TX,VjVtov ist gebildet wie upovfyov, rcpövao«;, 7cpo'ic.iSXaiov, xpooojj.o?, xpoöupov
u. a., kann also entweder als Vorbau vor der Skene, oder als der vordere Teil
des Skenen - Baues erklärt werden, was sachlich auf das Gleiche hinauskommt.
In Bachmanns Anecd. I, 351 wird xpoax^viov als upöOupov erklärt (vgl. Bötticher,
Tektonik I2, 264), weil es eben der Vorraum des hölzernen Wohnbaues, der
Skene, ist.
Es ist natürlich, dass das Wort auch im Theater zunächst nichts anderes
bezeichnen konnte als den Vorderbau oder Vorbau des Spielhauses, der wie
die Skene selbst in älterer Zeit provisorisch aus Holz und Zeug, später auch
aus Stein aufgebaut wurde. Das älteste Zeugnis für das Wort findet sich in
dem Spitznamen itpom^viov, den die Hetäre Nannion (in der zweiten Hälfte des