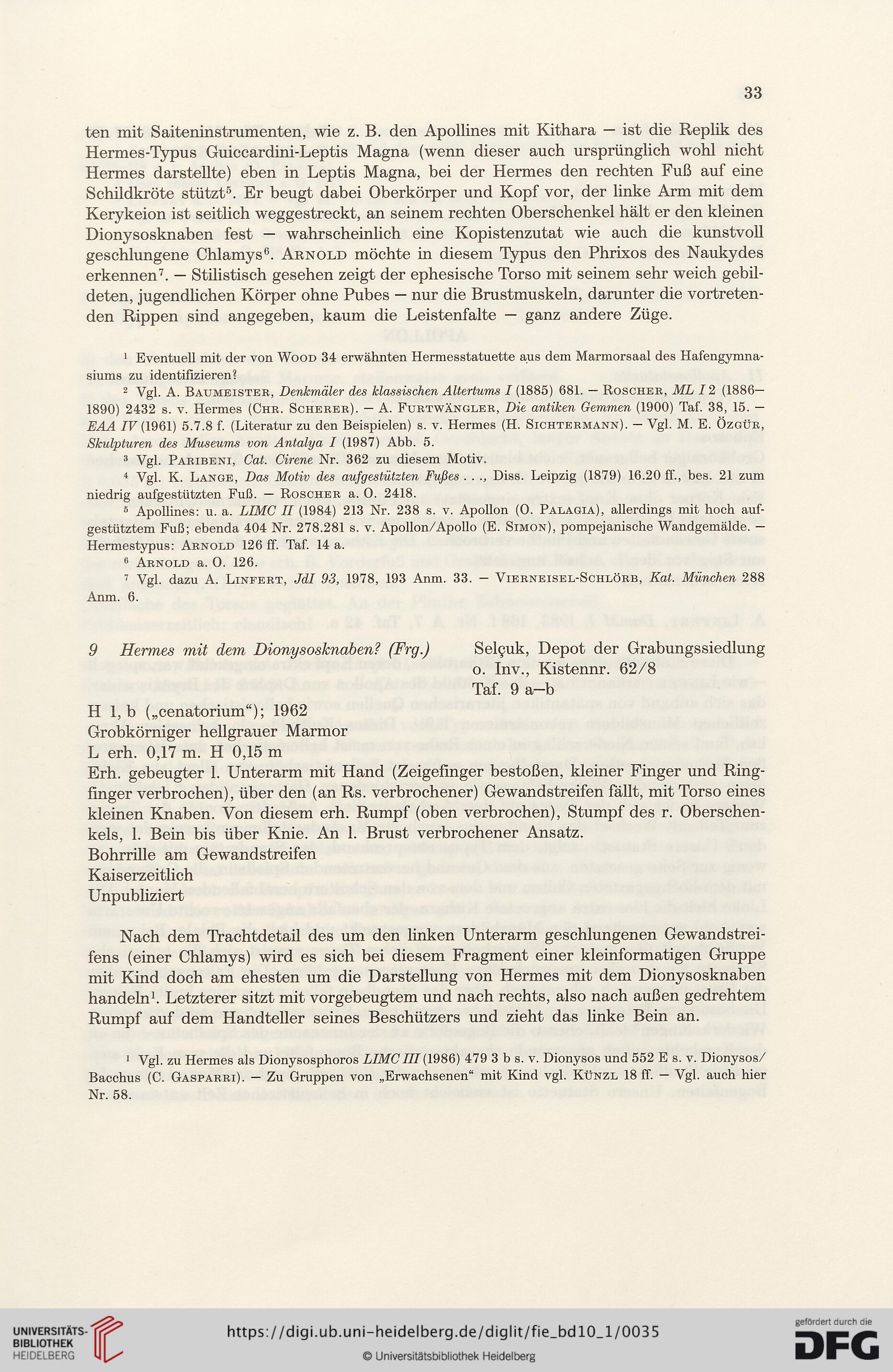33
ten mit Saiteninstrumenten, wie z. B. den Apollines mit Kithara — ist die Replik des
Hermes-Typus Guiccardini-Leptis Magna (wenn dieser auch ursprünglich wohl nicht
Hermes darstellte) eben in Leptis Magna, bei der Hermes den rechten Fuß auf eine
Schildkröte stützt5. Er beugt dabei Oberkörper und Kopf vor, der linke Arm mit dem
Kerykeion ist seitlich weggestreckt, an seinem rechten Oberschenkel hält er den kleinen
Dionysosknaben fest — wahrscheinlich eine Kopistenzutat wie auch die kunstvoll
geschlungene Chlamys6. Arnold möchte in diesem Typus den Phrixos des Naukydes
erkennen7. — Stilistisch gesehen zeigt der ephesische Torso mit seinem sehr weich gebil-
deten, jugendlichen Körper ohne Pubes — nur die Brustmuskeln, darunter die vortreten-
den Rippen sind angegeben, kaum die Leistenfalte — ganz andere Züge.
1 Eventuell mit der von Wood 34 erwähnten Hermesstatuette aus dem Marmorsaal des Hafengymna-
siums zu identifizieren?
2 Vgl. A. Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums I (1885) 681. — Roscher, ML 12 (1886—
1890) 2432 s. v. Hermes (Chr. Scherer). — A. Furtwängler, Die antiken Gemmen (1900) Taf. 38, 15. —
EAA IV (1961) 5.7.8 f. (Literatur zu den Beispielen) s. v. Hermes (H. Sichtbrmann). — Vgl. M. E. Özgür,
Skulpturen des Museums von Antalya I (1987) Abb. 5.
3 Vgl. Paribeni, Cat. Cirene Nr. 362 zu diesem Motiv.
4 Vgl. K. Lange, Das Motiv des aufgestützten Fußes . . ., Diss. Leipzig (1879) 16.20 ff., bes. 21 zum
niedrig aufgestützten Fuß. — Roscher a. 0. 2418.
5 Apollines: u. a. LIMC II (1984) 213 Nr. 238 s. v. Apollon (0. Palagia), allerdings mit hoch auf-
gestütztem Fuß; ebenda 404 Nr. 278.281 s. v. Apollon/Apollo (E. Simon), pompejanische Wandgemälde. —
Hermestypus: Arnold 126 ff. Taf. 14 a.
6 Arnold a. O. 126.
7 Vgl. dazu A. Linfert, Jdl 93, 1978, 193 Anm. 33. — Vierneisel-Schlörb, Kat. München 288
Anm. 6.
9 Hermes mit dem Dionysosknaben? (Frg.) Selyuk, Depot der GrabungsSiedlung
o. Inv., Kistennr. 62/8
Taf. 9 a—b
H 1, b („cenatorium“); 1962
Grobkörniger hellgrauer Marmor
L erh. 0,17 m. H 0,15 m
Erh. gebeugter 1. Unterarm mit Hand (Zeigefinger bestoßen, kleiner Finger und Ring-
finger verbrochen), über den (an Rs. verbrochener) Gewandstreifen fällt, mit Torso eines
kleinen Knaben. Von diesem erh. Rumpf (oben verbrochen), Stumpf des r. Oberschen-
kels, 1. Bein bis über Knie. An 1. Brust verbrochener Ansatz.
Bohrrille am Gewandstreifen
Kaiserzeitlich
Unpubliziert
Nach dem Trachtdetail des um den linken Unterarm geschlungenen Gewandstrei-
fens (einer Chlamys) wird es sich bei diesem Fragment einer kleinformatigen Gruppe
mit Kind doch am ehesten um die Darstellung von Hermes mit dem Dionysosknaben
handeln1. Letzterer sitzt mit vorgebeugtem und nach rechts, also nach außen gedrehtem
Rumpf auf dem Handteller seines Beschützers und zieht das linke Bein an.
1 Vgl. zu Hermes als Dionysosphoros LIMC III (1986) 479 3 b s. v. Dionysos und 552 E s. v. Dionysos/
Bacchus (C. Gasparri). — Zu Gruppen von „Erwachsenen“ mit Kind vgl. Künzl 18 ff. — Vgl. auch hier
Nr. 58.
ten mit Saiteninstrumenten, wie z. B. den Apollines mit Kithara — ist die Replik des
Hermes-Typus Guiccardini-Leptis Magna (wenn dieser auch ursprünglich wohl nicht
Hermes darstellte) eben in Leptis Magna, bei der Hermes den rechten Fuß auf eine
Schildkröte stützt5. Er beugt dabei Oberkörper und Kopf vor, der linke Arm mit dem
Kerykeion ist seitlich weggestreckt, an seinem rechten Oberschenkel hält er den kleinen
Dionysosknaben fest — wahrscheinlich eine Kopistenzutat wie auch die kunstvoll
geschlungene Chlamys6. Arnold möchte in diesem Typus den Phrixos des Naukydes
erkennen7. — Stilistisch gesehen zeigt der ephesische Torso mit seinem sehr weich gebil-
deten, jugendlichen Körper ohne Pubes — nur die Brustmuskeln, darunter die vortreten-
den Rippen sind angegeben, kaum die Leistenfalte — ganz andere Züge.
1 Eventuell mit der von Wood 34 erwähnten Hermesstatuette aus dem Marmorsaal des Hafengymna-
siums zu identifizieren?
2 Vgl. A. Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums I (1885) 681. — Roscher, ML 12 (1886—
1890) 2432 s. v. Hermes (Chr. Scherer). — A. Furtwängler, Die antiken Gemmen (1900) Taf. 38, 15. —
EAA IV (1961) 5.7.8 f. (Literatur zu den Beispielen) s. v. Hermes (H. Sichtbrmann). — Vgl. M. E. Özgür,
Skulpturen des Museums von Antalya I (1987) Abb. 5.
3 Vgl. Paribeni, Cat. Cirene Nr. 362 zu diesem Motiv.
4 Vgl. K. Lange, Das Motiv des aufgestützten Fußes . . ., Diss. Leipzig (1879) 16.20 ff., bes. 21 zum
niedrig aufgestützten Fuß. — Roscher a. 0. 2418.
5 Apollines: u. a. LIMC II (1984) 213 Nr. 238 s. v. Apollon (0. Palagia), allerdings mit hoch auf-
gestütztem Fuß; ebenda 404 Nr. 278.281 s. v. Apollon/Apollo (E. Simon), pompejanische Wandgemälde. —
Hermestypus: Arnold 126 ff. Taf. 14 a.
6 Arnold a. O. 126.
7 Vgl. dazu A. Linfert, Jdl 93, 1978, 193 Anm. 33. — Vierneisel-Schlörb, Kat. München 288
Anm. 6.
9 Hermes mit dem Dionysosknaben? (Frg.) Selyuk, Depot der GrabungsSiedlung
o. Inv., Kistennr. 62/8
Taf. 9 a—b
H 1, b („cenatorium“); 1962
Grobkörniger hellgrauer Marmor
L erh. 0,17 m. H 0,15 m
Erh. gebeugter 1. Unterarm mit Hand (Zeigefinger bestoßen, kleiner Finger und Ring-
finger verbrochen), über den (an Rs. verbrochener) Gewandstreifen fällt, mit Torso eines
kleinen Knaben. Von diesem erh. Rumpf (oben verbrochen), Stumpf des r. Oberschen-
kels, 1. Bein bis über Knie. An 1. Brust verbrochener Ansatz.
Bohrrille am Gewandstreifen
Kaiserzeitlich
Unpubliziert
Nach dem Trachtdetail des um den linken Unterarm geschlungenen Gewandstrei-
fens (einer Chlamys) wird es sich bei diesem Fragment einer kleinformatigen Gruppe
mit Kind doch am ehesten um die Darstellung von Hermes mit dem Dionysosknaben
handeln1. Letzterer sitzt mit vorgebeugtem und nach rechts, also nach außen gedrehtem
Rumpf auf dem Handteller seines Beschützers und zieht das linke Bein an.
1 Vgl. zu Hermes als Dionysosphoros LIMC III (1986) 479 3 b s. v. Dionysos und 552 E s. v. Dionysos/
Bacchus (C. Gasparri). — Zu Gruppen von „Erwachsenen“ mit Kind vgl. Künzl 18 ff. — Vgl. auch hier
Nr. 58.